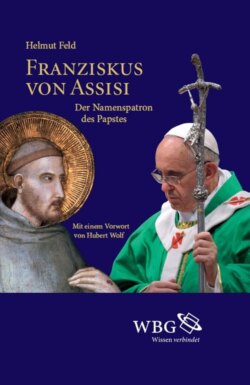Читать книгу Franziskus von Assisi - Helmut Feld - Страница 89
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Architektur und bildende Kunst
ОглавлениеDer große kunstgeschichtliche Einschnitt, der in Italien eine Umformung aller Stilelemente in der Malerei und Plastik brachte, fand bekanntlich in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts statt. Die franziskanische Bewegung ist eine seiner geistigen Voraussetzungen. Die ersten Höhepunkte der neuen Malerei werden durch die Namen Cimabue und Giotto angezeigt. Die zweite geistige Voraussetzung für das Neue in der Kunst ist am sizilianischen Hof Friedrichs II. zu suchen. Sie wirkt sich vor allem in der nunmehr an den Vorbildern der Antike und der Natur orientierten Plastik des Nicola (Kanzel des Baptisteriums von Pisa: 1259/60) und des Giovanni Pisano (Domkanzel von Pisa: 1308–1312) aus.90
Eine andere revolutionäre Neuerung, auf dem Gebiet der Architektur, vollzog sich noch zu Lebzeiten des Franziskus. Inwieweit er davon Notiz genommen hat, wissen wir allerdings nicht. Es handelt sich um das Eindringen der burgundischen Cistercienser-Gotik in Italien. Die Abteikirche von Fossanova, 1163 begonnen, wurde am 9. Juni 1208 durch den Papst Innocenz III. geweiht. Mit ihrer herrlichen Rosette und dem strengen, nur durch das Licht belebten Innenraum ist sie vielleicht der schönste gotische Sakralbau Italiens. In Casamari, wo schon Eugen III. eine Kirche geweiht hatte, begann man 1203 mit dem Bau der heute noch stehenden Abteikirche. Die Mittel dafür hatte der Kardinal Cencio Savelli, der spätere Papst Honorius III., zur Verfügung gestellt, der die Kirche auch im Jahre 1217 weihte.91 Die cisterciensische Gotik hat insbesondere den Bau der großen städtischen Franziskanerkirchen beeinflußt, die von der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts an allenthalben in Italien entstehen. »Weil der Franziskanerorden der Nachfolger und Erbe der Zisterzienser wird, übernimmt er mit vielen Vorschriften und Eigentümlichkeiten der letzteren auch die Grundform von deren Gotteshäusern – und weil er verbunden mit der Dominikanergemeinde die geistige Führung des Volkes und die eigentliche kulturelle Gewalt in Italien für zwei Jahrhunderte erlangt, wird die Baukunst der Bettelmönche, die aus derjenigen der Zisterzienser entstanden ist, die Baukunst ganz Italiens.«92
Den neuen Dom S. Rufino in Assisi, dessen ältere Teile noch vom romanischen Stil geprägt sind, der aber auch schon gotische Stilelemente (wie das große Rosenfenster der Westfassade) enthält, hat Franziskus als Baustelle erlebt. Obwohl schon 1134 mit dem Bau begonnen wurde, konnte Gregor IX. erst 1228, im Jahr der Heiligsprechung des Franziskus, den Hochaltar weihen. Erst 1253 konsekrierte Innocenz IV. während seines langen sommerlichen Aufenthalts in Assisi den Dom, ebenso die Grabeskirche S. Francesco und die Benediktiner-Abteikirche S. Pietro.93
Für Franziskus selbst dürfen wir wohl annehmen, daß die Bilderwelt der romanischen Kirchen auf ihn nicht ohne Eindruck geblieben ist. Es gibt Anhaltspunkte dafür, daß seine religiöse Vorstellungswelt von dem reichen Bilderschmuck der Kirchen beeinflußt war. Denn die weitflächigen Wände der romanischen Innenräume waren, ebenso wie später die der gotischen, mit Mosaiken und Fresken überzogen, die den christlichen Kosmos – Himmel, Erde und Unterwelt – darstellten.94 Vermutlich eindrücklicher als das geschriebene und gesprochene Wort boten sie den Betrachtern den Stoff für religiöse Träume, Phantasien und Visionen, ja für den Aufbau ihres gesamten Weltbildes. Das gilt auch für Einzeldarstellungen, wie den im 12. Jahrhundert in Mittelitalien verbreiteten gemalten Crucifixus, die sogenannte Croce dipinta. Sie enthielt eine auf kleiner Fläche zusammengedrängte Darstellung des Heilsgeschehens.95 Der fromme Betrachter, der vor einem solchen Kreuzbild des Erlösers betete, konnte gewiß tiefe und prägende seelische Eindrücke empfangen. Im Falle des Franziskus war es der berühmte Crucifixus von San Damiano,96 der in einem visionären Erlebnis seinem Leben eine entscheidende Wende gab und, nach dem Zeugnis des ältesten Biographen, seine Frömmigkeit und sein gesamtes zukünftiges Leben bestimmte.97
1 Für die allgemeine Geschichte des Hoch- und Spätmittelalters s. vor allem: Handbuch der europäischen Geschichte, hrsg. von Theodor SCHIEDER, Bd. 2: Europa im Hoch- und Spätmittelalter, hrsg. von Ferdinand SEIBT, Stuttgart 1987; Hartmut BOOCKMANN, Stauferzeit und spätes Mittelalter. Deutschland 1125–1517 (Das Reich und die Deutschen, Bd. 7), Berlin 1987; Harald ZIMMERMANN, Das Mittelalter. II. Teil: Von den Kreuzzügen bis zum Ende der großen Entdeckungsfahrten, Braunschweig 1979.
2 I Cel 43 (Anal. Fr. 10,34).
3 H. WOLTER, Der Kampf der Kurie um die Führung im Abendland (1216–74), in: Handbuch der Kirchengeschichte, hrsg. von Hubert JEDIN, Bd. III/2: Die mittelalterliche Kirche. Vom kirchlichen Hochmittelalter bis zum Vorabend der Reformation, Freiburg Br.1968/1985, 237–296; ebd. 241.
4 Vgl. die bemerkenswerten Sätze in der Biographie Innocenz’ IV. von dessen Beichtvater, dem Franziskaner und Bischof von Assisi Nicolaus de Carbio: »Quis ergo, nisi mente captus, ignorat potestatem imperatoris et regum pontificibus esse subiectam? Et quis credat a subiectione Romani pontificis se esse alienum, nisi qui, peccatis suis exigentibus, inter oves Christi pastorum principis non meruit numerari?«: F. PAGNOTTI, Niccolò da Calvi e la sua Vita d’Innocenzo IV con una breve introduzione sulla istoriografia pontificia nei secoli XIII e XIV. Arch. della R. Soc. Rom. di Storia Patria 21 (1898), 7–120; ebd. 95 (c. 19).
5 S. den Bericht des Salimbene de Adam über das Provinzialkapitel von Sens (1247), bei dem Ludwig persönlich anwesend war (MGH SS 32,221–225); vgl. Chron. XXIV Gen. (Anal. Fr. 3,90f.) und Fioretti, c. 34 (ed. CAMBELL, 417/419; FF 1868) über eine legendäre Begegnung des Königs mit Bruder Ägidius.
6 I Cel 57 (Anal. Fr. 10,43f.); II Cel 30 (ebd. 149); Jordan von Giano, Chron. 10 (Anal. Fr. 1,4; ed. BOEHMER, 7); Jakob von Vitry, Ep. 6 vom März 1220 aus Damiette: HUYGENS, Lettres (o. I. Kap., Anm. 49), 132f.; BOEHMER, Analekten, 101; Jakob von Vitry, Historia orientalis II,32; BOEHMER, Analekten, 104f.; Bonaventura, Leg. mai. IX,8 (Anal. Fr. 10,600f.), mit der Erzählung vom Angebot der Feuerprobe vonseiten des Franziskus; ausführlich u. Kap. VII, bei Anm. 74–86.
7 Über die Kreuzzüge s. vor allem die Gesamtdarstellung von Steven RUNCIMAN: A History of the Crusades, 3 Bde., Cambridge 1952–1954 (deutsch: Geschichte der Kreuzzüge, München 1957–1960); Martin ERBSTÖSSER, Die Kreuzzüge. Eine Kulturgeschichte, Leipzig 1977; Rainer Christoph SCHWINGES, Die Kreuzzugsbewegung, in: Handbuch der europäischen Geschichte, hrsg. von Th. SCHIEDER, Bd. 2, Stuttgart 1987, 174–180, mit zahlreichen Quellen- und Literaturangaben.
8 De laude novae mil.,, c. 3 (S. Bernardi Opera, ed. J. LECLERCQ, H.M. ROCHAIS 3,217–219; MPL 182,924).
9 Ep. 457 (Opera, ed.c. 8,432; MPL 182,651f.).
10 Über ihn s. die Biographie von Peter HERDE, Karl I. von Anjou (Urban-TB, Bd. 305), Stuttgart 1979.
11 Peter HERDE, Cölestin V. (1294) (Peter vom Morrone), der Engelpapst (Päpste und Papsttum, 16), Stuttgart 1981.
12 Über Assisi zur Zeit des Franziskus s. vor allem: Paul V. RILEY, Jr., Francis’ Assisi: Its Political and Social History, 1175–1225. Franc. Studies 34 (1974), 393–424; Raoul MANSELLI, Assisi tra Impero e Papato, in: Assisi al tempo di San Francesco. Atti del V Convegno internazionale, Assisi, 13–16 ott. 1977, Assisi 1978, 337–357 (beide Aufsätze mit Angaben über die ältere Literatur); ferner: Daniel WALEY, The Papal State in the Thirteenth Century, London 1961.
13 Über Konrad von Ürslingen (nach der auch Urslingen, Irslingen genannten Stammburg nördlich von Rottweil) s.: Klaus SCHUBRING, Die Herzoge von Urslingen. Diss. phil. Tübingen, Bamberg 1972; DERS., Die Herzoge von Urslingen. Studien zu ihrer Besitz-, Sozial- und Familiengeschichte mit Regesten (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, B 67), Stuttgart 1974, 35–42.
14 SCHUBRING, Herzoge, 102, Nr. 25.
15 Attilio BARTOLI LANGELI, La realtà sociale assisana e il patto del 1210, in: Assisi al tempo di San Francesco (o. Anm. 12), 271–336.
16 S. hierzu: STANISLAO DA CAMPAGNOLA, La Società Assisana nelle fonti francescane, in: Assisi al tempo di S.F. (o. Anm. 12), 359–392.
17 Giuseppe MIRA, Aspetti di vita economica nell’Assisi di San Francesco, ebd. 123–179.
18 II Cel 5 (Anal. Fr. 10,133); s.u. III. Kapitel, bei Anm. 56.
19 3 Soc 2 (ed. DESBONNETS, 90).
20 Grundlegend zu diesem gesamten Komplex: Herbert GRUNDMANN, Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Untersuchungen über die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen der Ketzerei, den Bettelorden und der religiösen Frauenbewegung im 12. und 13. Jahrhundert und über die geschichtlichen Grundlagen der deutschen Mystik, Berlin 1935. Darmstadt 21961 (Neudr. 1977); Ernst WERNER, Pauperes Christi. Studien zu sozial-religiösen Bewegungen im Zeitalter des Reformpapsttums, Leipzig 1956.
21 Giovanni MICCOLI, Per la storia della Pataria milanese. Bollettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano 70 (1958), 43–123.
22 WERNER, Pauperes Christi, 89; s. ferner: Hermann JAKOBS, Die Hirsauer. Ihre Ausbreitung und Rechtsstellung im Zeitalter des Investiturstreites, Köln 1961; ebd. 190–223: »Die Hirsauer im Investiturstreit.«
23 Piero ZERBI, Pasquale II e l’ideale della povertà della Chiesa. Università Cattolica del Sacro Cuore. Annuario per l’anno accademico 1964–1965, Milano 1965, 205–229.
24 Vgl. Ellen Scott DAVISON, Forerunners of Saint Francis and other Studies, Boston-New York 1927 (Neudr. New York 1978); ILARINO DA MILANO, La spiritualità evangelica anteriore a san Francesco, in: Quaderni di spiritualità francescana, 6: Il vangelo e la spiritualità francescana, S. Maria degli Angeli, Assisi 1963, 34–70.
25 Vgl. etwa Leg. Per. 18 (ed. BIGARONI, 56): »Et dixit Dominus michi, quod volebat, quod ego essem unus novellus pazzus in mundo.«
26 WERNER, Pauperes Christi, 101f.; Helmut FELD, Art. Johannes Gualberti, in: BBKL 3 (1992), 382–385.
27 S. Joannis Gualberti vita auctore Attone, c. 3 (MPL 146,672).
28 GRUNDMANN, Religiöse Bewegungen, 491–493; WERNER, Pauperes Christi, 28; Jean BECQUET, Art. Étienne de Muret, in: Dict. Spir. 4 (1960), 1504–1514. Zu den Eremiten des 12. Jahrhunderts s. auch: Gérard Gilles MEERSSEMAN, Eremitismo e predieazione itinerante dei secoli XI e XII, in: L’eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII. Atti della seconda Settimana di studio, Mendola, 30 ag. – 6 sett. 1962, Milano 1965, 164–179.
29 Regula S. Stephani Conf., Prologus (MPL 204,1136).
30 Leg. Per. 18 (ed. BIGARONI, 56); vgl. o. Anm. 25.
31 WERNER, Pauperes Christi, 42ff. 87; R. NIDERST, Robert d’Arbrissel et les origines de l’Ordre de Fontevrault, Rodez 1952; Therese LATZKE, Robert von Arbrissel, Ermengard und Eva. Mittelalt. Jahrb. 19 (1984), 116–154; J.-M. BIENVENU, Art. Robert d’Arbrissel, in: Dict. Spir. 13 (1988), 704–713.
32 Vita B. Roberti de Arbrissello auctore Baldrico episcopo Dolensi, 10–12 (MPL 162,1049–1051).
33 In Roberts Mahnschreiben an die Gräfin Ermengard von der Bretagne heißt es: »Voluntas tua esset, ut mundum relinqueres, et te ipsam abnegares, et nuda nudum Christum in cruce sequereris«; J. DE PETIGNY, Lettre inédite de Robert d’Arbrissel à la comtesse Ermengarde. Bibl. de l’École des Chartes 5, 3me série (1854), 209–235; ebd. 227; Johannes VON WALTER, Die ersten Wanderprediger Frankreichs. Studien zur Geschichte des Mönchtums, I, Leipzig 1903 (Nachdr. Aalen 1972), 125.
34 S. z.B. Ep. 125,20, an den Mönch Rusticus (CSEL 56,142): »Si habes substantiam, vende et da pauperibus, si non habes, grandi onere liberatus es; nudum Christum nudus sequere«; vgl. auch Ep. 52,5 (CSEL 54,422,6); 58,2 (ebd. 529,2); 120,1 (CSEL 55,478,1).
35 Matthäus BERNARDS, Nudus nudum Christum sequi. Wiss. u. Weish. 14 (1951), 148–151; Jean CHÂTILLON, Nudum Christum nudus sequere. Note sur les origines et la signification du thème de la nudité spirituelle dans les écrits de saint Bonaventure, in: S. Bonaventura 1274–1974, IV. Theologica, Grottaferrata 1974, 719.772; Reginald GRÉGOIRE, Aimé SOLIGNAC, Art. Nudité, in: Diet. Spir. 11 (1982), 508–517.
36 Ep. 55 (MPL 182,160f.; Opera, ed. LECLERCQ-ROCHAIS 7,147).
37 Ep. 492 (MPL 182,710; von LECLERCQ-ROCHAIS als unecht ausgeschieden).
38 »considerans apud se quod nudam crucem nudus utique sequi deberet«: Vita S. Norberti (MPL 170,1272). Zum Stand der Forschung über Norbert und die Prämonstratenser s.: Kaspar ELM (Hrsg.), Norbert von Xanten. Adeliger – Ordensstifter – Kirchenfürst, Köln 1984.
39 WERNER, Pauperes Christi (o. Anm.20), 45.
40 Ebd. 87.
41 K.A. FINK, Papsttum und Kirche im abendländischen Mittelalter, München 1981, 114; wichtig ist das gesamte Kapitel: »›Häresie‹ und ›Ketzerei‹ als mittelalterliche christliche Konfession« (ebd. 112–136, und die reiche in den Anm. zitierte Literatur zu dem Thema); vgl. hierzu auch: Giorgio CRACCO, Riforma ed eresia in momenti della cultura europea tra X e XI secolo. Riv. di stor. e lett. rel. 7 (1971), 411–477; Malcolm D. LAMBERT, Ketzerei im Mittelalter. Häresien von Bogumil bis Hus, München 1981 (engl. Original: Medieval Heresy – Popular Movements from Bogomil to Hus, London 1977).
42 James FEARNS, Peter von Bruis und die religiösen Bewegungen des 12. Jahrhunderts. AKG 48 (1966), 311–335; R. MANSELLI, Il secolo XII: Religione popolare ed eresia, Roma 31983, 87–100 (11953; 21975 unter dem Titel: Studi sulle eresie del secolo XII).
43 Petri Venerabilis Contra Petrobrusianos hereticos, ed. J. FEARNS, Turnhout 1968 (CCCM 10); ältere Ed. in MPL 189,719–850); Jean CHÂTILLON, Pierre le Vénérable et les Petrobrusiens, in: Pierre Abélard – Pierre le Vénérable. Les courants philosophiques, littéraires et artistiques en Occident au milieu du XIIe siècle (Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique, no. 546), Paris 1975, 165–179.
44 »singularis ferus«: in einem auf das Jahr 1145 datierten Brief an den Grafen Ildefons von St.-Gilles und Toulouse (Ep. 241: MPL 182,434; Opera, ed. LECLERCQ-ROCHAIS 8,125–127); R. MANSELLI, Il monaco Enrico e la sua eresia. Bull. dell’Ist. it. per il medio evo e Arch. Mur. 65 (1953), 1–63; DERS., Secolo (o. Anm. 42), 101–117; E. WERNER, Pauperes Christi (o. Anm. 20), 165–169.
45 Bibl. nationale Paris, ms. lat. 3371; Stadtbibl. Nizza, ms. 3 (R. 18); MANSELLI, Monaco Enrico, 44–63.
46 S. dazu besonders: Jürgen MIETHKE, Theologenprozesse in der ersten Phase ihrer institutionellen Ausbildung: Die Verfahren gegen Peter Abaelard und Gilbert von Poitiers. Viator 6 (1975), 87–116.
47 Arsenio FRUGONI, Arnaldo da Brescia nelle fonti del secolo XII (Studi storici, fasc. 8–9), Roma 1954; Raoul MANSELLI, Art. Arnold von Brescia, in: TRE 4 (1979), 129–133.
48 Ep. 243 (MPL 182,437–440; ed. LECLERCQ-ROCHAIS 8,130–134).
49 Vgl. seine Würdigung durch Ferdinand GREGOROVIUS, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter VIII.5.2 (dtv 5960, München 1978, Bd. II/1,229–231).
50 Hierzu zuletzt: Kurt-Victor SELGE, Die religiösen Laienbewegungen des 12. Jahrhunderts, insbesondere die Waldenser, als Hintergrund und Voraussetzung der franziskanischen Bewegung, in: Franz von Assisi und die Armutsbewegung seiner Zeit… Symposien der Internationalen Kommission für Vergleichende Kirchengeschichte – Subkommission Österreich, Wien 1987, 11–28; ebd. 19f. und Anm. 32.
51 WERNER, Pauperes Christi (o. Anm. 20), 192–196; Walter MOHR, Tanchelm von Antwerpen. Eine nochmalige Überprüfung der Quellenlage. Annales Univ. Saraviensis, Phil.-Lettres 3 (1954), 234–247.
52 »Solche Begründungen waren im Mittelalter nicht ungewöhnlich. Sie entstanden als Gegengewicht zum kirchlichen Heilsapparat und zur Schlüsselgewalt und fanden im Volk, wo der Glaube an Wunder verbreitet war, fast immer beträchtliche Resonanz« (Martin ERBSTÖSSER, Ketzer im Mittelalter, Leipzig-Stuttgart 1984, 88).
55 WERNER, Pauperes Christi (o. Anm. 20), 179; Luchesius SPÄTLING, De Apostolicis Pseudo-Apostolis Apostolinis, München 1947, 67–69; Arno BORST, Die Katharer (Schriften der MGH, 12), Stuttgart 1953, 87f.; ebd. Anm. 20 eine Übersicht über die Quellen; Norman COHN, Das neue irdische Paradies. Revolutionärer Millenarismus und mystischer Anarchismus im mittelalterlichen Europa, Reinbek bei Hamburg 1988, 43–45 (engl. Orig.: The Pursuit of the Millennium. Revolutionary Millenarians and Mystic Anarchists of the Middle Ages, London 51970); H. TÜCHLE, Art. Eudo de la Stella (Éon de l’Étoile), in: LThK2 3 (1959), 1169f.; T. DE MOREMBERT, Art. Éon de l’Étoile, m: DHGE 15 (1963), 519.
54 H. GRUNDMANN, Religiöse Bewegungen (o. Anm. 20), 91–118; Kurt-Victor SELGE, Die ersten Waldenser, 2 Bde. (Arbeiten zur Kirchengeschichte, 37), Berlin 1967; Amedeo MOLNAR, Die Waldenser. Geschichte und europäisches Ausmaß einer Ketzerbewegung, Berlin 1980; Rolf ZERFASS, Der Streit um die Laienpredigt. Eine pastoralgeschichtliche Untersuchung zum Verständnis des Predigtamtes und zu seiner Entwick lung im 12. und 13. Jahrhundert, Freiburg-Basel-Wien 1974, 59–82.
55 A. DONDAINE, Aux origines du Valdéisme. Une profession de foi de Valdes. Arch. Fratr. Praed. 16 (1946), 190–235; R. MANSELLI, Secolo XII (o. Anm. 42), 119–133 (»Il valdismo originario«).
56 Walter Map, De nugis curialium. Courtiers’ Trifles, ed. and transl. by M.R. JAMES, rev. by C.N.L. BROOKE and R.A.B. MYNORS, Oxford 1983, 126: »duo Valdesii, qui sua videbantur in secta praecipui«: man kann mit gutem Grund vermuten, daß einer von ihnen Waldes selbst war.
57 »Hii multa petebant instancia predicationis auctoritatem sibi confirmari, quia periti sibi videbantur, cum vix essent scioli… Nunquid ergo margarita porcis, verbum dabitur ydiotis, quos ineptos scimus illud suscipere, nedum dare quod acceperunt? Absit hoc, et evellatur« (ebd. 124).
58 Vgl. I Cel 29 (Anal. Fr. 10,24,6f.); Mk 6,7; Lk 10,1.
59 »Hü certa nusquam habent domicilia, bini et bini circuerunt nudi pedes, laneis induti, nichil habentes, omnia sibi communia tanquam apostoli, nudi nudum Christum sequentes. Humillimo nunc incipiunt modo, quia pedem inferre nequeunt; quos si admiserimus, expellemur« (Walter Map, I.c. 126).
60 Edition: SELGE, Waldenser (o. Anm. 54), Bd. II.
61 SELGE, Waldenser II,193–225.
62 GRUNDMANN, Religiöse Bewegungen (o. Anm. 20), 118–127; SELGE, Waldenser I,188–193.
63 SELGE, ebd. 159f. 191. 282.
64 »Specialiter autem de fractione panis, super qua infamati sumus, diximus et dicimus, quia nunquam factum fuit causa praesumptionis, nec causa contemptus sacrificii sacerdotis, sed causa ardoris fidei et charitatis et causa deliberationis, ne indurarentur simplices fideles inter haereticos permanentes, et sacramentum eucharistiae non accipientes; sed nunc et in perpetuum abdicamus et abiicimus et abdicabimus a nobis et ab omnibus nobis credentibus, secundum nostrum posse, ab opère et a credulitate, corde credentes et ore confitentes sacramentum corporis et sanguinis Christi nec esse conficiendum nec posse confici nisi a sacerdote per impositionem manus visibilis episcopi secundum morem Ecclesiae visibiliter ordinato« (Innocenz III., Ep. 94: MPL 216,291 B-C).
65 Vgl. z.B. den Bericht »Manifestatio Haeresis« bezüglich der Waldenser: »Credunt etiam, quod nefas est dicere, 〈quod〉 ecclesia romana non dat 〈magis〉 eis spirituale viaticum quam quilibet vel quelibet suorum sine vestimentis ecclesiasticis, sine tonsura, et debet conficere corpus Christi«: veröffentlicht bei: Annie CAZENAVE, Bien et mal dans un mythe cathare languedocien, in: A. ZIMMERMANN (Hrsg.), Die Mächte des Guten und Bösen. Vorstellungen im XII. und XIII. Jahrhundert über ihr Wirken in der Heilsgeschichte (Miscellanea Mediaevalia, 11), Berlin-New York 1977, 344–387; ebd. 387.
66 Leg. Per. 97 (ed. BIGARONI, 56–58), und dazu: Helmut FELD, Franziskus von Assisi – der »zweite Christus« (Inst. für Europ. Geschichte Mainz, Vorträge, 84), Mainz 1991, 36–39; s. auch u. VIII. Kap., bei Anm. 99–100.
67 GRUNDMANN, Religiöse Bewegungen (o. Anm. 20), 72–91; R. MANSELLI, Franziskus, Zürich 1984, 21f.
68 Ep. 432 (MPL 182,676–680); SPÄTLING, De Apostolicis (o. Anm. 53), 69–82; WERNER, Pauperes Christi (o. Anm. 20), 181–186; R. MANSELLI, Evervino di Steinfeld e San Bernardo di Clairvaux, in: DERS., Secolo XII (o. Anm. 42), 149–164.
69 »Purgatorium ignem post mortem non concedunt; sed animas statim, quando egrediuntur, de corpore in aeternam vel requiem, vel poenam transisse, propter illa Salomonis: Lignum in quamcumque partem ceciderit, sive ad austrum, sive ad aquilonem, ibi manebit (Eccl. 11,3). Et sic fidelium orationes vel oblationes pro defunctis annihilant« (MPL 182,679).
70 Livre des deux principes. Introduction, texte critique, traduction, notes et index de Christine THOUZELLIER (Sources chrétiennes, 198), Paris 1973.
71 A. BORST, Katharer (o. Anm. 53); Antoine DONDAINE, Durand de Huesca et la polémique anticathare. Arch. Fratr. Praed. 39 (1959), 228–278; R. MANSELLI, L’eresia del male, Napoli 1963; Cathares en Languedoc. Cahiers de Fanjeaux 3, Toulouse 1968; Georg WILD, Bogumilen und Katharer in ihrer Symbolik. I: Die Symbolik des Katharertums und das Problem des heterodoxen Symbols im Rahmen der abendländischen Kultureinheit, Wiesbaden 1970; René NELLI, Les Cathares, Paris 1972. 21982; Milan Loos, Dualist Heresy in the Middle Ages, Prag 1974; Jean DUVERNOY, Le Catharisme: la religion des Cathares, Toulouse 1976; A. CAZENAVE, Bien et mal (o. Anm. 65); FINK, Papsttum (o. Anm. 41), 118–123; Gerhard ROTTENWÖHRER, Der Katharismus, 2 Bde., Bad Honnef 1982; DERS., Unde malum? Herkunft und Gestalt des Bösen nach heterodoxer Lehre von Markion bis zu den Katharern, Bad Honnef 1986; Jean BLUM, Les Cathares, Paris 1985; Steven RUNCIMAN, Häresie und Christentum. Der mittelalterliche Manichäismus, München 1988 (engl. Orig.: The Medieval Manichee. A Study of the Christian Dualist Heresy, Cambridge 21982); Daniela MÜLLER, Art. Katharer, in: TUE 18 (1989), 21–30.
72 Für die mit dem Engelsfall zusammenhängenden Mythen s. vor allem: Le Livre secret des Cathares. Interrogatio Johannis. Apocryphe d’origine bogomile. Édition critique, traduction, commentaire par Edina Bozóky, Paris 1980, 42/44; A. DONDAINE, La hiérarchie cathare en Italie. Arch. Fr. Praed. 19 (1949), 280–312; 20 (1950), 234–324; ebd. 309: »De heresi Catharorum in Lombardia«; FELD, Franziskus (o. Anm. 66), 52f.; s.u. VI. Kap., bei Anm. 180–182.
73 RUNCIMAN, Häresie (o. Anm. 71), 206: »Und das buddhistische Charakteristikum der auf der Lehre von der Metempsychose beruhenden Sympathie für alles Lebendige – eine Sympathie, die der heilige Franz von Assisi von den Katharern lernte – ist wieder ein natürliches Produkt dualistischen Glaubens.« Für die Auffassung der menschlichen Seelen als Geister der gefallenen Engel und den Mythos der Seelenwanderung s. bes. A. CAZENAVE, Bien et Mal (o. Anm. 65), 366.
74 A. DONDAINE, Les actes du Concile albigeois de Saint-Félix-de Caraman, in: Misc. Giovanni Mercati V (Studi e Testi, 125), Città del Vaticano 1946, 324–355.
75 DONDAINE, Hiérarchie (o. Anm. 72), 293; BORST, Katharer (o. Anm. 53), 238f.; Savino SAVINI, Il catarismo italiano ed i suoi vescovi nei secoli XIII e XIV. Ipotesi sulla cronologia del catarismo in Italia, Firenze 1958; ILARINO DA MILANO, Il dualismo cataro in Umbria al tempo di S. Francesco, in: Atti del IV Congresso di Studi Umbri, Gubbio 1966, 175–216.
76 Über Begegnungen des Franziskus mit »Häretikern« vgl. aber: I Cel 62; II Cel 78f.; III Cel 93 (Anal. Fr. 10,47f. 177f. 304).
77 Zur Geschichte des südfranzösischen Katharertums s. bes. die vier Bände von Élie GRIFFE, Les débuts de l’aventure cathare en Languedoc (1140–1190), Paris 1969; Le Languedoc cathare de 1190 à 1210, Paris 1971; Le Languedoc cathare au temps de la croisade, Paris 1973; Le Languedoc cathare et l’Inquisition (1229–1329), Paris 1980.
78 Leg. Per. 108 (ed. BIGÄRONI, 338–340); vgl. I Cel 74f. (Anal. Fr. 10,55f.); dazu: FELD, Franziskus (o. Anm. 66), 30–33; u. VIII. Kap., bei Anm. 95–98.
79 »Semper enim cum ipse ardore Sancti Spiritus repleretur, ardentia verba foris eructans, gallice loquebatur«: II Cel 13 (Anal. Fr. 10,138f.); vgl. 3 Soc 23f. (ed. DESBONNETS, 108).
80 I Cel 16 (Anal. Fr. 10,15); II Cel 127 (ebd. 205); Leg. Per. 38 (ed. BIGARONI, 84).
81 Henricus Abricensis, Legenda versificata, Appendix I (Anal. Fr. 10,494): ».. quod sibi Francorum sit caelitus indita lingua.«
82 Ernst HOEPFFNER, Les Troubadours dans leur vie et dans leurs œuvres, Paris 1955; Henri DAVENSON, Les Troubadours, Paris 1961; Robert LAFONT, Christian ANATOLE, Nouvelle histoire de la littérature occitane I, Paris 1970, 35–219 (Bibliographie ebd. 122–124); Ulrich MÖLK, Die provenzalische Lyrik, in: Henning KRAUSS (Hrsg.), Europäisches Hochmittelalter (Neues Handbuch der Literaturwissenschaft, Bd. 7), Wiesbaden 1981, 19–36; DERS., Die französische Lyrik, ebd. 37–48.
83 Vgl. LAFONT – ANATOLE, o.c. 42: »Moralement, il [scil. le mouvement cathare] est contradictoire de toute vie mondaine, et c’est la raison pour laquelle il n’y a pas eu pratiquement de troubadours cathares.«
84 »Dans les châteaux, Bons-hommes et poètes avaient le même auditoire de barons de nobles dames. Leurs conceptions ou idéologies respectives – bien que très opposées quant au fond – présentent des ressemblances indéniables ou plutôt, sur quelques points particuliers – en ce qui concerne le problème du mariage, par exemple –, une sorte de convergence«: NELLI, Cathares (o. Anm. 71), 135; vgl. auch: DERS., L’Erotique des Troubadours, Paris 1974.
85 S. hierzu: Aurelio RoNCAGLiA, Le Origini, in: E. CECCHI, N. SAPEGNO (Hrsg.), Storia della Letteratura Italiana I: Le origini e il Duecento, Milano 21987, 1–289; ebd. 221–241 den Abschnitt: »La poesia d’oltralpe in Italia e le prime strofe italiane«; Literatur zur italienischen Troubadour-Dichtung ebd. 288f.
86 Gianfranco POLENA, Cultura e poesia dei Siciliani, ebd. 291–372; die erhaltenen Gedichte in: Poeti del Duecento, ed. Gianfranco CONTINI, 2 Bde., Milano-Napoli 1960, I,43–185; Carl A. WILLEMSEN, Kaiser Friedrich II. und sein Dichterkreis. Staufischsizilische Lyrik in freier Nachdichtung, Wiesbaden 21977; U. MOLK, Die sizilianische Lyrik, in: KRAUSS, Hochmittelalter (o. Anm. 82), 49–60; Eberhard HORST, Friedrich II. der Staufer. Kaiser-Feldherr-Dichter, München 1977, 200–208.
87 »Erat in Marchia Anconitana saecularis quidam, sui oblitus et Dei nescius, qui se totum prostituerat vanitati. Vocabatur nomen eius Rex versuum, eo quod princeps foret lasciva cantantium et inventor saecularium cantionum. Ut paucis dicam, usque adeo gloria mundi extulerat hominem, quod ab imperatore fuerat pomposissime coronatus« (II Cel 106; Anal. Fr. 10,192f.). Daß der erwähnte Kaiser Friedrich II. gewesen sein könnte, scheint fraglich. Möglicherweise war es Otto IV. oder schon Heinrich VI. Über Pacifico s.: Carlo TEDESCHI, San Francesco e Frate Pacifico nelle fonti francescane del Duecento. Anal. TOR 19 (1987), 499–524.
88 Bonaventura, Leg. mai. IV,9 (Anal. Fr. 10,575).
89 Vgl. II Cel 126; Leg. Per. 66 (ed. BIGARONI, 174).
90 André CHASTEL, Die Kunst Italiens, München 1987, 95; Wolfgang BRAUNFELS, Kleine italienische Kunstgeschichte. Achtzig Kapitel, Köln 1984, 146–156.
91 M.-Anselme DIMIER, L’Art cistercien hors de France. Zodiaque, la nuit des temps 34 (1971), 189–208.
92 H. THODE, Franz (o. Einl., Anm. 13), 311.
93 Nicolaus de Carbio, Vita Innocentii IV, cc. 32. 33; ed. F. PAGNOTTI (o. Anm. 4), 110; Adriano PRANDI, Romanisches Umbrien, Würzburg 1981, 271–297.
94 BRAUNFELS, Kunstgeschichte (o. Anm. 90), 110.
95 Die croci dipinte sind zusammengestellt bei Edward B. GARRISON, Italian Romanesque Painting. An Illustrated Index, Florence 1949; vgl. auch: Carlo BERTELLI, Giuliano BRIGANTI, Antonio GIULIANO, Storia dell’arte italiana II, Milano 1986, 379.
96 GARRISON, o.c. 183 (Nr. 459); Leone BRACALONI, Il prodigioso Crocifisso che parlò a S. Francesco. Stud. Franc. 11 (1939), 185–212.
97 III Cel 2 (Anal. Fr. 10,272f.), 3 Soc 14 (éd. DESBONNETS, 100); vgl. ferner: I Cel 115 (Anal. Fr. 10,91); II Cel 10 (ebd. 137); 105 (ebd. 192); 211 (ebd. 252); s. hierüber ausführlich: u. Kap. III, bei Anm. 73–81; vgl. auch das Gebet des Franziskus und Pacificus vor dem Crucifixus von Bovara: II Cel 123 (Anal. Fr. 10,202f.); Leg. Per. 65 (ed. BIGARONI, 170).