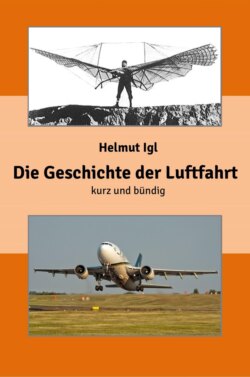Читать книгу Die Geschichte der Luftfahrt – kurz und bündig - Helmut Igl - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie Geschichte der Luftfahrt
kurz und bündig
Der Traum vom Fliegen beschäftigte die Menschen schon von alters her und seit ewigen Zeiten wird der faszinierende Flug der Vögel neidvoll bestaunt. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass bereits im klassischen Altertum mensch- oder tierähnliche Geschöpfe mit Flügeln behaftet dargestellt wurden.
In der griechischen Mythologie findet sich sogar der sagenumwobene Hinweis auf Dädalus (Daidalos), einem ideenreichen Erfinder, der zusammen mit seinem Sohn Ikarus auf der Insel Kreta in einem Turm eingesperrt worden war. Um der Gefangenschaft zu entkommen, fertigte Dädalus für sich und seinen Jungen aus dem Federkleid von Vögeln zwei Flügelpaare, die er mit Kerzenwachs bestrich und mit denen die beiden das halsbrecherische Risiko eingingen, von hoch oben aus dem Turmgefängnis in die Tiefe zu springen. Nachdem sie es mit ihren Fluggeräten auf wundersame Weise geschafft hatten, sogar über mehrere Inseln hinwegzufliegen, wurde Ikarus offensichtlich von der Fluglust gepackt. Die Warnungen seines Vaters missachtend stieg er immer höher in den Himmel auf, bis er irgendwann der Sonne zu nahe kam. Bedingt durch die Sonnenglut schmolz das Wachs, die Federn der Flügel fielen ab - und Ikarus stürzte ins Meer.
In ähnlicher Weise erging es anfangs so manchen Flugpionieren, die, vom Vogelflug animiert, oft mit Flügeln ausgerüstet von Gebäuden und Anhöhen in den Tod sprangen. Im Laufe der Jahrhunderte sollte es jedoch der menschliche Erfindungsgeist zustande bringen, durch Versuch und Irrtum gepaart mit Kreativität neue Erkenntnisse zu gewinnen und damit verlässlichere Flugtechniken zu erforschen.
Die ersten dokumentierten, vom Menschen geschaffenen Flugapparate in Form unterschiedlicher Drachen stammen aus China (5. Jh. v. Chr.) und auch Marco Polo schrieb schon 1282 in seinen Berichten, dass er dort bemannte Drachenaufstiege beobachtet hatte.
Mit diversen Fluggeräten setzte sich Ende des 15. Jhs. auch Leonardo da Vinci auseinander, indem er den Aufbau von Tierflügeln sehr genau aufzeichnete und außerdem verschiedene Flugobjekte wie z. B. eine Flugspirale oder Schwingenflugzeuge entwarf. Aus heutiger Sicht wäre allerdings keines dieser Modelle, hätte man sie gebaut, flugtauglich gewesen.
Erst im 18. Jh. sollte es möglich werden, den Menschheitstraum vom Fliegen in die Tat umzusetzen. Es begann mit zwei Brüdern, die es zuwege brachten, vor den Augen tausender Schaulustiger erstmals den Luftraum zu erobern:
Die Ballonfahrt
Joseph und Jacques Montgolfier waren die Söhne eines französischen Papierfabrikanten, die sich schon in frühen Jahren für das Fliegen interessierten. Als Joseph in einem Bericht von einem Gas erfuhr, das der Brite Henry Cavendish 1766 entdeckt hatte und das 14-mal leichter als Luft sein sollte (Wasserstoff), füllte er Papierkugeln mit diesem Gas und ließ sie versuchsweise emporsteigen. Doch aufgrund der undichten Hülle sanken diese schnell wieder zu Boden. Danach beschäftigte sich Joseph mit einem anderen Phänomen. Er hatte nämlich eines Tages ein am Kamin zum Trocknen aufgehängtes Hemd beobachtet, das sich durch die heiße, verrauchte Luft des Feuers aufblähte. Angesichts der Tatsache, dass Rauchschwaden nach oben steigen schloss er daraus, dass Rauch, in einem leichten Behälter verpackt, diesen nach oben ziehen müsste. Folglich probierten er und sein Bruder eine Reihe von mit qualmendem Rauch gefüllten Papierhüllen aus, die bald in immer größere Höhen aufstiegen. 1783 führten sie einer breiteren Öffentlichkeit vor, wie ein durch Schafwolle und Stroh erzeugtes und stark rauchendes Feuer einen riesigen Ballon über einen Kilometer in die Höhe steigen und zwei Kilometer weit treiben ließ.
Die Nachricht von diesem spektakulären Ereignis wurde auch an der Akademie der Wissenschaften in Paris wahrgenommen. Dort wurde der Physiker Jacques Charles damit beauftragt, diesen ungewöhnlichen Versuch zu wiederholen und seine Durchführbarkeit zu bestätigen. Doch durch einen gerade erschienenen Zeitungsartikel wurde Charles in die Irre geführt. Dort stand zu lesen, dass es den Montgolfiers gelungen sei, ein Gas herzustellen, das leichter als Luft ist und somit Ballone flugfähig mache. Da Wasserstoff aber das derzeit einzig bekannte Gas mit dieser Eigenschaft war, experimentierte Charles nur noch mit diesem und entwickelte auf diese Weise eine völlig andere Ballonart: den Wasserstoffballon.
Mit Hilfe eines neuen Verfahrens zur Herstellung gummibeschichteter Seide für die Ballonhülle bekam er bald auch das Problem mit der Undichtigkeit in den Griff. Noch im selben Jahr ließ Charles einen vier Meter großen wasserstoffgefüllten Ballon steigen, der wegen seines hohen Auftriebs schnell aus dem Blickfeld der Zuschauer verschwand und nach 45 Minuten und 25 Kilometern zurückgelegter Strecke wieder außerhalb von Paris landete.
Auf diese Weise waren beinahe zeitgleich zwei verschiedene Ballonarten erfunden worden, die heute nach ihren Erfindern benannt werden: die mit heißer Luft betriebene Mongolfière und der mit Gas gefüllte Ballon, die Charlière.
Bis zu diesem Zeitpunkt war aber noch kein Mensch in einem Ballon gefahren. Als König Ludwig XVI. die Brüder Montgolfier in den Schlossgarten von Versailles berief, um sich deren Erfindung vorführen zu lassen, traf sich dort halb Paris, um dieses außergewöhnliche Schauspiel miterleben zu können. Nachdem man aber eine menschliche Besatzung als zu gefährlich erachtete, überließ man zunächst Tieren das vermeintliche Risiko - einem Hahn, einer Ente und einem Hammel, die dann gemeinsam die erste, 8 Minuten dauernde Fahrt in die Tat umsetzten.
Start einer Montgolfière, 1783 (1)
Nach diesem durchschlagenden Erfolg nahmen die Montgolfiers jetzt auch einen größeren Ballon zur Beförderung von Menschen in Angriff. Der König bestand jedoch darauf, dass als Passagiere nur zum Tode verurteilte Gefangene in Frage kämen. Aber letztendlich konnte man ihn doch davon überzeugen, dass keinesfalls Strafgefangene diesen Ruhm ernten dürften. Im November 1783 stiegen schließlich unter dem Anblick tausender Neugieriger ein Adeliger und ein Offizier in den ringförmigen Korb der Mongolfière. Aus einem riesigen, ofenartigen Gemäuer entstieg heißer, qualmender Rauch und befeuerte so lange den 22 m hohen, blau-goldenen Ballon, bis dieser erhaben in die Lüfte abhob. Nach 25 Minuten und acht Kilometer Fahrt kamen die beiden Draufgänger dann unter den Augen einer staunenden Bevölkerung wieder sanft auf die Erde zurück.
Aufstieg der Charlière, 1783
Library of Congress (2)
Nur 10 Tage später hatte es auch Professor Charles geschafft. Unter dem Jubel von 300.000 Menschen entschwebten vor dem Pariser Tuilerienpalast er und ein Kollege in ihrem Gasballon lautlos in die Luft. Die Produktion des benötigten Wasserstoffgases aus Eisenspänen und Schwefelsäure hatte zuvor fast drei Tage gedauert. Nach einer 2 ½-stündigen Ballonfahrt kamen sie, nachdem sie in einer Höhe von rund 450 Metern eine Strecke von 36 km zurückgelegt hatten, wieder glücklich und unversehrt am Boden an. Im Anschluss daran stieg Charles noch einmal ohne Begleitung auf.
Im Folgejahr führten die Brüder Montgolfier noch einen weiteren, größeren Versuch durch. Unter den jetzt sieben Passagieren befand sich nun auch Joseph, der damit seinen ersten und einzigen Aufstieg unternahm. Danach verloren die Montgolfiers ihre Motivation an der Ballonfahrerei, denn damaliges Ballonmaterial hatte so seine Tücken. So bestand das Hüllenmaterial der Montgolfieren aus leinenverstärktem Papier und war extrem feuergefährdet. Und da man in dieser Zeit noch den Auftrieb mit Hilfe eines qualmenden Strohfeuers erzeugte, ist so mancher Ballon ein spektakuläres Opfer der Flammen geworden.
Auch andere begeisterte Himmelsstürmer beschäftigten sich damals mit solcherlei Ballonen, doch mit der Zeit ließ auch deren Interesse immer weiter nach.
Erst nach 150 Jahren besannen sich Wissenschaftler wieder auf die Ballonfahrt, als sie damit begannen, mit Gasballonen den Luftraum zu ergründen. 1931 schaffte der schweizer Physiker Auguste Piccard in einem Gasballon zur Messung der kosmischen Höhenstrahlung den ersten Höhenrekord von annähernd 16 Kilometer, den er später noch auf 23 Kilometer steigern konnte.
Augustes Enkel Bertrand Piccard gelang 1999 in Begleitung des Engländers Brian Jones mit seinem ‚Breitling Orbiter 3‘ die erste Erdumrundung in einer Art Zwitterballon, einem mit Heliumgas gefüllten und zusätzlich mit Heißluft betriebenen Ballon. Sie waren 20 Tage lang in den Jetstreams, den in der oberen Troposphäre vorkommenden Starkwinden von bis zu 650 km/h, unterwegs und legten dabei eine Strecke von 45.000 Kilometer zurück.
Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner erreichte 2012 in einem Heliumballon die Weltrekordhöhe von 38.969,4 m – bis er absprang und mit Überschallgeschwindigkeit im freien Fall der Erde entgegenraste.
Auch in der Klimaforschung und zum Erfassen von Wetterdaten schweben heute jeden Tag hunderte von Gasballonen rund um den Globus in die Stratosphäre.