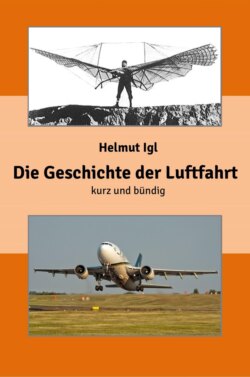Читать книгу Die Geschichte der Luftfahrt – kurz und bündig - Helmut Igl - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Luftschiff
ОглавлениеDas größte Problem der Ballone, deren fehlende direkte Lenkbarkeit und geringe Eigengeschwindigkeit, konnte erst ab 1883 mit der Erfindung des relativ leichten Verbrennungsmotors Gottlieb Daimlers gelöst werden. Aufgrund seines günstigeren Verhältnisses zwischen Leistung und Gewicht im Gegensatz zu den schweren Dampfmaschinen und frühen Ottomotoren eignete er sich nun zunehmend auch für Luftfahrzeuge.
Seit 1850 gab es zwar schon erste experimentelle Luftschiffe, die mehr oder weniger schon die heute bekannte typische Form aufwiesen, konnten aber wegen ihrer schlechten Manövrierbarkeit letztlich doch nur für Luftaufnahmen oder zu Beobachtungszwecken eingesetzt werden. Diese nicht starren Luftschiffe werden Prallluftschiffe oder Blimps genannt. Ihre mit Wasserstoff gefüllte Hülle bestand aus Stoff und wurde anfänglich mit einem Netz überzogen, an dem die Gondel befestigt war.
Giffards Dampf-Luftschiff, 1852 (5)
Dem Franzosen Henri Giffard gelang es als Erstem, Auftrieb und Vortrieb zu kombinieren. Er konstruierte 1852 einen zigarrenförmigen Ballon, der durch den Gasdruck im Innern geformt und von einer 45 kg schweren und 3 PS leistenden Dampfmaschine angetrieben wurde. Die anschließende fast 30 Kilometer lange Fahrt mit einer Geschwindigkeit von 8 km/h wird als der erste bemannte motorisierte Flug der Geschichte angesehen.
Nachdem er bei einem weiteren Versuch verunglückte, bei dem das Luftschiff explodierte und er nur knapp den Flammen entkommen war, nahm allerdings danach das Interesse am Bau von Luftschiffen spürbar ab.
Das erste Starrluftschiff war ein von dem gebürtigen Ungarn David Schwarz entwickeltes Ganzmetall-Luftschiff. Es bestand aus einem Gitterträgergerüst, war mit einem gerade auf den Markt gekommenen Aluminiumblech beplankt und wurde von einem 12 PS-Benzinmotor angetrieben.
David Schwarz' Luftschiff, 1897
Hans-Peter Papke (6)
Die äußere Form bestand aus einem Zylinder mit kegelförmigem Bug. Das Luftschiff wurde jedoch bei seiner Probefahrt 1897 auf dem Tempelhofer Feld in Berlin zerstört. Unter den Beobachtern des Geschehens befand sich auch ein gewisser Graf Zeppelin, der die Idee von Schwarz übernahm und mit seinen späteren Luftschiffen Weltruhm erlangen sollte.
Alberto Santos Dumont war ein in Frankreich lebender brasilianischer Luftschiff- und Motorflugpionier, der insgesamt elf Luftschiffe baute. Um den mit 100.000 Franc dotierten Deutsch-Preis (gestiftet von dem französischen Öl-Industriellen Henri Deutsch) zu gewinnen, unternahm er 1901 drei Anläufe. Die ersten beiden missglückten, wobei beim zweiten Versuch sein Luftschiff Nr. 5 das Dach eines Hotels streifte und dabei explodierte. Dumont hing mit seinem Korb an der Außenwand des Gebäudes fest und konnte gerade noch rechtzeitig von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit werden.
Santos Dumonts Luftschiff N° 6, 1901 (7)
Erst beim dritten Anlauf schaffte er es, mit seiner ‚Santos Dumont Nr. 6‘ und einem 12 PS-Motor die Bedingung für das Preisgeld zu erfüllen, innerhalb von 30 Minuten die fast 6 Kilometer lange Strecke vom Pariser Vorort Saint-Cloud um den Eiffelturm herumzufahren und wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren.
Santos-Dumont befasste sich danach auch mit motorgetriebenen Flugzeugen, die er so weit entwickelte, dass ihm 1906 mit einem selbststartenden Experimentalflugzeug ein offiziell anerkannter Motorflug von über 25 m gelang und der ihm 3.500 Franc Preisgeld einbrachte. Zu seinen Ehren wurde einer der beiden Flughäfen Rios nach ihm ‚Rio de Janeiro Aeroporto Santos Dumont‘ benannt.
Der bedeutendste Luftschiff-Pionier war jedoch der in Konstanz am Bodensee geborene Ferdinand Graf von Zeppelin. Als deutscher Berufsoffizier wurde er mit 25 Jahren als Militärbeobachter im amerikanischen Bürgerkrieg eingesetzt, in dem die Kriegsgegner auch Ballone zum Ausspähen feindlicher Stellungen verwendeten. Als er sogar selbst an einer Ballonfahrt teilnehmen durfte, war er von diesem Erlebnis so fasziniert, dass er sich nach seinem frühzeitigen Ausscheiden aus dem aktiven Dienst als 52-jähriger Generalleutnant nur noch mit der Verbesserung der Ballontechnik beschäftigte. Zeppelin beobachtete intensiv die Luftfahrtszene und erwarb von der Witwe des Luftschiffkonstrukteurs David Schwarz dessen Entwürfe und Patente. 1895 ließ er sich sein eigenes Konzept für ein ‚Lenkbares Luftfahrzeug mit mehreren hintereinander angeordneten Tragkörpern‘ patentieren. Danach begann er mit der Realisierung des ersten, über drei Achsen lenkbaren Starrluftschiffs. Die wichtigsten Merkmale seiner Konstruktion waren das starre Gerippe aus Aluminium, das aus Ringen und Längsträgern aufgebaut war, sowie die gesonderten Gaszellen für das Füllgas im Innern des Gefährts. An dem mit Stoff überspannten Gerüst waren unterhalb die beiden separaten Gondeln für Passagiere und Besatzung befestigt. Da eine staatliche Finanzierung seines Unternehmens abgelehnt wurde, gründete er nach einem Spendenaufruf die ‚Gesellschaft zur Förderung der Luftschifffahrt‘, für die er selbst mehr als die Hälfte des Aktienkapitals in Höhe von umgerechnet ca. 5 Mio. Euro aufbrachte. Der Prototyp wurde in einer auf Pontons schwimmenden Halle, die für den schwierigen Startvorgang in den Wind gedreht werden konnte, in der Manzeller Bucht bei Friedrichshafen gebaut.
LZ1 bei seiner Jungfernfahrt, 1900 (8)
Schließlich stieg im Juli 1900 über dem Bodensee das erste, nach ihm benannte Starrluftschiff LZ 1 (= Luftschiff Zeppelin 1) auf. Es hatte eine Länge von 128 m, einen Durchmesser von 11 m und verfügte über zwei Daimler-Motoren mit jeweils 15 PS. Tausende von Zuschauern beobachteten vom Ufer aus, wie das Monstrum über dem Wasser schwebend einige Kehren drehte und nach 18 Minuten notwassern musste.
Die nachfolgenden Zeppelinreihen wurden hauptsächlich für Passagierfahrten im Kurzstreckenbetrieb eingesetzt.
Den ersten großen Erfolg erlebte Graf Zeppelin jedoch erst 1908 mit seinem 4. Luftschiff LZ 4, das bereits über einen Aufenthaltsraum verfügte und in einer 12-stündigen Fahrt knapp 400 Kilometer zurücklegte. Als der LZ 4 noch im selben Jahr verunglückte, hätte dieser Unfall vermutlich das wirtschaftliche Aus für seine Luftschiffe bedeutet. Doch eine Spendenaktion löste eine beispiellose Welle der Hilfsbereitschaft im ganzen Land aus. Mit dieser nationalen ‚Zeppelinspende‘ in Höhe von umgerechnet 35 Mio. Euro war es dem Grafen nun möglich, die ‚Luftschiffbau Zeppelin GmbH‘ und eine Zeppelin-Stiftung zu gründen. Ein Jahr später wurde mit staatlicher Unterstützung die ‚Deutsche Luftschifffahrt-AG‘ ins Leben gerufen, die erste Fluglinie der Welt unter der Leitung von Hugo Eckener. In der Reihe der Zeppeline beförderte danach der LZ 7 bis 1914 auf mehr als 1.500 unfallfreien Fahrten insgesamt fast 35.000 Passagiere.
Im Ersten Weltkrieg wurden die Starrluftschiffe anfangs noch in großem Stil zur Aufklärung und für Luftangriffe mit Bombenabwurf verwendet. Doch im Laufe des Krieges ging die flugtechnische Entwicklung über sie hinweg, da die inzwischen zuverlässiger gewordenen Flächenflugzeuge immer mehr die Rolle der Luftschiffe übernahmen.
Als nach dem Ende des Ersten Weltkrieges auch das Ende des deutschen Luftschiffbaus gekommen zu sein schien, gelang es Graf Zeppelins Nachfolger Hugo Eckener, das Interesse der USA für das Luftschiff zu wecken. Es kam ein Vertrag zustande, der aber erst nach erfolgreicher Überführung des LZ 126 über den Atlantik als erfüllt betrachtet wurde. 1924 startete Kommandant Eckener von Friedrichshafen aus zur Atlantiküberquerung und landete ohne Zwischenfall nach drei Tagen in Lakehurst, 100 km südwestlich von New York City. Dies war nach dem britischen Starrluftschiff R34 fünf Jahre zuvor der zweite Nonstopflug über den Atlantik.
Ihre Blütezeit erlebten die Luftschiffe in den 1930er Jahren, als LZ 127 Graf Zeppelin und LZ 129 Hindenburg zur regelmäßigen Passagierbeförderung in die USA und nach Rio de Janeiro eingesetzt wurden.
Der 1928 in Dienst gestellte LZ 127 Graf Zeppelin gilt als erfolgreichstes Verkehrsluftschiff der Geschichte. Bei einer Reichweite von 12.000 km kam er auf eine Höchstgeschwindigkeit von 128 km/h und war damit dreimal schneller als ein Ozeandampfer. Zusätzlich zur 50-köpfigen Besatzung konnte der LZ 127 maximal 25 Fluggäste mitnehmen. Als Neuerung wurde zum Schutz gegen die Sonneneinwirkung die Hülle des Luftschiffs mit einem Aluminiumpulver-Anstrich versehen, der ihm seine typisch silberne Farbe gab. 1929 begab sich der Graf Zeppelin auf eine Weltreise, die über Sibirien, Tokio, Los Angeles, Lakehurst und zurück nach Friedrichshafen führte. Wo immer die Riesenzigarre auftauchte, wurde sie zur Sensation und überall frenetisch bejubelt. Insgesamt legte das Schiff fast 1,7 Mio. km bei 590 unfallfreien Fahrten zurück, wobei es etwa 140-mal den Atlantik nach Nord- und Südamerika überquerte.
Postkarte des Luftschiffs Hindenburg, 1936 (9)
Der Nachfolger der Graf Zeppelin, der LZ 129 Hindenburg und sein Schwesterschiff, der LZ 130 Graf Zeppelin II, waren mit einer Länge von 245 m, einem Durchmesser von 41 m sowie einem Leergewicht von 120 Tonnen und ebenso hoher Zuladung die größten Luftschiffe aller Zeiten. Angetrieben wurden sie von vier Dieselmotoren mit je 800 PS, die eine Geschwindigkeit von bis zu 130 km/h möglich machten.
Der Salon der Hindenburg (10)
Die Hindenburg war allerdings nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt, sondern auf Komfort. Neben Schlafkabinen, einem separaten Rauchsalon und fließend warmem Wasser verfügte sie auch über einen Speisesaal, in dem Menüs à la carte serviert wurden. Das Luftschiff reiste meist in einer Höhe von 200 m und benötigte für eine Atlantiküberquerung knapp 43 Stunden. Ein Flugticket nach Amerika für die Hin- und Rückfahrt kostete damals umgerechnet rund 10.000 Euro.
Eigentlich sollte die Hindenburg schon mit dem nicht brennbaren Edelgas Helium befüllt werden, doch über dieses Gas verfügten nur die Amerikaner, und die zogen ihre Lieferzusage zurück, nachdem die Nazis die Zeppeline zu Propagandazwecken missbrauchten und auf Kriegskurs gegangen waren.
Seit seiner Inbetriebnahme 1936 hatte der LZ 129 Hindenburg während seiner 63 Fahrten 37-mal den Atlantik überquert. Als er im Mai 1937 bei seiner letzten Fahrt über den Ozean in der Marine-Luftschiffbasis Lakehurst ankam, ereignete sich eine Katastrophe, die die Welt erschüttern sollte: Kurz vor der Landung tauchte plötzlich auf der Außenhülle im Heckbereich eine Stichflamme auf, die in kürzester Zeit den Wasserstoff im Innern des Luftschiffs in ein flammendes Inferno verwandelte. Binnen weniger Minuten blieben von dem einst so stolzen Schiff nur noch Schrott und Asche übrig. Von den 97 an Bord befindlichen Personen kamen bei der Katastrophe 35 ums Leben, die anderen wurden wie durch ein Wunder gerettet. In aller Welt zeigte man danach den Dokumentationsfilm über die letzten 34 Sekunden bis zum Aufprall des Giganten auf dem Boden.
Hindenburg Zeppelin-Katastrophe, 1937 (11)
Mit diesem Absturz endete ein Jahr vor dem 100sten Geburtstag ihres Erfinders auf tragische Weise die fast vierzigjährige Ära dieser majestätischen Luftschiffe und bedeutete für die zivile Luftschifffahrt das sofortige Aus.
Über die eigentliche Ursache des Unglücks wird bis heute viel spekuliert. Womöglich hatte sich das Luftschiff zuvor mit statischer Elektrizität aufgeladen, als es unplanmäßig lange an einer Gewitterfront entlang gefahren war. Als die Festhaltekabel zum Anlegen nach unten geworfen wurden und den Boden berührten, gab es vermutlich eine Funkenentladung, die das Gas entzündet haben könnte. Der verantwortliche Kapitän blieb allerdings bis an sein Lebensende davon überzeugt, dass weder technisches Versagen noch ein unglücklicher Zufall sein Luftschiff zerstört habe, sondern ein Sabotageakt. Auch eine Untersuchungskommission aus deutschen und amerikanischen Fachleuten kam zu keinem eindeutigen Ergebnis und schlussfolgerte, dass die Tragödie ein Fall höherer Gewalt gewesen sei.
Die Zeppelin-Luftschiffe nahmen in der Luftfahrt eine so dominante Rolle ein, dass sie zum Mythos geworden sind und der Begriff ‚Zeppelin‘ deshalb auch heute noch als Synonym für ‚Luftschiff‘ gebraucht wird.
In Deutschland konnten sich die nun mit unbrennbarem Helium gefüllten Blimps (nichtstarre Luftschiffe) eine Nische bewahren und schweben seit 1956 zu Werbezwecken und für Sightseeing-Touren über das Land.
Halbstarre Luftschiffe bzw. Kiel-Luftschiffe sind ihrer Bauart nach eine Zwitterform zwischen einem starren Luftschiff und einem Blimp und haben lediglich ein Teilskelett. Dieses besteht oft nur aus einem festen Kiel entlang der Längsachse, an dem die Gondel sowie die Motoren angehängt werden. Die Form der Hülle wird wie bei Prallluftschiffen durch den Gasüberdruck innerhalb der Hülle erzeugt.
Zeppelin NT
Tronedit, CC-BY-SA 3.0 (12)
Der Erstflug des halbstarren Luftschifftyps Zeppelin NT (Zeppelin Neuer Technologie) erfolgte 1997. Mit diesem modernen Vielzweck-Airship peilt die ‚Zeppelin Luftschifftechnik GmbH‘ neue Märkte an, die weder vom Helikopter noch vom Flugzeug abgedeckt werden können. Vorerst wird er aber nur zu Tourismuszwecken sowie für Forschungs- und Überwachungsaufgaben eingesetzt. In der Regel startet ein Zeppelin NT mit etwa 350 kg Übergewicht, wobei der fehlende Auftrieb durch 3 Antriebsmotoren erzeugt wird, die geschwenkt werden können und so den Antriebsschub in horizontaler und vertikaler Richtung ermöglichen.