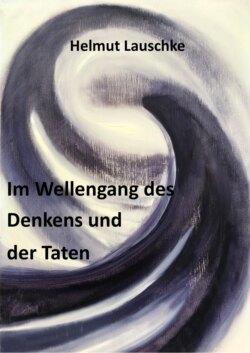Читать книгу Im Wellengang des Denkens und der Taten - Helmut Lauschke - Страница 3
Grundsätzliches zur Philosophie und Religion
ОглавлениеIm Wellengang des Denkens und der Taten
Die gebildete Mittelschicht, die sich überwiegend aus Lehrern, Beamten und Angestellten der Banken und Verwaltung zusammensetzte, war groß. Aus dieser Schicht ragten Menschen mit hoher Bildung heraus, die zu den Gottesdiensten und Bibelstunden kamen, sich mit den Texten und Predigten auseinandersetzten und oft mit klugen und kritischen Fragen reagierten. So fragte ein Studienrat, der Deutsch und Philosophie in der Oberstufe unterrichtete, ob es nicht sinnvoller wäre, anstatt im Ungewissen des Glaubens und der Religion herumzufischen, eine strenge Denkschule nach platonischem Vorbild einzurichten, um zu den Tugenden der Ethik und Moral zurückzukehren. Denn es habe sich doch gezeigt, dass es die christlichen Kirchen in zweitausend Jahren mit dem Frieden auf Erden nicht schafften und er bei logischer Denkweise euklidisch linear daraus folgern könne, dass die Kirchen den Frieden in den nächsten zweitausend Jahren, wenn es noch eine Menschheit geben sollte, auch nicht schaffen werden. Der Studienrat, ein hagerer Mann in den besten Jahren, dem die geistige Höhe nicht streitig zu machen und dazu ein regelmäßiger Besucher der sonntäglichen Gottesdienste war, wollte den Einwand mit dem Liebesangebot aus dem Wirken des großen Menschensohnes so einfach nicht gelten lassen. "Das mag schon sein", sagte er, "aber wenn die Menschen das Angebot nicht verstehen oder sogar ablehnen, dann ist das Wirken Jesu Christi für den Frieden auf Erden nur von symbolischer Bedeutung, wenn es überhaupt noch eine Bedeutung für die Menschen dieser Zeit hat."
Eckhard Hieronymus hielt ihm die Paulusworte aus dem 1. Brief an die Korinther (10. Kapitel) entgegen: "Alles ist (im Denken) erlaubt, aber es frommt nicht alles. Alles ist erlaubt, aber es erbaut nicht alles (im Herzen). Denn die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, und forscht nicht nach, auf dass ihr das Gewissen nicht beschwert. Ich rede vom Gewissen, nicht deinem eigenen, sondern von dem des andern. Denn warum sollte ich von eines anderen Gewissen über meine Freiheit urteilen lassen?"
Der Studienrat stutzte für einen Moment; dann sagte er, dass er glaube, diese Worte zu verstehen, wenn sie auch logisch nicht nachvollziehbar seien. "Schauen Sie nur in das Durcheinander unserer Zeit", sagte er emphatisch, "dann müssen Sie doch feststellen, dass diese Worte entweder nicht verstanden, zumindest nicht befolgt oder als bedeutungslos für das Leben in der Gesellschaft ignoriert werden." “Der Mensch ist in seiner Natur sowohl für das Gute wie für das Böse offen”, erwiderte ihm Eckhard Hieronymus, “er hat sich für das eine oder das andere zu entscheiden, und die Entscheidung entspricht seinem Wesen. Deshalb glaube ich nicht, dass der Mensch die Botschaft, die ich zu bringen bemüht bin, nicht versteht. Es hängt einzig und allein von seinem Willen ab, in welcher Richtung er den Weg durchs Leben gehen will und geht. Auch wenn die großen Bösewichter oft als Unmenschen gescholten werden, so ist es die Natur des Menschen, aus der auch ein großer Heiliger kommen kann. Der Mensch lässt sich in die eine oder andere Richtung mitreißen, ja entfesseln.” Darauf zitierte der Studienrat aus dem Gedankengut des Konfuzius: “Der Mensch hasst die, welche selbst niedrig sind und Leute, die über ihm stehen, verleumden; er hasst die Mutigen, die keine Sitten kennen; er hasst die waghalsigen Fanatiker, die beschränkt sind.” Dem fügte Eckhard Hieronymus den anderen Satz hinzu: “Der Edle bleibt im Umgang mit jedermann besonnen; er mag sich anlügen lassen, doch übertöpeln lässt er sich nicht.” Sie trennten sich und drückten den Wunsch nach einem weiteren Gespräch aus. Zum Abschied brachte der Studienrat den berühmten Satz des Konfuzius: “Was einen Ort schön macht, ist die dort waltende Humanität. Wer, wenn er wählen kann, nicht unter Humanen sich niederlässt, ist nicht weise.” Dem fügte Eckhard Hierornymus den Paulus-Satz hinzu: “Wandelt würdig im Evangelium Jesu Christi, auf dass ihr in einem Geist zusammensteht und einmütig für den Glauben des Evangeliums zusammen kämpft.” (Brief an die Philipper, 1. Kap.)
Der Zeitgeist hatte sich gewandelt. Die seelische Verfassung war bei vielen Menschen gestört. Das bekam Eckhard Hieronymus zu spüren, wenn er Religion in der Mittelstufe, vor allem in der Untersekunda, am Wilhelm-Gymnasium unterrichtete. So gab es Schüler, die den Unterricht durch Unaufmerksamkeit oder Dazwischenreden störten. Das Absinken der Disziplin hatte er in diesem Ausmaß am vom Stein’schen Gymnasium in Burgstadt nicht erlebt. Es bekümmerte ihn erheblich. Eckhard Hieronymus sah die Ursache des mangelnden Interesses an der Religion als Teil des gesellschaftlichen Zerfalls, die durch die jüngsten Ereignisse beschleunigt wurden. Die posttraumatische Erschütterung hatte die Menschen verunsichert, ihnen den Glauben an die Gerechtigkeit genommen, sie in Gewissensnöte und Verzweiflung gestürzt. Gab es einen Ausweg? Mit den zehn Geboten konnte er den Schülern auf direktem Wege nicht kommen, noch weniger mit den Lutherschen Erklärungen in seinem Katechismus. Anfangs hatte er es versucht und das Lächeln der Unglaubwürdigkeit geerntet. Zwei Schüler hatten sich darin abgewechselt und erklärt, dass er damit nicht kommen soll, hätte doch die Geschichte die Gültigkeit der zehn Gebote außer Kraft gesetzt, sie als bedeutungslos ignoriert.
Die Tatsachen sprächen eine andere Sprache, nämlich die der Macht, der Gewalt und des Stärkeren. So waren die Herausforderungen für Eckhard Hieronymus stark angestiegen. Er verbrachte schlaflose Nächte damit, wie er das Interesse der Schüler zum christlichen Glauben wiederfinden, dieses Interesse wieder wecken könne, weil es die Basis jeder Kommunikation ist. Auch waren es die kritischen Fragen, aus denen zu erkennen war, dass das Hirn dem Herzen, weiter als jemals zuvor, vorgeschoben wurde, dem Rede und Antwort zu stehen war. Der Herzensläuterung hatte die intellektuelle Läuterung vorauszugehen. Fakten aus der Geschichte der Menschheit mussten stärker als zuvor beleuchtet, ins Licht des Zeitgeistes gesetzt und neu interpretiert werden. Es mussten die Tatsachen für den kritischen Verstand einfach und anschaulich vorgetragen, Dinge mit und um den Menschen klargestellt und neu begriffen werden. Wie konnte Eckhard Hieronymus das Interesse der Schüler für das Fach Religion wiederfinden und beleben?
Er fasste es als Lehrexperiment auf, das ihm vom Zeitgeist auferlegt, ja aufgedrückt wurde, indem er den Unterricht mit einem geschichtsphilosophischen Vorspann begann. Er griff auf die Väter der abendländischen Philosophie zurück, besonders auf den Altvater Sokrates, erzählte aus ihren Leben, den Begegnungen mit Menschen, und was sie mit dem Denken und ihren Gesprächen erzielen wollten. Mit diesem Vorspann konnte er doch das Interesse der Schüler wecken, was allmählich zur Unterrichtsdisziplin führte. Sie lauschten aufmerksam, wenn er von Sokrates erzählte, dass er von niedriger Herkunft war. Sein Vater war Steinmetz, seine Mutter Hebamme. Sokrates war zeitlebens arm geblieben, hatte seine Schüler nie nach einer Bezahlung gefragt. Im Peloponnesischen Krieg kämpfte er als Hoplit (Fußsoldat) bei Delion und Amphipolis. Politisch hatte er 406 (v.Chr.) den Ratsvorsitz inne und stritt für das Recht und gegen die Hinrichtung der Feldherren der verlorenen Arginusenschlacht, die von der wütenden Masse gefordert wurde. Niemals suchte Sokrates eine herausragende Position im Staat. Die Schüler lachten herzhaft, als er ihnen von seiner äußeren Erscheinung, dem gedrungenen Körper mit den vorquellenden Augen, der Stülpnase, den dicken Lippen und dem dicken Bauch berichtete.
Das Anliegen, das Sokrates zeitlebens verfolgte, war das Denken. Er ermunterte die Mitmenschen zum Denken von Grund auf, zum Ablegen des unüberlegten Vorurteils, weil nur so der Wahrheit der Dinge und ihren Ursachen nähergekommen werden kann. Das Denken ist endlos, weil es immer neue Fragen aufwirft, die zu beantworten sind. So ist es das Denken, durch das der Mensch sein Nichtwissen begreift. Hat er im Denken die Willensstärke, mehr wissen zu wollen, dann ist es die Kraft des Durchhaltens, durch die er zum Mehrwissen kommt, das zu Lebzeiten nie einen vollständigen Abschluss findet. Es ist Sokrates, der sagt, dass am Ende allen Denkens noch ein großer Raum zum Weiterdenken bleibt, der immer weiter wird, je weiter wir denken. Die Weite des denkerisch unerforschten Raumes lässt dann auch genügend Platz für den Glauben. Die Schüler hörten es, und sie waren still, als Eckhard Hieronymus ihnen sagte, dass es das Denken war, in dem Sokrates die Notwendigkeit erkannte, den Glauben an die griechischen Götter zu pflegen.
Sokrates war ein frei denkender, für alle Fragen offener Philosoph. Auf der Höhe des klaren, des wunderbar aufgeklärten Verstandes war Sokrates in der Tiefe seines Herzens ein gläubiger Mensch. Den unerschütterten, unerschütterlichen Glauben machte er zu seiner Verteidigung in dem ihm gemachten Prozess geltend. Dieser Prozess war im philosophischen Sinne ein Wahrheitsprozess von europäisch-abendländischem Ausmaß, weil er die Maßstäbe und Ecksteine des Denkens weit in die kommenden Jahrhunderte hinein setzte. Sokrates stellte sich mutig dem Prozess, machte keine Abstriche an der von ihm erkannten Wahrheit und keinerlei Zugeständnisse, um die Wahrheit zu beugen. Er blieb fest in seinem Denken, zog die Götter nicht von den olympischen Höhen in die Niederungen menschlicher Querelen und Niedertracht herab. Es war die Wahrheit, für die er sein Leben aufs Spiel setzte, bereit war, für sie zu sterben. Für ihn war die Wahrheit nicht antastbar. Er wollte mit ihr sterben, sie in die Götterwelt mitnehmen.
Der Vorwurf, dass er Atheist sei, stand ganz zentral in diesem Wahrheitsprozess. Sokrates wies ihn mit scharfer Zunge zurück. Hier führte er das Argument der Armut an, die ihn durch das Leben begleitete. 399 (v.Chr.) trank er gegen die Rettungsversuche seiner Schüler und Freunde den Schierlingsbecher und starb für die Wahrheit in der korrupten Athener Gesellschaft, in der Macht und Reichtum mehr zählten als die Tugend der Wahrheit. Sokrates ließ sich nicht beirren; er gab den Göttern und der Wahrheit die größere Ehre.
Der philosophische Vorspann genügte. Es gab keine vorlauten Bemerkungen. Die Disziplin war hergestellt, die Grundlage gelegt, um den Raum des Glaubens zu betreten, von dem Sokrates sagte, dass er am Ende des menschlichen Denkens anzutreffen ist und immer weiter wird, je weiter gedacht wird. Eckhard Hieronymus stellte dem Vater der abendländischen Philosophie den vierhundert Jahre jüngeren Apostel Paulus gegenüber, der für den Glauben an die Liebe Gottes, die für den menschlichen Verstand nicht berechenbar ist, kämpfte und sein Leben dafür einsetzte. Er begann mit einer kurzen Beschreibung aus dem Leben dieses mutigen Apostels. Paulus war Sohn jüdischer Eltern und gehörte dem Stamm der Benjamin an. Er wurde 10 (n.Chr.) in Tarsus in Kleinasien geboren. Gamaliel in Jerusalem unterzog den Jugendlichen einer strengen religiösen Erziehung nach den Lehren der Pharisäer. Als Saulus verfolgte er mit übermäßigem Eifer die junge christliche Kirche und war an der Ermordung des Stephanus beteiligt. Auf dem Wege nach Damaskus erfolgte seine Bekehrung zum christlichen Glauben durch die Erscheinung des auferstandenen Jesus. Die Wahrheit des neuen Glaubens enthüllte sich mit einer ungeheuren Helligkeit vor ihm. Aus dem Saulus wurde der Paulus, der fortan für diese Glaubenswahrheit sein Leben einsetzte, das er in Armut und Entsagung, unter ständiger Bedrohung und durch zahlreiche Gefangenschaften hindurch führte. Der Prokurator Festus brachte ihn im Jahre 60 (n.Chr.) nach Rom, wo Paulus, der römischer Staatsbürger war und sich auf den römischen Kaiser berief, der Prozess gemacht wurde. Zwei Jahre später wurde das Verfahren eingestellt, weil die Ermittlungen nach römischem Recht ergebnislos verlaufen waren. Kaiser Nero ließ Paulus dann doch im Jahre 67 enthaupten, weil dieser keinerlei Zugeständnisse machte, die mit dem neuen Glauben nicht vereinbar waren. Paulus stand als Apostel fest im Glauben; er gab Jesus Christus und der neuen Wahrheit die größere Ehre.
Der Kaiser in seiner Verblendung ließ Männer von hoher Intelligenz und tiefer Einsicht hinrichten, so seinen langjährigen Ratgeber, den römischen Dichter und Philosophen Lucius Annaeus Seneca, den er 65 (n.Chr.) enthaupten ließ, weil die von ihm vorgetragene Wahrheit über Recht und Unrecht nicht in den despotisch-rücksichtslosen kaiserlichen Streifen von Macht und Machterhalt passte. Nero ging mit seiner selbstherrlichen Manie (“Qualis artifex pereo!” (Welch ein Künstler stirbt in mir!)) und hemmungslos wütenden Brutalität als der köpfende Schlächter von Rom in die Geschichte ein.
Aus der Missionstätigkeit des Paulus brachte Eckhard Hieronymus die Geschichte vom Silberschmied Demetrius, der wie seine Zunftgenossen durch den Verkauf gefertigter silberner Artemis-Tempelchen reich geworden war. In Ephesus kommt es zum Aufstand der Silberschmiede. Demetrius hält die Protestrede, in der er auf den Wohlstand verweist, den das Gewerbe gebracht hat, den nun der Paulus nicht nur in Ephesus, sondern in ganz Kleinasien streitig macht, weil er sagt, dass die von Menschenhand gemachten Götter keine wirklichen Götter sind. Damit missachtet Paulus nicht nur den Erwerbszweig der Silberschmiede sondern auch das alte Heiligtum der großen Göttin Artemis in Ephesus. Sie werden es nicht zulassen, dass diese Göttin, die in aller Welt verehrt wird, ihre Herrlichkeit verliert und verachtet wird. Demetrius löst mit seiner Rede einen wütenden Protest seiner Zunftgenossen aus. Sie rufen mit erhobenen Fäusten: “Groß ist die Artemis der Epheser!” Die ganze Stadt gerät in Aufruhr. Die Bürger stürmen in die Arena und schleppen Gaius und Aristarch aus Mazedonien, die Weggefährten des Paulus, dahin. Paulus macht sich auch auf den Weg, wird aber von den Jüngern aus Furcht vor gewalttätigen Ausschreitungen zurückgehalten. Die versammelten Menschen sind in wilder Aufregung. Viele wissen nicht, wozu sie gekommen sind. Alexander, den die Juden nach vorn schieben, winkt mit der Hand und will das Volk aufklären. Als das Volk aber erkennt, dass Alexander ein Jude ist, schreit es zwei Stunden lang wie aus einem Munde: “Groß ist die Artemis der Epheser!” Schließlich bringt der Stadtschreiber die Menge zur Ruhe und spricht: “Ihr Männer von Ephesus! Wer in aller Welt wüsste nicht, dass die Stadt der Epheser die Hüterin des Tempels der großen Artemis und ihres vom Himmel gefallenen Bildes ist? Das kann niemend bestreiten. Darum haltet Ruhe und übereilt euch nicht. Nun aber habt ihr Männer hergebracht, die weder Tempelräuber noch Lästerer unserer Göttin sind. Haben Demetrius und seine Leute gegen jemand Klage zu führen, so gibt es dafür Gerichtstage und Statthalter. Wenn ihr sonst noch ein Anliegen habt, so soll es in einer ordentlichen Volksversammlung erörtert und erledigt werden. Wir laufen Gefahr, wegen der heutigen Vorkommnisse des Aufruhrs angeklagt zu werden, und es fehlt uns jeder triftige Grund, mit dem wir diesen Auflauf rechtfertigen können.” Nachdem sich der Aufruhr gelegt hat, lehrt Paulus den wenigen Jüngern, die sich um ihn geschart haben, den neuen Glauben. Dann verlässt er Ephesus und macht sich auf den Weg nach Mazedonien.
Die Stunde war zu Ende. Eckhard Hieronymus sprach ein kurzes Abschlussgebet. Dabei bemerkte er, dass einige Schüler da nicht bei der Sache waren, weil ihnen das Beten entweder abhanden gekommen war, oder sie es von zu Hause aus nicht gelernt hatten. Für diese Schüler, und es waren etliche, hatte sich das Interesse auf den Vorspann mit der philosophie-geschichtlichen Betrachtung begrenzt; für sie war die anschließende religionsgeschichtliche Betrachtung ein Zusatz, der nicht uninteressant, aber zur Hauptsache der christlichen Glaubenswahrheit nicht geworden war. Doch gab es Schüler, denen der Unterricht zugesagt hatte und in der Pause mit allerlei Fragen, die den Glauben berührten, auf den Pfarrer einstürmten. Hier kam der Mut zur Offenheit einiger Schüler zum Tragen. Es wurde gefragt, ob der Glaube an der gegenwärtigen Situation der Menschen etwas ändern könne, ob er aus der Verzweiflung, in der sich viele Menschen befinden, herausführen kann, ob der Glaube notwendig ist, um den Zweifel zu überwinden und aus der Hoffnungslosigkeit herauszufinden. Ein anderer Schüler fragte, ob das Beten noch der Zeit entspricht, weil die Gebete, die gesprochen wurden, unerfüllt geblieben sind; wie gebetet werden muss, dass ein Gebet erfüllt würde; ob es an Gott oder den Menschen liege, wenn ein Gebet erfüllt würde oder nicht.
Ein anderer berichtete, dass ihm die Großmutter das Beten beigebracht habe, das dann von den Eltern nicht weitergeführt wurde. Das Pausengespräch zog sich lange hin. Es hatte viel direkter die Probleme und Nöte der jungen Menschen aufgezeigt, die sich im Unterricht nicht trauten, diese Fragen zu stellen. Eckhard Hieronymus versuchte sich im Antworten, so gut er es konnte. Er sprach einfach und verständlich und bekannte vor den Schülern, wenn er auf eine Frage keine Antwort wusste. Die Schüler dankten für das Pausengespräch; dankten für die Offenheit, dass Eckhard Hieronymus zugab, auf die eine oder andere Frage keine Antwort zu finden. Er selbst zog aus dem Pausengespräch mehr als aus dem Unterricht die Lehre, die jungen Menschen mehr zu Wort kommen zu lassen, sie zu ermuntern Fragen zu stellen, ihre Erfahrungen aus dem Leben und ihre Vorstellungen für das Leben einzubringen. Es komme weniger auf das Einzelwissen als vielmehr auf den Willen zur gemeinsamen Aufbauarbeit an. Mit dem Wissen zu prahlen ist nicht nur nutzlos, sondern abträglich für eine solche Arbeit, für die der Mut zur Offenheit, der Wille zum gegenseitigen Verstehen und die Ausdauer im Fleiß bei der Verfolgung des Zieles entscheiden. Für Eckhard Hieronymus gab es keine Frage, dass er an der Art und Weise, wie Religion zu unterrichten sei, Grundlegendes zu ändern habe.
Religion, wie er sie verstand, sollte die Menschen zum Gespräch zueinander öffnen, im Gespräch miteinander verbinden, sollte die Gemüter entkrampfen, sollte Mut machen, den Weg aus der Vergangenheit in die Zukunft gemeinsam zu gehen. So nahm er sich vor, sich künftig auf den zuhörenden Teil mehr zu konzentrieren, die jungen Menschen mehr reden zu lassen, sie zu ermuntern Fragen zu stellen, mehr aus sich herauszugehen, damit Religion nicht nur ein Unterrichtsfach ist, sondern im weitesten Sinne die Plattform zur Begegnung junger Menschen wird, wo aus der Glaubenswahrheit direkt neue Einsichten und Erkenntnisse geschöpft werden können, die für das Leben von Bedeutung sind, ohne dass da Hindernisse und Verhülltes im Wege liegen, die bei einer solchen Begegnung nur stören. Die Quelle muss fließen, damit Neues entsteht, um aus den Schäden der Vergangenheit herauszukommen und den Weg in die Zukunft zu finden. Dabei sollte das Ziel die bessere Zukunft sein, in der sich die Menschen wieder mehr zutrauen, einander vertrauen, mehr miteinander reden und Erfüllung in der gemeinsamen Aufbauarbeit finden, damit das Paulus-Wort aus dem 8. Kapitel des 1. Korintherbriefes Wirklichkeit wird, dass es die Liebe ist, die aufbaut, weil sie die Menschen miteinander verbindet.
Anders waren die Bibelstunden im Lesesaal des Gemeindehauses. Hier setzten sich die Teilnehmer aus älteren und alten Menschen, aus Witwen und Kriegsverletzten zusammen. Die Menschen kamen mit Interesse. Sie wollten hören, was die Bibel sagt, auch wenn sie den Text schon viele Male gehört und auch gelesen hatten. Die alten Menschen waren bibelkundig, was bei den jüngeren die Ausnahme war. Bei der Textwahl ging Eckhard Hieronymus Dorfbrunner auf die Wünsche der Teilnehmer ein, die ihm kleine Wunschzettel in die Hand gaben, nach denen er die folgenden Stunden ausrichtete. Dabei fiel auf, dass alte Menschen, und da vor allem die Männer, oft Psalme wählten, während jüngere Menschen, da vor allem die Frauen, Texte aus dem neuen Testament bevorzugten. Die Menschen, die zu den Bibelstunden kamen, hatten ihre Höhen und Tiefen erlebt und lebten sie weiter. Sie steckten seelisch mehr oder weniger in der Klemme und kamen mit dem Bedürfnis der Aussprache, des Hörens und Sprechens, des Kennenlernens von Menschen, um zu erfahren, was sie in den Herzenstiefen bewegte, weil doch alle vergleichbare Lebenswege zurückgelegt hatten.
Auf die Lebenswege der Teilnehmer und ihre daraus resultierenden Bedürfnisse einzugehen, das lag im Zentrum dieser Bibelstunden. Das unausgesprochene Kernanliegen, so fand es Eckhard Hieronymus nach den ersten Stunden heraus, war die Rückgewinnung des Selbstvertrauens, der Wille, aus der dunklen Sackgasse der Hoffnungslosigkeit herauszukommen, den nagenden Zweifel mit der Gefahr des Absturzes in die Verzweiflung zu überwinden.
Von den Psalmen waren es vorwiegend die Klagelieder, in denen der Mensch um Hilfe bittet, um Hilfe schreit. Er wendet sich in seiner Not an Gott, weil er allein die Not nicht abwenden, aus ihr nicht herausfinden kann. Im Leben ist vieles schief gelaufen. So bekennt der Mensch vor Gott seine Schwäche und die Sünden, die er aus der körperlichen, seelischen und geistigen Schwachheit heraus begangen hat. Der Mensch appelliert an die Ehre Gottes, erinnert ihn an seine guten Taten, fragt ihn, ob er den Betenden verstoßen hat, warum er nicht mit mächtiger Hand dazwischenfährt und mit schwingendem Schwert den Feind zerschlägt. Der Mensch schreit zu Gott auf und möchte sein Gebet mit den Klagen der Erschütterungen gehört wissen. Er fleht Gott an, dass er sich diesmal nicht taub stellen möge.
Die jüngeren Teilnehmer hatten auf ihren Wunschzetteln meist die Paulusbriefe an die verschiedenen Gemeinden, dann die Apostelgeschichte und weniger die synoptischen Evangelien vermerkt. Bei diesen Teilnehmern ging es offensichtlich um die Lehren, die sie aus dem Leben und Wirken der Apostel ziehen konnten, und ihre geschichtlichen Abläufe, die doch auch unruhig und risikoreich waren, als Geländer begriffen, an dem sie sich orientieren konnten, um das eigene Leben mit seinen Alltagssorgen besser zu verstehen und die Auflösung der eigenen Probleme zu finden. Eckhard Hieronymus betrachtete die Wunschzettel sorgfältig und ging bei der weiteren Textauswahl auf die Wünsche der Teilnehmer ein. Oft gab es zwei Themenkreise, von denen sich der eine Kreis um einen Psalm und der andere um einen der Paulusbriefe oder einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte drehte. Die Bibelstunden waren nicht nur gut besucht, sondern fanden so einen Zuspruch, dass der Lesesaal die Menschen nicht mehr fasste. Dann wurde die Tür zum Flur geöffnet, wo Menschen auf dicht gereihten Stühlen saßen, um an der Versammlung teilzunehmen. Er selbst stand in der offenen Tür, um den Blickkontakt zu den Menschen im Lesesaal und im Flur zu halten. Es hatte sich rasch in der Gemeinde herumgesprochen, dass diese Stunden lebendig und lehrreich waren, die durch die natürliche und packende Art des Vortrags und der offen geführten Diskussion jene Kräfte freisetzten, die ein befreiendes und erleuchtendes Erlebnis brachten.
Was seine Predigten paulinisch machte, war das Kerygma, die Verkündigung Christi als den Gekreuzigten und Auferweckten gemäß der Schrift. Das Evangelium basierte für Eckhard Hieronymus Dorfbrunner auf der Gemeinsamkeit des Glaubens, das von daher universal ausgerichtet und universal weiterzugeben war. Wie Paulus lehnte er sich in seinen Predigten an die apostolischen Schriften an, wobei er für das Zeitgeschehen der Gegenwart sich den nötigen Interpretationsraum freihielt. Wie Paulus sprach er in kurzen Sätzen. Das bewahrte die Sätze vor der Wortschwemme mit dem Ertrinken der Gedanken. Jeder Satzgegenstand war von einer geballten Ladung, der durch die Satzaussage, die durch das Tätigkeitswort im kurzen Abstand folgte, beim Aussprechen gezündet wurde und noch auf den Lippen “explodierte”. Die “Explosion” war dann besonders heftig, wenn das Tätigkeitswort in der Gegenwartsform ausgesprochen und mit einem Ausrufezeichen versehen wurde. Auch hatte sich Eckhard Hieronymus durch sein fortgesetztes Lesen philosophischer Schriften ein erstaunliches Wissen angeeignet, dass er, wie es Paulus seinerzeit getan hatte, philosophische Bemerkungen in die Predigt einfließen ließ und auf sie Bezug nahm. Die Sprache dieses jungen Dompredigers war unmittelbar und geradlinig im Gedanken; sie war von durchschlagender Wirkung. Sie erreichte einen Grad in der Gewalt der Zielgenauigkeit, dass man von einer Offenbarung sprach, wenn Eckhard Hieronymus Dorfbrunner die Predigt hielt. Er liebte seinen Beruf und die Arbeit mit und an den Menschen; er ging in beidem restlos auf. So sahen es auch die Kollegen und Vorgesetzten im Domkapitel, bei denen er sich durch sein sympathisches Wesen und die Kontinuität seiner hervorragenden Arbeit die Achtung und Kollegialität erworben hatte. Sein Einsatz, der nie zu ermüden schien, und die natürliche Freundlichkeit und Bescheidenheit, sein enormer Fleiß und die herausragende rhetorische Begabung führten den Pfarrer bald, und für ihn völlig unverhofft, einige Stufen höher.
An einem Donnerstagnachmittag gegen sechs klopfte ein Bote an die Tür und brachte die Botschaft, dass Bischof Rothmann ihn am folgenden Tage, den letzten Freitag im Monat März um elf Uhr in seinem Büro sprechen wolle. Eckhard Hieronymus nahm die Botschaft entgegen, wunderte sich, dass ihm der Bischof nichts gesagt hatte, mit dem er drei Tage vorher in einer Unterredung über den Religionsunterricht am Wilhelm-Gymnasium und die immer wieder aufflackernden Disziplinprobleme gesprochen hatte. Bischof Rothmann sah die Ursache in der häuslichen Erziehung, die im Zeitalter der fortgeschrittenen Aufklärung sich mehr und mehr von der Kirche entfernte, selbst dann, wenn die Ereignisse auf die menschlichen Unzulänglichkeiten und Unverständlichkeiten deutlich hinweisen. Eine Lösung der Probleme konnte der Bischof nicht anbieten. Er meinte, dass auf den niedergehenden Zeitgeist einzugehen sei und die religiösen Betrachtungen philosophisch zu erweitern seien. Als Eckhard Hieronymus sagte, dass er das bereits tue und ein anfänglicher Erfolg mit dem Mehr an Disziplin zu verzeichnen war, fiel dem Bischof nichts mehr ein.
Bischof Rothmann empfing ihn mit gewohnter Freundlichkeit, kam dem jungen Pfarrer entgegen, als der an die Tür geklopft hatte. “Bitte nehmen Sie Platz, Pfarrer Dorfbrunner.” Mit diesen Worten bot er ihm einen gepolsterten Stuhl in der großzügig arrangierten Sitzecke seines geräumigen Büros an. Der Bischof hatte nun das metallene Bischofskreuz über der schwarzen Weste in Brusthöhe hängen, das er, im Gegensatz zum Konsistorialrat Braunfelder, frei hängen ließ und nicht krampfhaft mit den Fingern umfasste, die diesmal von einer schmalen, ausgeformten Hand gekommen wären. Sie saßen im rechten Winkel um den niedrigen quadratisch gehaltenen Barocktisch zueinander. Der Bischof erkundigte sich nach der Familie und sprach in Bezug auf die Kinder die Hoffnung aus, dass sie in eine geordnete und friedliche Zukunft hineinwachsen mögen, damit ihnen erspart bleibe, was die Generation der Eltern so hart getroffen hat. “Die Menschen sollten endlich die Lehren für die Zukunft ziehen”, sagte der Bischof mit ernstem Gesicht.
Er bekannte religionskritisch, dass es die Kirchen in zweitausend Jahren nicht geschafft haben, den Frieden so weit zu bringen, dass Kriege im Zusammenleben der Menschen keine Existenzberechtigung mehr hätten. Eckhard Hieronymus überraschte der Mut des Bischofs zu einer solch kritischen Feststellung. Dieser Satz war es, dass er dem höchsten Kirchenvertreter Schlesiens neben seiner Funktion nun auch als Mensch die höchste Achtung entgegenbrachte. Denn der Bischof war sein erster Vorgesetzter, der so einen bedeutenden Satz ausgesprochen hatte. Dazu wäre der Konsistorialrat Braunfelder in Burgstadt nicht fähig gewesen, der bei den Gesprächen in seinem Büro ständig über sein Brustkreuz strich oder es mit seinen dicken kurzen Fingern umfasst hielt, als befürchtete er, das Kreuz zu verlieren oder anderswie von ihm getrennt zu werden. Dabei war Eckhard Hieronymus, den das Kreuzgefummel irritierte, nie auf den Gedanken gekommen, ihm das Kreuz wegzunehmen; vielmehr hatte er gewünscht, dass der Konsistorialrat sich mehr als Kreuzträger bewusst und seine widrige Eitelkeit und Geschwätzigkeit hinter dem Kreuz ablegen und sich von Berufswegen den Sorgen und Nöten der Menschen öffnen würde. Da war der Bischof doch ‘aus einem anderen Holz geschnitzt’, der ein freundlicher und zuhörender Mensch geblieben war, dem das Schicksal der Menschen hinter dem Brustkeuz am Herzen lag.
Nachdem der Bischof seine Eindrücke zur Person und geleisteten Arbeit von Pfarrer Dorfbrunner in lobenden Worten zusammengefasst hatte, wobei die Zusammenfassung einem “Summa cum laude” durchaus entsprach, kam er auf den Punkt. “Pfarrer Dorfbrunner, Sie wissen, dass die Stelle des Superintendenten durch den plötzlichen Tod von Herrn Dr.theol. Albert Brunswig seit einem Jahr unbesetzt ist. Einen Nachfolger für diesen großartigen Theologen zu finden, diese schwere Aufgabe ist mir aufgrund meines Amtes zugewiesen. Seit einem Jahr arbeite ich an dieser Aufgabe. Sie werden mir erlauben, dass ich nicht in die Einzelheiten gehe, warum mir bis heute die Lösung dieser Aufgabe nicht gekommen war. Sie können versichert sein, dass meine Lösungsversuche von großer Sorge und nicht geringerer Fairness innerhalb des Domkapitels getragen wurden. Nach langem Suchen bin ich schließlich auf Sie gekommen. So möchte ich Sie heute fragen, ob Sie das Angebot, die Stelle des Superintendenten für den Kirchenbezirk Breslau annehmen wollen. Bitte verstehen Sie mich richtig, der verstorbene Superintendent Brunswig war eine herausragende Persönlichkeit im kirchlichen Leben der Stadt, der durch seine Tätigkeit, die fast zehn Jahre umspannen, hohe Maßstäbe gesetzt hat, die von seinem Nachfolger beachtet und gehalten werden sollten. Ich gehe davon aus, dass Sie die Sache überdenken wollen, so wie sie mein erstes Angebot, Domprediger in Breslau zu werden, das ich ihnen im Schlesischen Hof in Burgstadt unterbreitete, überdacht haben. Denken Sie die Sache in Ruhe durch. Da die Sache eilt, rechne ich mit ihrer Entscheidung binnen Wochenfrist.”
Im Rahmen eines Festgottesdienstes zwischen Ostern und Pfingsten des Jahres 1925 wurde Eckhard Hieronymus Dorfbrunner als der jüngste Superintendent, der jemals in Schlesien ordiniert wurde, von Bischof Rothmann in sein Amt eingesetzt. Länger als sonst läuteten die Glocken, die vor der Demontage in den Kriegsjahren zum Zwecke der Einschmelzung zur Herstellung von Kanonen verschont geblieben waren. Der große Dom war bis auf den letzten Platz gefüllt. Links vor dem Altar haben der Bischof und die übrigen vier Domprediger ihre steil gelehnten Stühle eingenommen, wobei der Bischofsstuhl gegenüber den anderen Pfarrstühlen breiter war und eine höhere Rückenlehne hatte, die von rotem Samt überzogen war. Der Organist, der etwa im Alter von Eckhard Hieronymus Dorfbrunner war und die hohe Kunst des Orgelspiels unter dem berühmten Organisten Johan Christiaan Felix, einem gebürtigen Niederländer, an der Thomaskirche zu Leipzig erlernt hatte und seit etwa einem Jahr Domorganist zu Breslau war, intonierte im Bach’schen Fugenstil das erste Lied. Dabei griff er stärker und stärker in die Tasten, trat kontrapunktisch virtuos in die Pedale, zog mehr und mehr die Register und rollte mit dem Fuß die Lautstärke soweit hoch, dass das Domgemäuer bebte. Dann rollte er die Lautstärke zurück, und das Beben verebbte. Die Orgel hielt das Bläserregister mit den Flötentönen, Posaunenklängen und Trompetenstößen, die das Singen der großen Gemeinde noch kraftvoller machte. Die weit ausfahrenden, kreuz und quer verlaufenden Schwingungen in den verschiedenen Höhen vertikal gebündelter Akkordfolgen, dem kontrapunktischen Gegensetzen und Halten des Orgelpunkts grenzten in der Gesamtheit des errichteten Tongebäudes ans Phantastische. Da reichte der kräftige ‘Orgelarm’ ans Monumentale der Brucknerschen Wuchtigkeit heran. Das musste der junge Domorganist Thomas Büchner von seinem großen Lehrer übernommen haben, der nicht nur ein berühmter Bach- und Regerinterpret, sondern auch der erste Zwölftonpionier auf der Orgel war, was er in seinen Orgelkonzerten, nicht immer zum Wohlgefallen seiner Zuhörer, unter Beweis stellte.
Pfarrer Möller, ein älterer und äußerst sympathischer Herr, der zum verdienten Ruhestand noch wenige Monate zu gehen hatte, sprach vor der stehenden Gemeinde das Eingangsgebet und verlas vor der sitzenden Gemeinde die Ankündigungen der kirchlichen Ereignisse für die Woche. Auf der Empore hatte der Chor Aufstellung genommen und sang unter Leitung des Organisten die Bach’sche Auferstehungskantate. Es war eine festliche Musik, aus der die Kräfte der inneren Festigung und des höheren Erlebens in die Herzen strömten, die sich an den barocken Klängen erfreuten. Danach erhob sich der Bischof aus seinem Stuhl und stellte sich vor den dreistufigen Treppenabsatz zum Altar mit dem großen Holzkreuz dahinter, blickte in die Gemeinde und führte in einer kurzen Rede den neuen Superintendenten ein, der in die Fußstapfen des großen Vorgängers Albert Brunswig treten soll, der unermüdlich für die Menschen Breslaus eingetreten war. Ihm war zu verdanken, dass die Domglocken noch hingen und nicht, wie so viele schlesische Glocken, von den Türmen abgehängt und eingeschmolzen wurden. Der neue Superintendent trete ein Erbe an, dem große Maßstäbe vorausgehen. Ihnen zu folgen und sie in einer schweren Zeit zu erfüllen, das wird die Aufgabe des neuen Superintendenten sein. “Ich vertraue auf Superintendent Dorfbrunner, dass er seine Kräfte für die Kirche und zum Wohle der Menschen der Stadt einsetzen wird. Möge die Gemeinde ihm ihr Vertrauen entgegenbringen. Bitten wir den Herrn um seinen Beistand und seinen Segen.” Nach der kurzen Einführung und unter dem Gesang der Gemeinde setzte sich der Bischof in seinen Lehnstuhl zurück.
Auf der Kanzel verlas Superintendent Dorfbrunner aus dem Johannes-Evangelium die Geschichte vom Auferstandenen am See Tiberias: “Jesus offenbarte sich abermals den Jüngern am See Tiberias. Dort waren Simon Petrus und Thomas, genannt der Zwilling, sowie Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und andere zwei seiner Jünger. Simon Petrus spricht zu ihnen: ich will fischen gehen. Da sagen die andern zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und bestiegen das Boot. Doch in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war, der da fragt: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Nein, antworteten sie ihm. Da sprach Jesus zu ihnen: Werfet das Netz zur Rechten des Bootes, dann werdet ihr finden. Da warfen sie das Netz aus und konnten es von der Menge der Fische nicht ziehen. Nun spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Das ist der Herr! Da Simon Petrus das hörte, dass es der Herr war, gürtete er den Rock um, weil er nackt war, und warf sich ins Meer. Die andern Jünger kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land. Sie zogen das Netz mit den Fischen. Als sie aus dem Boot stiegen und das Land betraten, sahen sie die Kohlen und darüber Fische und Brot gelegt. Jesus spricht zu ihnen: Bringet von den Fischen, die ihr gefangen habt! Simon Petrus zog das Netz aufs Land, das voll großer Fische war, hundertdreiundfünfzig an der Zahl. Obwohl es so viele Fische waren, zerriss das Netz nicht. Kommt und haltet das Mahl!, spricht Jesus zu ihnen. Niemand von den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer er sei, weil sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus, nimmt das Brot und gibt es ihnen, so auch die Fische. Es ist das dritte Mal, dass Jesus sich als der Auferstandene seinen Jüngern offenbart.”
Liebe Gemeinde!
Die Situation schien hoffnungslos. Hunger plagte die Menschen, und das ausgeworfene Fischernetz blieb leer. Eine Beschreibung, die auch in unsere Zeit gehört, wie sie kürzer und besser nicht zu bringen ist. Sehen wir doch Kinder und erwachsene Menschen in den Straßen der Stadt, denen die Wangen unter den Jochbögen eingefallen sind. Es sind unsere Nächsten, die mit leeren Mägen stehen, bettelnd durch die Stadt ziehen und verzweifelt sind, wenn sie, immer magerer und schwächer werdend, an die Nächte denken, in denen ihnen Magenkrämpfe den Schlaf rauben. Jeden Tag sehen wir diese armen Menschen um uns herum. Wir sehen sie und tun nichts. Im Gegenteil, wenn ein Bettler seine magere Hand ausstreckt, stößt uns seine verkommene und zerrissene Kleidung ab. Uns überkommt das Gefühl des Ekels. Wir nehmen uns vor, wegzublicken, damit uns der Ekel nicht überkommt, damit unsere Kleidung sauber bleibt und nicht von den Bettlerhänden berührt wird. Folgt uns ein bettelndes Kind oder ein alter Mann, mit oder ohne Krücke, dann sehen wir ganz gerade nach vorn, legen einen Schritt zu und überhören geflissentlich das Schlürfen der uns folgenden Schritte und das Flehen um eine milde Gabe. Vom Flehen um eine Gabe lassen wir uns nicht aufhalten. Wir gehen geradeaus, ohne zur Seite oder nach hinten zu blicken. Denn wir wollen von den Menschen mit den eingefallenen Wangen nicht noch weiter gestört werden. Es genügt uns, dass ihre Wangen eingefallen sind und ihre Köpfe mit den hervorstehenden Wangenknochen und den großen trockenen Augen das Stadtbild verschandeln. Mit diesen Kreaturen wollen wir nichts zu tun haben. Wir ekeln uns vor ihnen und werfen die Kleidung in die Wäsche, wenn sie von einer solchen Bettlerhand berührt wurde. Erst wenn wir uns durch kurzes Zurückblicken überzeugt haben, dass wir eine solche Kreatur abgehängt haben, weil sie eben doch zu schwach ist, um dem weglaufenden Schnellgang über ein oder zwei Straßenlängen mitzuhalten, schalten wir erleichtert in den Normalgang zurück und verdrängen ganz schnell den unappetitlichen Vorgang. So etwas werfen wir wie die schmutzige Wäsche in einen Korb, diesmal in den Korb des schnellen Vergessens. An diesen Vorgang wollen wir uns weder von selbst erinnern noch von einem andern erinnern lassen. Keiner sollte es wagen, diesen Vorgang zu erwähnen, der ein für allemal aus unserem Gedächtnis ausradiert ist. Ist doch das Leben für uns schon schwer genug.
Liebe Brüder und Schwestern!
So sehen wir aus, wenn wir uns einmal selbst den Spiegel vors Gesicht halten. Ich möchte nicht übertreiben, aber in diesem Spiegel sehen wir nicht gut aus. Unsere Gesichter sind verbissen und verzerrt. Von Güte und Nächstenliebe ist da keine Spur. Wir, wenn wir noch eine Spur Anstand haben, gefallen uns im vorgehaltenen Spiegel nicht. Wir sagen, das bin ich nicht. Und doch sind wir’s, die in den Spiegel blicken. Selbst das Lächeln in den Spiegel ist ein Lächeln, das wir nicht mögen, weil es aufgesetzt, künstlich und nicht ehrlich ist. Es hat seinen tieferen Grund, dass wir uns selbst den Spiegel nicht vors Gesicht halten. Da treten wir vor den großen Wandspiegel, wo das Gesicht auf die Haare, die Falten unter den Augen und auf die Kleidung blickt, ob der Scheitel richtig sitzt, wann der nächste Termin beim Friseur fällig ist, ob eine neue Falte unter den Augen dazugekommen ist, ob der Anzug und die Bügelfalte an der Hose richtig sitzt. Mehr als diese Äußerlichkeiten wollen wir im Spiegel nicht sehen. Das ist es, dass wir uns ständig was vormachen, was wir eigentlich nicht sind und in der Tiefe unserer Herzen auch nicht sein wollen. Doch wir sind zu schwach, um uns zu bessern, anständig zu werden, unsere Augen auf die Menschen in Not zu richten, unsere Blicke dahin gehen zu lassen, wo sie eigentlich hingehören, nämlich zu den Kindern und den Menschen, die der Hilfe dringend bedürfen. Wie lange wollen wir noch wegblicken vom Elend dieser Menschen und uns in Untätigkeit verstocken? Solange wir uns so verhalten, an der Sache der Not achtlos vorbeigehen, uns dem Anliegen hilfloser Menschen, wie es die Waisenkinder nun mal sind, verschließen, uns vor der Mitverantwortung drücken oder sonst noch danebenbenehmen, aus der Erinnerung kriegen wir das schlechte Gewissen nicht heraus. Da können wir uns auf den Kopf stellen, es wird uns nicht gelingen, weil uns so etwas, dessen Tracht den Namen Niedertracht verdient, nicht gelingen soll, so lange das Herz in uns noch schlägt. Wenn wir nicht alle dieser Tracht erliegen und mit ihr untergehen wollen, kommen wir nicht umhin, den Spiegel dem Gesicht vorzuhalten und bei der Betrachtung nun nicht auf die Haare, Haut- und Bügelfalten zu blicken. Denn es gibt Wichtigeres, was zu betrachten ist. Damit komme ich auf die Geschichte des Auferstandenen am See Tiberias zurück.
Liebe Gemeinde!
Der auferstandene Christus bedurfte der Menschen nicht, am wenigsten für die Auferstehung. Denn die Menschen hatten Jesus in niedrigster Weise gequält und dann gekreuzigt. Sie haben ihn getötet. Das war das Werk der Menschen. Um den Tod zu überwinden, daran haben die Menschen weder mitgewirkt noch daran geglaubt. Erst als die Erde bebte und der Vorhang in der großen Synagoge zerriss, wussten sie, dass sie mit der Kreuzigung etwas getan hatten, was ihren Verstand überstieg, was sie nicht hätten tun sollen. Nun bekamen sie Angst, da sind die Schriftgelehrten nicht ausgenommen, dass es ihnen an den Kragen gehen, ihnen mit aller Schärfe vergolten würde, was sie da in dem fürchterlichen Schauprozess angestellt hatten. Stattdessen offenbarte sich Jesus als der Friedensbringer, nachdem er für die Sünden der Menschen den Tod am Kreuz auf sich genommen hatte. Nun als Auferstandener trat er an den See Tiberias, um seinen Jüngern, die der Hunger plagte, beizustehen, ihnen die Stelle im See zu zeigen, wo sie ihr Netz mit Fischen füllen konnten. Hinter dieser Schilderung verbirgt sich die Weisheit der großen Glaubenswahrheit, dass der Mensch die Nahrung findet, die er braucht, wenn er auf das Wort des Herrn hört. Um das Ohr für sein Wort, das mehr gilt als jedes menschliche Wort, weil es bis tief in den Wortkern hinein wahr ist, zu öffnen, muss, wenn ich mich bildlich ausdrücken darf, der Gehörgang bis hin zum Trommelfell vom Schmutz gesäubert und von allen sonstigen Verstopfungen befreit werden. Die Menschen würden sich da sehr nützlich erweisen, wenn sie sich bei dieser Säuberungsaktion gegenseitig helfen würden, weil das einer allein nicht kann, in den eigenen Gehörgang ohne den Doppelspiegel hineinzusehen.
Ziehen wir die erste Bilanz, was der Mensch kann, und was er nicht kann. Der Mensch kann sich den Spiegel nicht selbst vors Gesicht halten, um das schlechte Gewissen, das gleich hinter seinen Augen funkelt, zu sehen. Dazu fehlt ihm der Mut zur Wahrheit. Dagegen bringt er ohne diesen Spiegel vieles fertig: er kann schöne Reden halten, selbst wenn die Taten so schön nicht, ja oft fürchterlich, sind, wenn wir an die Kriege und sonstigen Grausamkeiten denken, zu denen er, ohne mit der Wimper zu zucken, fähig ist. Der Mensch kann fleißig sein, wenn es um seine persönlichen Interessen geht. Da vollbringt er Leistungen, die erstaunlich sind, sich aber oft nicht weniger erstaunlich zum Nachteil der anderen auswirken. Der Mensch ist ein Meister der Vernichtung und Zerstörung. Aus dieser Bilanz geht hervor, dass es eigentlich nicht besser, sondern eher noch schlechter wird, solange dem spiegellosen Treiben der Menschen, ich meine die ausufernde Gewissenlosigkeit, kein Einhalt geboten wird. Wir mögen darin übereinstimmen, dass die Grenze der Schlechtigkeiten erreicht ist, hinter der es nur noch in den Abgrund des Unterganges gehen kann. Uns vor diesem Abgrund zu bewahren, das ist, warum Jesus Christus für uns Menschen am Kreuz gestorben und vom Tode wieder auferstanden ist, um uns den Weg in die andere, in die entgegengesetzte Richtung zu weisen. Es war sein Leben und wird es bleiben, um den Menschen vor dem Absturz zu bewahren, ihn aus dem Abgrund herauszuziehen, ihn aus der seelischen Finsternis zu befreien, auf den Weg des Lichtes zu führen und ihn im Hellen durchs Leben zu geleiten. Dafür bot er uns seine immerwährende Liebe an, von der Gebrauch zu machen unser Schicksal bestimmt.
Kommen wir zur Möglichkeit der zweiten Bilanz. Sie kann viel besser aussehen als die erste, wenn wir endlich bereit sind, das Liebesangebot Christi anzunehmen und uns der hellen Glaubenswahrheit mit ganzem Herzen zu öffnen. Es kann nicht weiter angehen, dass wir uns dieser Wahrheit, aus welchen Gründen auch immer, versperren. Der dicke Balken muss weg vor unseren Augen, wir müssen wieder richtig sehen können, um zu erkennen, wo der andere Weg, der bessere und hellere Weg abgeht. Wenn wir nur den Mut zur Öffnung aufbringen und die Ausdauer, unsere Herzen offen und die intellektuellen Gaben bereitzuhalten, dann werden wir auch den Weg finden, aus der zehrenden Schwachheit, der angstgekräuselten Verschlafenheit und dem von Menschen gemachten Labyrinth sengender Verzweiflungen herauszukommen. Der Aufstieg zum befreienden Gang ist möglich, wenn wir die Hand ausstrecken, sie dem Herrn und Erlöser entgegenstrecken, und uns von ihm führen lassen. Dazu bedarf es allerdings des Glaubens an Jesus Christus, der deshalb gefestigt werden muss, wenn wir es ehrlich mit ihm und uns meinen. Aus der Spiegelaffäre sollten wir die Lehren ziehen, wenn wir neue Wege beschreiten wollen.
Liebe Brüder und Schwestern!
Wir müssen umdenken, unsere Eitelkeiten und sonstigen Egoismen ablegen. Dann gehen uns von ganz allein die Augen auf für das, was zu tun und was zu lassen ist. Wir müssen wieder Menschen werden, die das Herz am rechten Fleck und nicht nur zum Pumpen nach mehr Reichtum haben. So, wie wir die Gehörgänge vom Schmutz säubern und von anderen Verstopfungen befreien, müssen wir die vielen Steine aus unseren Herzen holen. Die Herzkammern müssen entrümpelt und entsteint, die Hindernisse aus den Vorhöfen weggeräumt werden, dass sich die Segelklappen frei entfalten können, was dem Blutstrom zugute kommt. Da auch die Herzen Ohren haben, sollten sie frei von thrombotischen und anderen Verstopfungen gehalten werden. Alles das ist nützlich für das Leben. Doch der größte Nutzen sollte aus dem Liebesangebot Jesu Christi gezogen werden, der jederzeit bereit ist, uns zu begleiten und vor den drohenden Gefahren zu beschützen, wenn wir fest im Glauben zu ihm stehen und uns da nicht erschüttern lassen, egal, wie gescheit wir uns vorkommen oder einer uns dreinreden mag. Um im Glauben den notwenigen, positiven und festen Standpunkt einnehmen zu können, der uns beim Stehen nicht erschüttern kann, brauchen wir die Liebe Gottes. Das intellektuelle Wissen hilft da wenig weiter, das uns weit auf die Abwege von Gewalt und Ungerechtigkeiten gebracht hat, an deren Folgen wir bitter leiden. Paulus bringt es auf den Punkt, wenn er im 8. Kapitel des 1. Korintherbriefes sagt: Das Wissen bläst auf, nur die Liebe baut auf. Es ist die Liebe Gottes, die uns gegeben wird mit dem Auftrag, diese Liebe unter uns walten und wirken zu lassen, unsere Nächsten und die Armen in diese Liebe einzubeziehen. Es steht dem Menschen nicht an, die göttliche Liebe einem anderen Menschen zu verwehren. Positiv gesprochen bedeutet es, dass wir die Welt zum Besseren verändern können, wenn wir nicht nur aus dem Wissen, sondern aus der Liebe Gottes heraus leben und wirken.
So ist die Erscheinung des Auferstandenen am See Tiberias ein weiteres Zeichen, weiterhin für die Menschen dazusein, ihnen bei den für sie nicht vorhersehbaren Gängen durchs Leben zu helfen und ihnen mit Rat und Tat beizustehen, wie es in unserem Glauben verankert ist. Die Botschaft Jesu Christi ist eine Heilsbotschaft mit dem größten Angebot, das den Menschen gemacht werden kann. Das schafft doch die entscheidende Erleichterung, bringt Hoffnung, dass das Leben ganz anders sein kann, als es ist, wenn Menschen das machen, was sie wollen. Schließlich soll die Botschaft, die aus gutem Grund die frohe Botschaft genannt wird, die Witwen und Waisen, die Verwundeten und Kranken, die ins Elend sinkenden und verzweifelten Menschen trösten und das in der schweren Zeit wie dieser.
Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Mit diesem Satz, dem Anfang des Johannes-Evangeliums, der das Universum bis zu den tiefsten Tiefen durchdringt, dessen Tragweite für den Menschen nicht ausschöpfbar ist, möchte ich in aller Demut abschließend die Gewissheit aussprechen, indem ich die Kraft aus dem Glauben schöpfe, die in ihr waltende und aus ihr wirkende Weisheit bezeuge, die den menschlichen Verstand und seine Vernunft weit übersteigt, dass es das Wort Gottes ist, das am Anfang wie am Ende steht. Sein Wort hat das Universum begründet, und sein Wort wird das Universum beschließen.
Der Organist übersetzte das Gesagte in Töne, begann mit einem elegischen Vorspiel über dem Grundton C, wechselte nach kurzer Kadenz in die helle Tonart E, erhöhte den Grundton C chromatisch zum Cis, das er als Orgelpunkt im Bass behielt, setzte die Kraft des Glaubens hinzu, indem er die Fußrolle auf ‘forte’, dann auf ‘fortissimo’ hochdrehte, dass der Dom für kurze Zeit bebte. Das schallende Tongebäude erreichte eine Mächtigkeit, die der gemauerten Mächtigkeit des Domes nicht nachstand. Als gäbe es den Sieg zu feiern, der im Bereich des Glaubens doch eher still vor sich zu gehen hat. Der Dom ließ vom Beben ab und der Organist von seinem Orgelspiel. Nach kurzer Pause intonierte er das Lutherlied von der festen Burg, dem die Gemeinde aus voller Kehle einstimmte. In einem längeren Schlussgebet dankte Eckhard Hieronymus Gott für seine unendliche Gnade und bat ihn um seine Führung und seinen Beistand, dass Friede in den Menschen einkehre, damit das Leben aus der Armut mit dem unsäglichen Elend aus der Sackgasse der Verzweiflung herauskommen kann und ins Licht der Hoffnung und Zuversicht gesetzt werde. Er bat um das tägliche Brot für die Kinder und Hungernden. “Herr, gib uns die Kraft und den Willen, dass wir den Menschen wieder erkennen und ihm helfen, der so dringend der Hilfe bedarf, dass wir nicht mehr wegsehen, wenn uns ein Kind oder an alter Mensch die ausgezehrte Hand entgegenstreckt. Zeige uns, dass es möglich ist, deine Liebe zu empfangen, sie weiterzugeben und dadurch das Leben eines jeden Menschen menschenwürdig zu machen.”