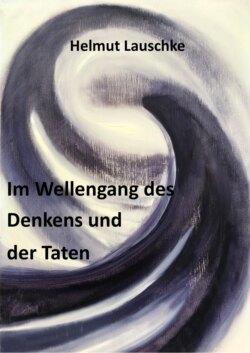Читать книгу Im Wellengang des Denkens und der Taten - Helmut Lauschke - Страница 4
Die große Niederlage an der Ostfront und der Einberufungsbefehl
ОглавлениеDie mit äußerster Härte geführte Schlacht um Stalingrad verloren die Deutschen in dem extrem kalten russischen Winter 43/44. Ende Januar 1944 ergab sich Generalmajor Paulus mit dem großen Teil der 6. Armee. Am 2. Februar meldete Marschall Woronow, dass die Deutschen den Widerstand eingestellt hätten und neunzigtausend Gefangene gemacht wurden, die den Überlebenden von 21 deutschen und einer rumänischen Division entsprachen (Churchill: Der zweite Weltkrieg). Für Eckhard Hieronymus und Millionen Deutscher zeigte sich das rote Wetterleuchten am Horizont, dass der Krieg im Osten nicht zu gewinnen war. Stalingrad war der entscheidende Wendepunkt, für die Generäle und das Volk. Von da an begannen sich die Deutschen vor der Roten Armee zu fürchten. Die noch lebenden, versteckten Juden und andere vom Nazisystem Bedrohten begannen dagegen zu hoffen, dass die Knechtschaft nicht mehr ewig dauern würde. Doch die Niedergeschlagenheit über den verlustreich verlorenen Kampf um Stalingrad überwog die zarten Hoffnungssprossen der Unterdrückten, Verfolgten und Inhaftierten. In den KZ’s, wo die Menschen aufs nackte Überleben vergeblich hofften, war von diesen Sprossen, weil sie länger brauchen, um zu blühen, keine Spur. Dort lief die Tötungsmaschine auf Hochtouren, wie junge Soldaten der Bewachungseinheiten während des Heimaturlaubes in vertraulichen Gesprächen dem Superintendenten Dorfbrunner berichteten. Diese jungen Menschen waren durch die Unfassbarkeit ihrer Erlebnisse seelisch aufgerieben und litten in großem Maße an Depressionen und Nervenzusammenbrüchen. Einige von ihnen verübten Selbstmord, weil sie das Massenmorden unschuldiger Menschen und ihrer Kinder nicht ansehen konnten.
Während die Räder von der Ostfront zurückzurollen begannen, bekam Paul Gerhard Dorfbrunner den Einberufungsbefehl. Es bedurfte eines längeren Gespräches des Vater mit dem jungen Major in der Kommandatur, um einen vierwöchigen Aufschub zu bewirken, damit Paul Gerhard das Kriegsabitur abschließen konnte. Der Sohn wollte nach seinem Wehrdienst, nach der Rückkehr von der Front Medizin studieren, um als Arzt für die Menschen zu arbeiten und den Leidenden zu helfen. Er hatte sich schon genauere Vorstellungen gemacht. So hatte er dem Vater gesagt, dass er Chirurg werden möchte, weil ihm das Wirken mit den Händen in der Medizin mehr zusagte als die reflexklopfende und schreibende Tätigkeit eines Neurologen.
Es war an einem Mittwoch im April 1944. Die Vorbereitungen zu “Führers” Geburtstag liefen auf Hochtouren. Das rote Fahnenmeer mit der schwarzen Swastika, den gekreuzten ‘Fragezeichen’, auf weißem Kreis wehte über der Stadt, als stünde der Endsieg inmittelbar bevor. Das stampfende Marschieren und Absingen der Helden-, Blut-und-Ehre-Lieder schwirrte hallend durch die Straßen. Probende Hochrufe auf den “Führer” knallten gegen Türen und Fenster, dass Hausbewohner die Türen und Fenster schlossen, um dem hirnverbrannten, braunen Spuk mit seiner rauhkehligen Schreihysterie den Zugang in die Wohnzimmer zu verwehren. An diesem Mittwoch hatte Luise Agnes ein Festessen gekocht, das mit herabgesetztem Appetit eingenommen wurde. Keiner wusste, dass es sogleich das Abschiedsessen für Paul Gerhard im Kreise der Familie war. Gesprochen wurde wenig. Doch was gesprochen wurde, war von Gehalt, dass sich alle das Gespräch zeitlebens merkten. Es gab noch einen echten Bohnenkaffee, den Luise Agnes für festliche Anlässe zurückgelegt hatte, und dazu selbstgebackene Plätzchen. Den Großteil der Plätzchen, die Luise Agnes in der Nacht gebacken hatte, füllte sie in eine Blechdose und stellte sie Paul Gerhard zum Mitnehmen auf den Tisch in seinem Zimmer. Es war ein ungewohntes Bild, ihn in der Uniform des Infanteristen der deutschen Wehrmacht zu sehen.
So brachte die ganze Familie Paul Gerhard am späten Nachmittag des sonnigen Mittwochs vor “Führers” Geburtstag zum Bahnhof. Auf dem Wege dorthin wurde bis auf einige belanglose Dinge, wie “Hast Du genügend Taschentücher mitgenommen?” oder “Nun müsste auch der Winter in Russland zu Ende sein” oder, und das in mehrfacher Wiederholung, “Pass gut auf dich auf!” so gut wie nichts gesprochen, obwohl tausend Gedanken durch die Köpfe der Eltern und hunderte durch den Kopf von Anna Friederike schwirrten. Der Zug stand auf Gleis 3, auf dem an einem späten Freitagabend Eckhard Hieronymus aus Burgstadt nach dem Trauergottesdienst für Pfarrer Altmann zurückgekommen war. In der Bahnhofshalle hatten sich junge Männer, meist Klassenkameraden von Paul Gerhard in denselben Uniformen mt ihren Eltern und Geschwistern eingefunden. Bei einigen waren sogar die Freundinnen mitgekommen, die die frischgebackenen Rekruten zu einem Lächeln brachten. Bei allen herrschte die Angst mit den Bedenken vor dem frühen und vielleicht letzten Sonnenuntergang in der Heimat vor.
Eckhard Hieronymus befahl in Gedanken unentwegt den Sohn der Führung Gottes an, doch sagte er es nur einige Male. Den Söhnen an der Front Glück zu wünschen, nämlich das Glück, mit dem Leben davonzukommen, das ließ sich sprachlich nicht machen, weil es schon gedanklich und moralisch sich nicht machen ließ. Es war nicht angebracht, den Söhnen beim Abschied mit dem Wort ‘Glück’ zu kommen, um ihnen in der Satzkombination von Krieg und Glück den kostbaren Bestand der elterlichen Sohnesliebe mit auf den Weg zur Front zu geben. Denn diese Kombination wäre eine aufgesetzte, da sie eine unnatürliche war. Schwer lastete der Druck des Einberufungsbefehls mit seinen Konsequenzen auf den Söhnen, die im Schießen und Totschießen völlig unerfahren waren. So setzte sich die Verabschiedung von den jungen Menschen bis an den Bahnsteig fort. Es waren meist Klassenkameraden und Freunde von Paul Gerhard, die zum Teil auch Söhne von Gemeindegliedern waren und in den Wehrmachtsuniformen steckten, um mit unbekanntem Ziel in eine unbekannte Zukunft an die Ostfront gefahren zu werden, von der bekannt war, dass es da hart und unerbittlich zuging.
Der Abschied von Paul Gerhard verlief mit Tränen ab. Vater und Sohn wischten sich mit Taschentüchern die Tränen von den Augen. Luise Agnes und Anna Friederike vergossen bei der Umarmung des Abschiednehmenden Tränenströme, die nicht zum Stehen kommen wollten. “Ihr werdet von mir hören!” Mit diesem Ruf aus dem Fenster des Abteils und dem winkenden rechten Arm verließ Paul Gerhard nach Anrucken der Waggons im gleitenden Anfahren des Zuges hinter der dampfausstoßenden, polternden Lokomotive den Bahnhof und mit dem Bahnhof die Heimat. Luise Agnes und Anna Friederike waren mit ihren Taschentüchern noch am Winken, als das Zugende in der perspektivischen Verkleinerung das Format der Streichholzschachtel angenommen hatte und vom winkenden Arm des Sohnes nichts mehr zu sehen war. Dennoch standen sie auf dem Bahnsteig länger zusammen und schwiegen, weil es unfassbar war, dass der Abschied mit der körperlichen Umarmung so schnell und unwiderruflich verlaufen war, als wäre es ein Traum, dass Paul Gerhard noch neben ihnen stand und in seiner Umarmung verharrte und der Mutter sagte: Ich gehe nicht, ich bleibe bei dir.