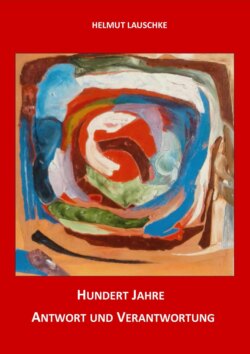Читать книгу Hundert Jahre - Antwort und Verantwortung - Helmut Lauschke - Страница 8
Trauernachricht und das missglückte Gespräch
ОглавлениеDem Sonntag folgten der Montag und der Dienstag. Erst am Mittwochnachmittag riss die Wolkendecke über der Stadt auf. Dennoch hatte es die Sonne schwer, ihre langersehnten Strahlen bis auf die Dächer der Häuser und auf die Straßen, die vom langen Regen gründlich verschmiert waren, zu schicken. Der Wetterwechsel zum Besseren gab Luise Agnes Anlass, die Wäsche zu waschen und den Hausputz zu halten. Sie begann mit der Wäsche, von der sie die Weißwäsche in einem Kessel, dem Beulen und dunkle Flecken vom Gebrauch durch vorangegangene Generationen anhafteten, im Keller kochte, die wenige Buntwäsche dagegen im Warmwasser über der Badewanne wusch. Sie hängte die Wäsche zum Trocknen über die drei, im schmalen Hinterhof gezogenen Leinen, als der Postmann den Klingelgriff an der Tür drehte, wartete, und weil Luise Agnes auf den Klingelton nicht reagierte, weil sie im Hinterhof mit dem Aufhängen der Wäsche beschäftigt war, die Post durch den schmalen Postschlitz in den Flur warf. Luise Agnes war mit ihren Gedanken halb bei der Wäsche und halb bei den Existenzfragen der Dorfbrunners, die in einigen Monaten den ersten Zuwachs bekommen und eine Familie werden würde. So wie der verhangene Himmel der letzten Tage und Wochen mit der aufs Gemüt drückenden dunklen Wolkendecke war auch die Zukunft verhangen, die noch stärker als die Wolken mit dem kalten Regen aufs Gemüt drückte. Ein Fernblick war unmöglich, und im Nahblick sah es düster aus.
Zu diesen Erschwernissen, die den Alltag hartnäckig begleiteten, kam die berufliche Situation ihres Mannes als Pfarrer im Probejahr hinzu. Sie spürte es täglich mehr, dass ihr Mann an dieser Auflage schwer trug, weil er sich Sorgen machte, und die Sorgen waren mehr als berechtigt, wie er seine unterwegs befindliche Familie kleiden und ernähren sollte, wenn sie auch bezüglich der Kleidung durch eigene Näh- und andere Handarbeiten die Kosten zu senken beabsichtigte, soweit es ihr möglich war. Doch einen Herrenanzug nähen, das konnte sie nicht; dafür fehlte ihr die ganze Erfahrung. Sie würde sich beim Maßschneiden des Tuches vertun, was teuer zu stehen käme. Warum legte Konsistorialrat Braunfelder ihrem Mann ein ganzes Probejahr auf, und das zum halben Monatsgehalt? Er wusste doch, das Eckhard Hieronymus jung verheiratet war, wo mit einer Schwangerschaft gerechnet werden konnte. Der Konsistorialrat hatte gesagt, dass er ihren Mann an der Predigt messen wolle, für die er ihm das 8. Kapitel des 1. Korintherbriefes vorgegeben hatte. Er hatte dann die Predigt gehört, von der andere sagten, dass es die beste Predigt seit Monaten, oder wie Küster Krause sagte, die beste Predigt seit siebzehn Jahren gewesen war. Hatte Eckhard Hieronymus durch seine Predigt nicht genug unter Beweis gestellt, dass er das Zeug zum Pfarrer hatte und die Sprache in seiner Exegese über den Durchschnitt hinausging? Welchen Maßstab noch wollte denn der Konsistorialrat an die Predigt legen, womit wollte er sie messen? In der Sakristei sagte er kein Wort. Das bedrückte nicht nur Eckhard Hieronymus, der mit Idealismus und Glauben an seinen Beruf herangeht, sondern auch seine junge Frau, die beim Wäscheaufhängen bei der Zukunft war, sich abmühte, tiefer in sie einzudringen, was ihr aber nicht möglich war, weil es zu viele unbekannte Faktoren gab, die wie kleine Sprengsätze durcheinanderwirbelten, um ein Bild zu ergeben, das nicht nur geschlossen, sondern auch positiv und praktisch ins Alltagsleben umsetzbar war.
Sie ging in die Küche, um zu schauen, ob Gemüse und Kartoffeln fürs Mittagessen langten. Sie sah die verstreute Postsendung auf dem Flurboden, hob sie auf und erschrak, als ein schwarz umrandeter Briefumschlag dabei war. Als sie die Handschrift ihres Schwiegervaters, des Oberstudienrates Georg Wilhelm Dorfbrunners, erkannte, der die Anschrift mit dem Füllfederhalter pedantisch ordentlich geschrieben hatte, die dann vom Regen wieder verschmiert wurde, fühlte Luise Agnes, wie der Blitz des Schicksals auf sie einschlug. Ihr wurde schwarz vor Augen, und dem momentan aufkommenden Schwächeanfall war sie nicht gewachsen; mit letzter Kraft stemmte sie sich gegen die Wand, ging an der Wand entlang bis zur Küchentür und stürzte auf den letzten zwei Metern in der Küche, die sie ohne Wand bis zum nächsten Stuhl nehmen musste, auf den Boden. Sie hatte die Rückenlehne des Stuhles schon gegriffen, den sie beim Sturz mit nach unten riss. Wie lange sie in der Küche lag, das wusste sie nicht, als Eckhard Hieronymus kurz nach zwölf zurückkam, den normalen Weg durch die Eingangstür nahm, die über Tag nicht abgeschlossen wurde, und seinen üblichen Weg zur Küche weiter nahm, als auch er zutiefst erschrak, als er seine Frau am Boden liegen sah. Er glaubte, dass der Sturz Folge eines Schwächeanfalls aufgrund der Schwangerschaft war, die ja mit solchen Anfällen nicht selten einhergeht. Er beugte sich über seine Frau, deren Augen offenstanden, schaute auf ihren Brustkorb, um etwas über die Atmung zu erfahren, hielt seine Hand unter ihre Nase, um sich die Luft ihrer Ausatmung über die Hand streichen zu lassen, schaute in die Pupillen, die eng waren, und bemühte sich aufs Äusserste besorgt durch sanfte Klapse auf die Wangen seine Frau ins Dasein in der Wagengasse 7 zurückzuholen. Gott sei Dank stand ihr kein Schaum vor dem Mund, stellte er wie ein halber Mediziner fest, der sich mit der Wiederbelebung eines so sehr geliebten Menschen abmühte. Er betete zum lieben Gott, dass er seine liebe Frau mit dem Baby im Bauch zu ihm zurückbringen möge. Es war ein tiefes Gebet, dass die normalen Feste sprengte, als gäbe es nichts, an dem sich der Mensch im Leben sonst, wenn nicht im Glauben, festhalten könne.
Sein Gebet wurde erhört, und bei Luise Agnes kehrte das Bewusstsein ein. Sie schaute mit ihren großen braunen Augen in das besorgte Gesicht des über ihr gebeugten Ehemannes und strich ihm mit kraftlosen Händen über die Wangen. So kehrte Eckhard Hieronymus aus seinem Gebet zur dringenden Hilfe zurück, fasste ihre Hand, führte sie vor seinen Mund und küsste sie. Er hielt ihre Hand fest, beugte sich tief über ihr Gesicht und küsste ihre Stirn. In Luise Agnes war das Bewusstsein soweit wieder zurückgekehrt, dass ihr klar wurde, dass sie am Boden in der Küche lag. Den umgekippten Stuhl hatte Eckhard Hieronymus bereits an seinen Platz zurückgestellt. "Bist du schon lange hier?", fragte Luise Agnes mit der Blässe des Schreckens im Gesicht. "Nicht lange, aber schon eine Weile", antwortete er und küsste ihre Hand. "Wie spät ist es denn?" "Die Glocke hatte die erste Nachmittagsstunde vor einigen Minuten geschlagen", sagte er. "Wie, solange liege ich hier in der Küche?", sagte sie mit bebender Stimme. "Was ist denn passiert, dass du ohnmächtig geworden bist?", fragte nun Eckhard Hieronymus, der den Unfall mit dem Sturz noch auf die Umstände der Schwangerschaft zurückführte. Luise Agnes fing an zu weinen, sie weinte herzzerreißend. Eckhard Hieronymus versuchte sie zu trösten, doch vergeblich war sein Bemühen. "Sag doch, was ist passiert; wer hat dir diesen Schmerz zugefügt? Du bist ja ganz aus der Fassung!" Luise Agnes schwieg und weinte.
Da richtete Eckhard Hieronymus den Oberkörper seiner jungen Frau auf, setzte sich zu ihr auf den Boden, nahm sie in die Arme und drückte ihren Kopf an seine Brust. "Ach, das so etwas passieren musste", das waren ihre ersten Worte. "Was musste denn passieren?", fragte er im Zustand der Verzweiflung, dass er sie nicht trösten konnte. "Siehst du nicht den Brief?" "Was für ein Brief?" "Den Brief vom Vater." Er schaute den Boden ab. Da lagen nur der Schlesische Anzeiger und ein Brief vom Konsistorium. "Ich sehe keinen Brief vom Vater", sagte er nun im Zustand aufkommender Erregung. "Vielleicht liegt er unter mir", meinte Luise Agnes und drehte ihren Körper zur rechten Seite. Nun sah Eckhard Hieronymus den schwarz umrandeten Briefumschlag, auf dem der Regen den Namen der Anschrift verwaschen hatte, die in gotischer Schönschrift mit dem Füllfederhalter geschrieben war. Es war die Handschrift des Vaters, dass nun auch Eckhard Hieronymus erschrak. Er schob sich auf dem Boden bis zur Wand, zog den angelehnten Körper von Luise Agnes mit, lehnte seinen Rücken gegen die Wand und hielt ihren Körper an sich gelehnt.
Er betrachtete den Umschlag von vorn, dann von hinten, wo der Absender mit den zittrigen, gotischen Schriftzügen gut zu lesen war. Mit einem Bleistift, den er sich aus der Brusttasche holte, öffnete er den Umschlag und zog den zweifach gefalteten, schwarz umrandeten Brief heraus. Luise Agnes, die wieder bei vollem Bewusstsein war, beobachtete aufmerksam, wenn auch hilflos und schluchzend, die feierliche Prozedur des Auffaltens der im DIN-A4-Format gehaltenen Ankündigung mit dem Trauerrand, achtete darauf, wie Eckhard Hieronymus den Brief in den Händen hielt, wobei ihr das feine Zittern seiner Finger nicht entging, als er den Brief entfaltete. Auf dem Boden sitzend, mit ihrem Körper an seinen gelehnt und mit beiden Rücken gegen die Wand sahen beide zur gleichen Zeit auf das in zittriger, gotischer Schrift Abgefasste. Beide versuchten das Abgefasste als unwirklich zu erklären, ja zu verdrängen, was sich nicht verdrängen ließ, so dass es schließlich die bestürzende Erkenntnis vor der unabwendbaren Wirklichkeit war, die beide zur gleichen Zeit zum Schweigen und Fürchten vor dem Unfassbaren, dem Unwiderruflichen und Unwiederbringlichen brachte. Das Staunen erreichte rasch die kosmische Dimension, während die Finger von Eckhard Hieronymus nicht aufhören wollten zu zittern.
"Liebe Kinder! In tiefer Trauer teilen wir Euch mit, dass unser lieber Sohn, Hans Matthias, nicht mehr unter uns weilt. Er hat sein Leben an der Front für das Vaterland hingegeben. Für uns ist es unfassbar. Doch auch das müssen wir hinnehmen. Wir haben dem Schicksal nichts entgegenzusetzen.
In Liebe, Eure Eltern"
Mehr hatte Vater Georg Wilhelm Dorfbrunner nicht geschrieben. Es war wenig und doch ungeheuer viel. Eckhard Hieronymus hielt den Brief vor sich. Das Zittern der Hände kam nicht zur Ruh. Er und Luise Agnes lasen die Zeilen wieder und wieder und konnten sie nicht weglesen. Aus den wenigen Zeilen lasen beide den Lebensroman eines jungen, hoffnungsvollen Menschen, der es mit dem Leben nicht weiter gebracht hatte, als mit sich seine Begabungen und Hoffnungen an der Front zu begraben. Der Lebensroman des Hans Matthias Dorfbrunner würde ein ganzes Buch füllen, wie es die Lebensromane anderer junger Menschen tun würden, die das gleiche Schicksal aus dem Leben riss. Man musste schon das Leben des jungen Menschen kennen, um aus den wenigen Briefzeilen die Fülle und das Gewicht des Verlustes herauszulesen und im Nachhinein zu begreifen, wofür im Buch viele Kapitel zu lesen und noch mehr Seiten umzublättern wären.
So saßen Eckhard Hieronymus und Luise Agnes, die sich wieder im Griff hatte, fast eine Stunde auf dem Boden in der Küche, mit den Rücken gegen die Wand, und ließen ihre Blicke wieder und wieder über die Briefzeilen fahren. Es verstrich eine Zeit, in der unter anderen, günstigeren Gegebenheiten in ein Buch weit hinein gelesen werden konnte, solange die Nachricht vom Tode eines geliebten Menschen einen nicht persönlich betraf. "Die armen Eltern, dass sie das noch erleiden müssen", sagte Eckhard Hieronymus. Er erhob sich und half seiner jungen Frau auf, die sich vom Schreck noch nicht erholt und ein verweintes Gesicht hatte. Sie setzten sich an den kleinen Küchentisch, legten den entfalteten Brief darauf, den Umschlag daneben und konnten sich in der Betroffenheit, die für sie unbeschreiblich war, mit Worten kaum verständigen, weil ihnen diese Nachricht die Sprache verschlagen hatte. So saßen sie bald eine weitere Stunde in der Küche, saßen sich am kleinen Tisch gegenüber, hatten sich in Gedanken verloren, jeder auf seine Art, versuchten vielleicht Worte zu finden, die der traurigen Größe des Ereignisses vielleicht gerecht werden konnten, schwiegen aber bis auf Laute des Schluchzens und Aufstöhnens, Laute also, die von einer geordneten Sprechweise weit entfernt waren, weil sie auf den geheimen wie offenen Gedankenwegen erkennen mussten, dass so ein Ereignis die schlimme Tatsache ist, deren Nachvollzug keines Alltagswortes mehr bedurfte.
Die kleine Glocke vom Turm der Elisabethkirche hatte die drei Schläge getan. Keiner sprach vom Mittagessen. Als sich die Tatsache für beide als unabänderlich erwies, weil sie kein Mensch ändern konnte, kehrte Luise Agnes langsam zum Tagesgeschehen zurück. Es fiel ihr ein, dass noch Wäsche aufzuhängen war. Sie bat ihren Mann, ihr dabei zu helfen, damit die letzten Sonnenstunden noch genutzt wurden. Eckhard Hieronymus brachte den Korb mit der Nasswäsche aus dem Keller, dann die Schüssel mit der nassen Buntwäsche aus dem Bad, während Luise Agnes die Wäsche nicht so ordentlich wie sonst aufhängte und die Klammern aufsteckte, weil sie mit ihren Gedanken nicht beim Wäschehängen war. Nachdem diese Sache erledigt war, die Sonne noch schien, aber nicht mehr so stark wie am späten Vormittag, gingen beide zur Küche zurück, sahen mit innerem Entsetzen auf den Küchentisch mit dem schwarz umränderten Brief, machten sich mit jedem Blick dorthin klar, dass sie weder Hans Matthias lebendig machen noch sonst etwas ändern konnten. "Ich mach uns einen Tee", sagte Luise Agnes mit heiserer Stimme. Eckhard Hieronymus stimmte dem Vorschlag zu und empfand diese Äußerung als einen ersten Hinweis, dass seine Frau zu den Anforderungen des Tages zurückkehrte.
Er setzte sich an den kleinen Küchentisch und sah aus dem Fenster, sah, wie sich die späten Sonnenstrahlen im Fensterglas spiegelten. Luise Agnes kam mit dem aufgebrühten Tee und goss die Tassen dreiviertel voll. Nun war es Eckhard Hieronymus, der den Zucker in die Tassen gab und einrührte. Sie saßen sich mit traurigen Blicken gegenüber und wussten nicht recht, wie sie zum Gespräch zurückfinden konnten. Denn am Vormittag hatte er den Termin beim Schneider Stein wahrgenommen, den Luise Agnes vor Wochen arrangiert hatte, weil der dunkle Anzug überfällig war, wenn ihr Mann die Besuche in der Gemeinde machte. Beide fühlten, dass nun über den Anzug und das zu sprechen, was Schneider Stein in der ersten Sitzung an Vermessungsarbeiten durchgeführt hatte, fehl am Platze war. Eckhard Hieronymus kreiste mit den Gedanken weiter um den Briefumschlag mit der Trauermeldung. "Wie wird es wohl Mutter gehen? Vater schrieb doch im letzten Brief, dass sie grau und hager geworden sei, weder den Appetit noch den Schlaf findet, weil sie sich in den Sorgen um ihre Familie verzehrt." Luise Agnes starrte auf den Umschlag mit dem schwarzen Rand und wusste keine Antwort. "Was meinst du", fuhr Eckhard Hieronymus fort, "wäre es nicht angebracht, die Eltern zu besuchen?" Sie nahm das gesprochene Wort auf: "Angebracht wäre es wohl. Das Problem ist nun der Konsistorialrat, ob er einem Kurzurlaub zustimmt, oder nicht. Hinzu kommt, dass wir das Geld für die Reise vom Angesparten für den Anzug nehmen müssten." Eckhard Hieronymus zog die Stirn in Falten und spannte die Lippen, wie er es machte, wenn existentielle Probleme im Anzug sind. "Dann können wir nicht fahren", meinte er, "wenn wir das Geld zur Fahrt nicht haben."
Luise Agnes, die die Bedeutung eines Besuch bei ihren Schwiegereltern genauso sah wie ihr Mann bei seinen Eltern, versuchte eine Lösung zu finden: "Wie wäre es, wenn du allein fahren würdest, dann wären die Kosten nur halb so groß und du könntest den Konsistorialrat fragen, ob das Pfarramt dir einen Vorschuss gewähren kann, dass du deine Eltern in dieser schweren Zeit besuchen kannst." Eckhard Hieronymus machte ein bekümmertes Gesicht. Die Gründe der Bekümmernis waren zum einen, dass er seine Frau in der Schwangerschaft ungern allein lassen würde, zum andern, dass, um die Reise realisieren zu können, auf die mühsam ersparten Reserven zurückgegriffen werden müsste. Er wollte seine Ehe auf der Schwelle zur Familie nicht noch in eine existentielle Bedrängnis bringen, aus der es dann vielleicht keine Erholung gibt. "Es ist schon ein Jammer, dass mir ein ganzes Probejahr zum halben Gehalt aufgebrummt wurde", sagte er mit unverkennbarer Verbitterung. "Können wir daran etwas ändern?", fragte Luise Agnes mehr rhetorisch als praktisch, weil sie die Antwort wusste. "Nein, ändern können wir daran nichts", bestätigte ihr Eckhard Hieronymus. Zum Geldproblem kam die Frage nach der Vertretung für den Gottesdienst, die Bibelstunde und die anderen Verpflichtungen hinzu. Es war unklar, ob sich Pfarrer Altmann, der am Totensonntag mit einer fiebrigen Grippe im Bett lag, wie es Küster Krause gesagt hatte, mittlerweile soweit wieder hergestellt war, dass er diese Vertretungen übernehmen kann. Immerhin standen in den nächsten Tagen zwei Beerdigungen und am kommenden Sonntag drei Taufen und eine Trauung an. Luise Agnes schüttete den Tee nach und rührte, wie sie es immer tat, in beiden Tassen den Zucker ein. "Auch wenn die Eltern einen Besuch als Trost empfinden würden, sie würden es nicht wollen, wenn wir für die Fahrt an die letzte Reserve gehen", sagte Eckhard Hieronymus mit dem Wackelton der fünfzigprozentigen Sicherheit. "Lass uns abwarten und weiter nachdenken", sagte Luise Agnes, "wir habe eine ganze Nacht zum Überlegen Zeit." Sie stand auf, ging zum Hinterhof, kam mit der ersten Trockenwäsche zurück, die sie auf den dritten Stuhl am Küchentisch legte und sich ans Bügeln mit dem schweren Bügeleisen aus Großmutters Zeiten machte, das ihr ihre Eltern mitgegeben hatten. Eckhard Hieronymus sah seiner Frau eine Weile zu und beschwor sich selbst, diese liebe Frau nicht in Bedrängnis zu bringen, weder mit dem Gefühl noch mit dem Geld.
Sie hatten eine Nacht hinter sich, in der des toten Bruders und der leidenden Eltern gedacht wurde. Erst in den frühen Morgenstunden gab es etwas Schlaf. Eckhard Hieronymus wachte gegen sechs auf und hielt den Kopf seiner Frau im Arm. Sie atmete ruhig; ihr Gesicht hatte die weichen Züge, die er so sehr an ihr liebte. Sie musste in der Nacht geweint haben, denn in den Lidspalten und neben den Nasenflügeln hatten sich die getrockneten Tränen verkrustet. Er küsste sie auf Stirn und Wange und lag wach im Bett. Draußen war es noch dunkel, als er den Kopf seiner Frau aus seinem Arm nahm und ihm das Kopfkissen vorsichtig unterschob. Er stieg aus dem Bett, ging in sein kleines Arbeitszimmer, knipste die kleine Tischlampe an und las im Brief an die Hebräer das 5. und 6. Kapitel. Daran schloss sich das Gebet an, in dem er Gott um seine Hilfe für die Menschen in Not bat, zu denen er seine Eltern und seinen Bruder Friedrich Joachim zählte. Von diesem Bruder hat es keine Nachricht mehr gegeben. Eckhard Hieronymus bat Gott, diesem Bruder, der vier Jahre jünger war als er, mit dem Leben zu verschonen und ihn bald heimkehren zu lassen. Er knipste das Licht aus, fand Luise Agnes in einem tiefen Schlaf, ging ins Bad, um sich zu rasieren und in der Wanne zu brausen, wofür aus Gründen der Sparsamkeit das kalte Wasser genügte.
Eckhard Hieronymus ließ sich Zeit, besonders beim Rasieren, um sich nicht zu schneiden, weil er mit großer Wahrscheinlichkeit den Gang zum Konsistorialrat nehmen werde, so war es jedenfalls in der Nacht besprochen worden, um ihn um Erlaubnis und einen Vorschuss zu bitten, damit er seine Eltern in Breslau besuchen könne. Er ließ das Licht im Badezimmer an und die Badezimmertür offen, als er sich, ohne das Licht im Schlafzimmer anzumachen, frische Unterwäsche, Socken und ein frisches Hemd aus dem Schrank holte. Beim Zuknöpfen des Hemdes hatte er sich mehr als einmal in der Knopfreihe vertan, so dass er das Hemd zweimal auf- und dreimal zuknöpfte. Bei den Socken gab es das Problem der Verwechselung, worauf ihn später Luise Agnes aufmerksam machte, als er rechts eine schwarze und links eine dunkelblaue Socke trug. Aus Anlass des Tages entschied er sich für die schwarzen Socken und wechselte die blaue aus. Die Entscheidung, die in der Nacht getroffen wurde, dass Eckhard Hieronymus die Reise zu seinen Eltern aus Kostengründen allein machen sollte, wurde am Frühstückstisch beibehalten und bezüglich der Durchführbarkeit noch einmal erörtert. "Geh zum Konsistorialrat", sagte Luise Agnes, "und frag ihn. Ich denke, wenn du ihm die Situation schilderst, wird er Verständnis zeigen und sich der Not nicht verschließen." Der Brief mit der traurigen Mitteilung lag auf dem Tisch und die Gedanken waren bei den leidenden Eltern. "Ich werde den Brief mitnehmen", sagte Eckhard Hieronymus; er meinte, dass ihm beim Konsistorialrat nun doch der Zweifel am guten Willen und der Hilfsbereitschaft aufkomme.
Gegen zehn machte er sich auf den Weg. Luise Agnes wollte sich an die Wäsche machen, die sie tags zuvor vernachlässigt hatte. Sie wünschte ihrem Mann die Portion Glück, die er für sein Vorhaben brauchte. Er ging die Wagengasse, eine kurze Gasse mit den alten, renovierungsbedürftigen Häusern zu beiden Seiten in Richtung Stadt und bog nach etwa dreihundtert Metern rechts in die Grabenstraße ein. Dort begegneten ihm Leute, meist Frauen im mittleren Alter, die ihn seit dem Gottesdienst vom Totensonntag kannten und freundlich grüßten. Auch Kinder liefen in beiden Richtungen an ihm vorbei, jedoch ohne von dem jungen Pfarrer im schwarzen Mantel Notiz zu nehmen. In der Grabenstraße, einer breiten Straße, in der die bessergestellten Familien der Verwaltungsleute wohnten, ging er an größeren, ordentlich verputzten Häusern mit den größeren, gepflegten Vorgärten vorbei. In einigen Vorgärten standen schmucke Gartenlauben unter alten Kastanienbäumen, vor denen bunt bemalte Zwerge aufgestellt waren, die mit roter Zipfelmütze über weit geöffneten Augen, grüner Jacke und Hose in braunen Zwergenschuhen steckten und mit großem, hoch gehaltenen Zeigefinger sich die Achtung der Größeren ohne Mienenwechsel oder sonstiger Bewegung verschafften. Von der Grabenstraße ging es dann links ab in die Marktstraße, die nach fünfhundert Metern zum Kirchplatz führte. Eckhard Hieronymus ging erst zum Hauptportal der Elisabethkirche, um den Anschlag mit den Ankündigungen für die nächsten zwei Wochen zu lesen, der neben dem Eingang hinter dem verschlossenen Glasdeckel in einem Holzkästchen angeheftet war. Da las er, was er schon wusste, vom Gottesdienst zum 1. Advent, der laut Ankündigung von Pfarrer Altmann gehalten wird, dem Taufgottesdienst und der Trauung. Auch war ein Trauergottesdienst für den verstorbenen Geschäftsmann Harald Boschkewitz für den kommenden Samstag, elf Uhr, vorgesehen. Boschkewitz, dessen Eisenwarenhandlung von seinem Sohn Ewald Boschkewitz fortgeführt wird, war ein bekannter Bürger der Stadt, der der Kirche einige namhafte Spenden zukommen ließ, und dem es zu verdanken war, dass die kleine Turmglocke nicht wie ihre beiden größeren Schwestern für Kriegszwecke eingeschmolzen wurde.
Eckhard Hieronymus ging nun quer über den Kirchplatz auf das gepflegte, tadellos und weiß verputzte Bürgerhaus des Konsistorialrates Braunfelder zu. Im geräumigen Vorgarten mit dem alten Nussbaum und den zwei, nicht jünger erscheinenden, dickstämmigen Kastanienbäumen war ein hagerer Mann, der zwischen vierzig und fünfzig sein mochte, mit dem Zusammenrechen des Herbstlaubes beschäftigt. Sein etwas verhärmtes Gesicht mit den dunkelbraunen Augen und dem noch vollen Haar mit den frühen grauen Strähnen war Eckhard Hieronymus vom letzten Gottesdienst her bekannt, als er beim Verlassen der Kirche den Pfarrer freundlich zurückgrüßte, ihm auch die Hand geben wollte, aber nicht konnte, weil eine ältere Frau vor ihm die Hand des Pfarrers übergebührlich lange in ihrer Hand hielt, den Pfarrer sozusagen festhielt. Der Gärtner sah ihn kommen, als er noch die Bahnhofstraße vom Kirchplatz her überquerte, und grüßte ihn durch den erhöhten, eisernen Gitterzaun. "Guten Morgen, Herr Pfarrer!" Eckhard Hieronymus kannte seinen Namen nicht und beschränkte sich deshalb auf das Guten Morgen. "Sie wollen sicherlich zum Herrn Konsistorialrat." "Das ist richtig." "Warten Sie, ich will schauen, ob er schon im Büro ist." "Danke, das ist sehr freundlich von ihnen." Eckhard Hieronymus stand auf dem Bürgersteig vor dem halb offen stehenden Tor des gut zehn Meter langen Zuganges zur geschlossenen Haustür. Er wartete und wartete, prüfte die Zeit nach Öffnen des Klappdeckels auf seiner eisernen Taschenuhr; es war dreiviertel elf, so sagte man in Schlesien, wenn das letzte Viertel zur vollen Stunde noch fehlte. Es dauerte lange, bis der freundliche Gärtner zurückkam und mitteilte, dass der Herr Konsistorialrat noch nicht in seinem Büro sei, andererseits wichtige Dinge in seiner Wohnung erledige, die keinen Aufschub dulden. "Der Herr Konsistorialrat bittet deshalb um etwas Geduld, er wird sobald wie möglich bei Ihnen sein." Eckhard Hieronymus nahm vom Gittertor einen Blick zur Kirche, schaute den Turm hoch bis zur Spitze, dann drehte er sich dem geräumigen Vorgarten zu, um die Aufräumungsarbeit des Gärtners zu verfolgen. Nachdem er das einige Male wiederholt hatte und seinen Blick auch in beide Richtungen der Bahnhofstraße schickte, schlug die kleine Kirchturmglocke die elf Schläge zur vollen Stunde, der letzten am Donnerstagvormittag.
Der Gärtner hatte den Großteil der Vorgartens vom gefallenen Herbstlaub gesäubert, das er zu einem riesigen Haufen zusammengerecht hatte. Doch der Konsistorialrat ließ sich nicht blicken, und der Gärtner, dem die sympathischen Züge des arbeitenden, bodenständigen Menschen auf dem Gesicht lagen, schickte dem wartenden Pfarrer am halb offen stehenden Gittertor das Gesicht des Bedauerns. Ob der Konsistorialrat sich heute nicht sprechen lassen wolle, ob er etwas gegen ihn, den Pfarrer auf Probe, Eckhard Hieronymus Dorfbrunner, habe, das waren Gedanken, die im Kopf des wartenden Pfarrers hin und her gingen, oder wie wellende Wasser hin und her schwappten, ohne das Rätsel zu lösen. Nun kam der Gärtner und entschuldigte sich, dass der Herr Pfarrer solange warten muss. "Sie brauchen sich dafür nicht zu entschuldigen, denn das ist alles andere als ihre Schuld", wehrte Eckhard Hieronymus dankend diese Entschuldigung ab. "Ich werde noch einmal nach ihm schauen", sagte der Gärtner, "vielleicht hat sie der Herr Konsistorialrat vergessen. Bei seiner Überlastung wäre das kein Wunder." Er verschwand im Haus und brauchte wieder eine lange Zeit, bis er herauskam, die Eingangstüre leise hinter sich schloss und auf den wartenden Pfarrer zuging. Der Gärtner lächelte, als er ihm mitteilte, dass der Herr Konsistorialrat den Herrn Pfarrer nicht vergessen habe und jeden Augenblick erscheinen werde. "Ich danke ihnen", sagte Eckhard Hieronymus mit etwas belegter Stimme, holte die Taschenuhr hervor, klappte den Deckel auf und las die Zeit: zwanzig Minuten nach elf; er klappte den Deckel zu und steckte die Uhr in die Westentasche zurück.
Die Haustür ging auf, und die untersetzte Gestalt mit dem metallnen Brustkreuz trat vor die Tür. "Ach Sie sind es, Herr Dorfbrunner; wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Sie nicht warten lassen." Das Wort "solange" hatte der Konsistorialrat nicht vor das Wort "warten" gesetzt, als hätte es sich nur um einige Minuten gehandelt. Der Gärtner, der das hörte, schaute dem jungen Pfarrer vor dem halb offen stehenden Gittertor perplex an und schüttelte ungläubig mit dem Kopf. "Kommen Sie doch herein!" Der Konsistorialrat bewegte sich von der Haustür nicht weg, ging Pfarrer Dorfbrunner nicht entgegen, der nun das Gittertor passierte, hinter sich schloss und die gut zehn Meter auf den Konsistorialrat zu ging, der wie eine verkürzte Säule vor dem Eingang stand und mit seiner rechten Hand über das Brustkreuz strich. Er reichte dem jungen Pfarrer, ohne ihm dabei ins Gesicht zu sehen, die Hand mit dem weichen Händedruck, den Eckhard Hieronymus von Jugend an verabscheute, weil sein Vater, der Oberstudienrat Georg Wilhelm Dorfbrunner, immer wieder seine Söhne zum ordentlichen Handgeben angehalten hat, der bei den Männern eindeutig und fest sein sollte. "Kommen Sie, wir gehen gleich in mein Büro." Der Konsistorialrat ging im Parterreflur voraus, betrat als erster das Büro, schloss die Fenster, die offensichtlich zum morgendlichen Lüften geöffnet worden waren, und setzte sich in den bequemen, hochlehnigen Schreibtischstuhl hinter dem überproportional großen Schreibtisch mit der polierten Holzplatte. Eckhard Hieronymus folgte ihm mit dem schlechten Gefühl im Magen und setzte sich auf einen der beiden harten Stühle auf der anderen Seite des Schreibtisches, also dem Konsistorialrat gegenüber, der das hängende metallne Brustkreuz nicht aus der Hand ließ, als hätte er das Kreuz besonders lieb, oder das Kreuz hätte eine noch andere kraftspendende Bedeutung, die an einen Fetisch denken ließ. Von dem, was der Gärtner von der Überlastung sagte, war auf der leeren, staubfrei polierten Schreibtischplatte keine Spur zu sehen. Außer der Schreibunterlage in lederner Einfassung, dem in rotem Kunstleder gebundenen Terminbuch mit der goldfarben eingedruckten Jahreszahl 1918, dem diagonal auf dem Terminbuch liegenden Füllfederhalter und dem leeren Ständer für das teure Schreibgerät lag auf dem Tisch nichts, was nach Arbeit aussah. Auf dem Schreibtisch gab es weder ein beschriebenes noch ein unbeschriebens Blatt.
"Was führt Sie zu mir, Herr Dorfbrunner?" Da konnte man in der Spekulation weit ausholen. Eckhard Hieronymus zog den Brief mit der schwarzen Umrandung aus der Brusttasche und hielt ihn dem Konsistorialrat entgegen. Er hatte mit dem Brief in der Hand die Mitte der Schmalseite des Schreibtisches erreicht und hatte Hemmung, die andere Tischhälfte, über die die Hand des Konsistorialrates entgegenzukommen hatte, mit dem Brief zu überqueren. Doch die Hand kam nicht entgegen, sie ruhte mit den kurzen dicken Fingern auf dem metallnen Brustkreuz. Da sich der Konsistorialrat mit der Handreichung, anders als erwartet, zurückhielt und bei seinem Kreuz blieb, legte ihm Eckhard Hieronymus den Brief seines Vaters auf den Schreibtisch, bis an die Schreibunterlage heran, und sagte ihm den Inhalt des Briefes voraus, weil er mit der Hand einfach zögerte, an den Umschlag heranzugehen, ihn zu fassen, den Brief aus dem Umschlag herauszuziehen, zu entfalten und ihn zu lesen. "Mein Bruder Hans Matthias ist gefallen. Spät erreichte die Nachricht meine Eltern, und gestern erhielt ich den Brief." Der Konsistorialrat hielt die Schreibunterlage in seinem Blick fest: "da darf ich Ihnen mein tief empfundenes Beileid aussprechen." "Vielen Dank, Herr Konsistorialrat", erwiderte Eckhard Hieronymus und sagte: "Meinen Eltern geht es schlecht", der Rat unterbrach mit: "Das kann ich mir vorstellen". Eckhard Hieronymus setzte den Satz fort: "die Ungewissheit nach dem Schicksal meiner Brüder hat sie in hohem Maße verzehrt. Nun erschlägt sie die Nachricht eines ihrer Söhne."
"Wie meinen sie das, die Nachricht erschlägt ihre Eltern?", fragte der Rat in vorgehaltener Naivität. "Verstehen sie, Herr Konsistorialrat, meine Eltern sind am Ende ihrer Kräfte angekommen." "Aber ihre Eltern, Gott sei es gedankt, leben doch noch", begann der Rat sein Wortspiel. Eckhard Hieronymus, sah die Herausforderung, die er letzte Nacht im Bett kommen sah, "ich meine, die Eltern sind am Ende ihrer physischen Kräfte angekommen." "Ist es wirklich so?" "Es ist so schlimm, dass ich mir die ernstesten Sorgen mache." "Aber Gott behüte!" Da hörte Eckhard Hieronymus den falschen Engel sprechen, überhörte diesen Rufsatz, um durch ein Eingehen auf so einen Satz, der rhetorisch, aber kaum ehrlich gemeint war, nicht gleich zu Beginn des Gespräches ins Uferlose zu kommen. Er sah dem Konsistorialrat auf das Brustkeuz, das die kurzen fleischigen Finger weiter gefasst hielten und wie ein Stück Eisen drückten: "In Anbetracht der kritischen Lage um meine Eltern, die durch die Todesnachricht zutiefst getroffen, physisch am Boden sind, bitte ich um ihre Erlaubnis, meine Eltern in Breslau besuchen zu dürfen. Der Besuch hat umgehend zu erfolgen, wenn er nicht zu spät sein soll." Der Rat behielt die Schreibunterlage im Auge und sagte: "Herr Dorfbrunner, wollen Sie sagen, dass Sie am kommenden Samstag den Trauergottesdienst für Herrn Boschkewitz nicht halten wollen?" Eckhard Hieronymus nahm sich zusammen: "Herr Rat, von 'nicht wollen' kann hier nicht die Rede sein; das richtige Wort nach dem, was die Situation außergewöhnlich macht, wie ich Ihnen versuche, es wahrheitsgemäß zu schildern, ist 'nicht sollen', wenn Sie die kleine Richtigstellung mir erlauben."
Die erste Blässe zog auf das Ratsgesicht, ein erstes Zucken umfuhr seinen Mund. "Herr Dorfbrunner, Sie sagen, dass ihr Bruder, wie hieß er noch?" "Hans Matthias, Herr Konsistorialrat", "richtig, dass ihr Bruder Hans Matthias an der Front gefallen ist, an welcher Front, das wissen Sie nicht. Sie sagen auch, dass es ihren Eltern schlecht geht." "Jawohl Herr Konsistorialrat", fügte Eckhard Hieronymus ein, "meinen Eltern geht es gesundheitlich sehr schlecht." "Herr Dorfbrunner, ich erlaube mir zu sagen, dass mir noch keine Eltern begegnet sind, denen es nach dem Verlust des Sohnes nicht schlecht gegangen ist. Das zum einen. Zum andern erlaube ich mir zu sagen, Herr Dorfbrunner, dass Sie erst vor ein paar Tagen ihren Dienst als Pfarrer an der Elisabethkirche angetreten haben. Welche Reaktion erwarten Sie von mir und von der Gemeinde?" Die kurzen dicken Finger krampften um das metallne Brustkreuz. Er fuhr fort: "Ich hoffe, dass Sie mich verstehen: Den Tod ihres Bruders, so schrecklich er ist, können Sie weder objektiv, noch subjektiv vor sich oder ihren Eltern ungeschehen machen; an dieser Tatsache kommen Sie, wie Sie sich auch drehen mögen, nicht vorbei. Mit anderen Worten, Sie können ihren Bruder nicht lebendig machen; so groß sind Sie nun doch nicht." Eckhard Hieronymus krampfte sich der Magen, weil er diesen Satz als eine Unverschämtheit begriff. Er schaute auf das Krampfen der rätischen Kurz- oder Knüppelfinger um das metallne Brustkreuz. Nun begannen die Worte des Konsistorialrates zur Rede, und die Rede zu einem schwellenden Strom zu werden, der mitreißt, was sich ihm entgegenstellt. Wieder war es so, wie es bei dem ersten Vorstellungsgespräch war, der Konsistorialrat fühlte sich zum Reden, aber nicht zum Zuhören berufen, was die Sache mit seinen Eltern immens erschwerte. Für den Rat gab es kein Halten mehr, wenn er auch nicht begriffen haben konnte, oder nicht begreifen wollte, was das eigentliche Problem war, wo des Pudels Kern lag.
"Herr Dorfbrunner", sprach der Rat nun mit gehobener Stimme, auch löste er seinen Blick aus der Anziehungskraft der Schreibunterlage heraus, "bei allem Verständnis für das Schreckliche, dass ihrer Familie widerfahren ist, und bei allem guten Willen ihnen persönlich gegenüber, stehe ich, Sie erlauben mir das Wort, skeptisch ihrem Anliegen auf einen Kurzurlaub zum Besuch ihrer Eltern gegenüber. Bedenken Sie, dass es Millionen Eltern so ergangen ist, wie es ihren Eltern nun ergeht, die Schläge des Schicksals sind unvorhersehbar und vor dem fürchterlichen Einschlag weder ablenkbar noch abwendbar oder abwehrbar. Millionen deutscher Männer und Söhne sind im Krieg gefallen. Leider haben ihre Opfer dem Vaterland keine Linderung gebracht. Sie können daran auch nichts ändern, Sie machen die Sache nur schwerer, als sie ohnehin schon ist. Es muss nun nicht noch weiter dramatisiert werden, denn es ist die allerhöchste Zeit, dass endlich Ruhe eintritt." Eckhard Hieronymus hatte bei der Schieflage der rätischen Ausführung das Bild riesiger und überfüllter Massengräber vor sich, die zugeschaufelt werden, ohne dass die Frauen von ihren Männern, die Eltern von ihren Söhnen mit einem letzten Blick Abschied nehmen, wo der Boden über die zerrissenen, verbluteten und tödlich erschöpften Körper geworfen und zu hohen, kilometerlangen Halden aufgeworfen wird, die noch nach zwei Generationen nicht einzuebnen sind. "Herr Dorfbrunner, hören Sie mir zu?" Offenbar hatte der Konsistorialrat bemerkt, dass der junge Pfarrer, dem die Blässe der Kapitulation ins Gesicht gefahren war, mit seinen Gedanken vom Redestrom abgekommen war und sich ganz woanders im Geiste bewegte. "Ich höre ihnen zu, Herr Konsistorialrat, doch wäre ich ihnen außerordentlich dankbar, wenn Sie mir einmal zuhören würden, damit Sie mein Anliegen, das das Anliegen meiner Familie ist, besser verstehen", sagte Eckhard Hieronymus. "Was sagen Sie da: besser verstehen; als hätte ich Sie nicht verstanden", der Rat begann zu schäumen. Er fuhr im Wortstrom weiter: "Die Sorge um ihre Eltern ehrt Sie. Lassen Sie sich das vom Älteren sagen, dass Sie in dieser Situation der großen Betroffenheit wenig ausrichten, aber mehr schaden können. Was ihre Eltern jetzt brauchen, ist die völlige Ruhe; nennen Sie es Grabesruhe, diese Ruhe brauchen ihre Eltern jetzt." Als ob Eckhard Hieronymus von einer abermaligen Abwesenheit zurückkehrte: "Aber Herr Rat, meine Eltern leben doch noch!" "Dann lassen Sie sie doch leben!, Herr Dorfbrunner", fauchte der Konsistorialrat mit speichelfeuchter Aussprache sein Ungehaltensein über den Tisch.
Eckhard Hieronymus, der seine Eltern tief im Herzen trug, war fassungslos, auch wenn er die Fassung nach außen behielt, nicht vom Stuhl aufstand, nicht mit der Faust auf den Tisch schlug, sich wieder hinsetzte, oder mit dem Stuhl umkippte. Er konnte einfach nicht verstehen, dass der Konsistorialrat soviel redete, ohne das Problem verstanden zu haben. Er war dazu noch eitel, wie es viele untersetzte Männer in übersetzten Posten sind. Wenn er sagte, dass er das Problem verstanden habe, dann sagte er es nur, weil er sich nicht nachsagen lassen wollte, dass er es nicht verstanden hat. Da sagte er mit Bewusstsein und aus purer Eitelkeit die Unwahrheit. Wie kann nur mit so einem Mann, der dazu noch mein Vorgesetzter ist, ein so ernstes Problem wie das vom besorgniserregenden Gesundheitszustand der Eltern besprochen werden?, fragte sich Eckhard Hieronymus, der in seinen Gedanken versunken war. Er war entsetzt über die Begriffsstutzigkeit des Konsistorialrates und seinen ungezähmten Redefluss, der am Kern der Sache völlig vorbeiging, als könnte man im Schuhgeschäft nun doch die Brötchen kaufen. Er sah ein, dass mit diesem Mann nicht zu reden war, der sich mit seinen kurzen dicken Fingern am metallnen Brustkreuz festhielt, als würde er freihändig den Halt verlieren. Er sah ihm ins Gesicht mit dem breiten Nasenrücken und den kleinen dunklen Augen. Der Wortschaum hing dem Konsistorialrat vor und zwischen den Lippen. "Meine armen Eltern", dachte er Eckhard Hieronymus im Büro dieses Rates an diesem Donnerstag kurz vor zwölf und erschrak wenige Minuten später, als die Turmglocke die Zwölf schlug. Da schoss das ungute Gefühl in ihn hinein, dass es nun zu spät sei, er mit Sicherheit zu spät komme. Die zwölf Glockenschläge, die Eckhard Hieronymus so nah und intensiv noch nicht gehört hatte, machten ihn unruhig. Er sah zum Konsistorialrat auf der anderen Seite des Schreibtisches, der "kugelsicher" und gedrungen mit dem Redeschaum nun in den Mundwinkeln im Sessel saß, dessen gepolsterte Rückenlehne seinen Kopf um einen weiteren Kopf überragte. Der Bittsteller machte sich beim bedenklichen Zustand, in dem sich seine Eltern seit dem Tod seiner Bruders Hans Matthias befanden, nichts vor; er war davon überzeugt, dass er da beim Konsistorialrat nicht übertrieb. Ob an diesem Schreibtisch über- oder untertrieben wurde, es spielte keine Rolle mehr, denn beides ging im nicht zu bremsenden Redeschwall des Rates gleicherweise unter.
Eckhard Hieronymus unternahm einen letzten Versuch, indem er eine kurze Redepause nutzte, die nur deshalb entstand, weil sich der Konsistorialrat mit dem Taschentuch den Schaum vorm Munde wegwischte und das Taschentuch mit Mühe, die seine Konzentration erforderte, in die rechte Hosentasche stopfte. Es war auch das erste Mal während der qualvollen Unterredung, dass das Burstkreuz aus der Fingerumklammerung herauskam. "Herr Konsistorialrat", setzte Eckhard Hieronymus an, "es sind meine Eltern...". "Erlauben Sie", unterbrach der Rat, "dass ich meinen Satz zu Ende führe. Wie gesagt, ihre Eltern brauchen jetzt Ruhe, da dürfen Sie nicht als Ruhestörer auftreten. Verstehen Sie mich recht, ich meine, da sollten Sie nicht in Dingen rumrühren, die, erstens nicht zu ändern sind, und zweitens als Wunden nun verheilen müssen. Es kommt jetzt auf eine schnelle Wundheilung an, der eine Störung äußerst abträglich wäre. Ich hoffe, Sie mich verstehen, Herr Dorfbrunner!" Die Namensnennung durch den Konsistorialrat, die ihn aus der wiederholten Abwesenheit zurückholte, nahm Eckhard Hieronymus zum verzweifelten Versuch, gegen den Redeschwall hart anzureden: "Ich habe Sie nicht verstanden, Herr Konsistorialrat", sagte er nun in einem fast aufsässigen Ton, "denn Sie lassen mich ja nicht nur nicht ausreden, sondern überhaupt nicht reden." "Was reden Sie da nur mit dem Nicht-ausreden-lassen", unterbrach ihn in einer wirschen Art der Rat, "das ist ja allerhand. Herr Dorfbrunner, damit können Sie mir nicht kommen, so können Sie mir nicht über den Mund fahren! Halten Sie mich denn wirklich für so dumm, dass ich Sie nicht verstanden habe?" Es trat eine Pause ein, die, wenn es nach Eckhard Hieronymus Dorfbrunner gegangen wäre, eine lange, eine unendlich lange Pause gewesen wäre.
Der Konsistorialrat kürzte die Pause ab, weil er den Fragesatz mit dem Für-dumm-halten nicht solange im ambivalenten Raum der Reflexion stehenlassen wollte, der bei längerer Betrachtung nur die anderen Vermutungen in der entgegengesetzten Richtung wecken würde. So war es eine Art Selbstverteidigung, dass er unverzüglich die Rede wieder aufnahm und den Strom zum Schwellen und zum Rauschen brachte. "Das darf Ihnen mit aller Zurückhaltung sagen, dass ich das Problem mit ihren Eltern völlig verstanden habe und dass so, wie Sie mit mir als ihrem Vorgesetzten sprechen, noch kein Geistlicher gesprochen hat, selbst wenn er bedeutend älter war, als Sie es heute sind." Eckhard Hieronymus beflügelte sofort das Bild der sitzenden, schweigenden Pfarrer vor dem großen Schreibtisch (der Inquisition) mit der großflächig polierten, leeren Schreibtischplatte und dem gedrungen und gestaucht dahinter sitzenden Konsistorialrat. Er fühlte sich in einer hoffnungslosen Position. Das Dorfbrunnersche Blut kochte in seinem Kopf. Bei dem Rat war weder Einsicht noch ein guter Wille. Er war ein "Hörloser", der sich vor dem Zuhören zu fürchten schien, sich aber im Redeschwall um so mehr gefiel, auch dann noch gefiel, wenn der Schwall an der Sache völlig vorbeiging. Denn so dumm war der Rat nicht, dass er nicht merkte, wie er sich vor der Verantwortung wegdrückte und sich am Problem vorbeiredete.
Der Konisistorialrat hatte den Satz noch nicht beendet und sicher noch viele Schwatzsätze auf Lager, dass die Rede mit den Unterbrechungen durch das Schaum-vorm-Mund-wegwischen unendlich weitergegangen wäre, wenn nicht seine Frau zum Mittagessen würde rufen lassen oder ein anderes Ereignis eintreten würde, das dem Redeschwall das Wort auf der Zunge abschneidet, als völlig unerwartet Eckhard Hieronymus Dorfbrunner sich von seinem Stuhl erhob. Das gab beim schwadronierenden Konsistorialrat den unmittelbaren Einschlag der Perplexität. Mit diesem Einschlag sprang eine seltsame Stille in den Raum, als dem Rat momentan das Wort im Halse steckenblieb. Es kam zu einer ernsthaften Luftnot mit Japsen und der gefürchteten Blauverfärbung der Lippen, die sich zur beiderseitigen Erleichterung in einen Hustenanfall hineintobte, der Minuten brauchte, bis er sich zu beruhigen begann. Nach diesen Minuten bis zur einsetzenden Ruhe nach dem verlängerten und ausgetobten Hustenanfall, dem ein hustender Tobsuchtsanfall nahezu identisch war, verabschiedete sich Eckhard Hieronymus vom verausgabten Konsistorialrat, der erschöpft mit dem Taschentuch vorm Gesicht noch kürzer als zu Beginn des erhofften Gespräches in seinem Schreibtischstuhl mit der hohen Rückenlehne hing, die nun um fast zwei Köpfe den Schwatzkopf überstieg. Eckhard Hieronymus verzichtete auf das Handgeben, denn es gab nichts, wofür er die Hand hätte geben sollen. Er verließ das Büro des Konsistorialrates, ließ die Bürotür halb offen, ging den Flur in Richtung Ausgang, nahm die Eingangstür als Ausgangstür, schloss sie hinter sich, ging die fünf Stufen herab und die zehn Meter zum Gittertor des vom Herbstlaub sauber gerechten Vorgartens. Der Gärtner mit dem freundlichen Gesicht fragte den jungen Pfarrer, ob er ein gutes Gespräch mit dem Herrn Konsistorialrat hatte, was Eckhard Hieronymus wortlos verneinte und hinter sich das Gittertor schloss. Noch beim Schließen des Tores, wobei er dem Gärtner an den Zaunstäben vorbei ins Gesicht sah, sagte er dann: es war nicht gut. Der Gärtner machte ein betroffenes Gesicht und schaute dem davongehenden Pfarrer mit diesem Gesicht noch eine Weile hinterher.
Eckhard Hieronymus, dem die leidenden Eltern am Herzen lagen, schaute beim Überqueren des Kirchplatzes, genauer vor dem Hauptportal, auf die Taschenuhr, auf der die Zeiger noch wenige Minuten bis zum Mittagessen zu gehen hatten. Er ging bedrückt nach Hause, die Markt-, dann die Grabenstraße entlang und schließlich durch die Wagengasse. Was würde Luise Agnes sagen, vielmehr denken, wenn er ihr sagt, ja sagen muss, dass das Gespräch mit dem Konsistorialrat enttäuschend war, ein Reinfall war, weil ein Gespäch, so wie es normale Menschen führen, gar nicht stattgefunden hat. Er erreichte das alte Haus mit der Nummer sieben, an dem der braune Putz an mehreren Stellen abgefallen war. Luise Agnes stand am Eingang und wartete auf ihren Mann. Sie sah ihn schon von weitem kommen, sah am Gang, dass er müde war und am Gesicht, dass es kein gutes Gespräche gewesen war. Doch wollte sie sich den Optimismus nicht gleich nehmen lassen und schenkte ihm beim Eintreten ein herzliches Lächeln. Eckhard Hieronymus küsste sie auf die Stirn, hängte den Mantel an den Garderobenständer und nahm seine Frau bei den drei oder vier Metern zur Küche an die Hand.
Der kleine Tisch war gedeckt mit den zwei Tellern, die Gabel links, das Messer rechts, die gefaltete Serviette neben der Gabel. "Das Essen ist fertig, ich hoffe, dass es dir schmecken wird", sagte Luise Agnes, bemüht, ihren Mann aufzumuntern, seine Gesichtszüge zu entspannen. Sie füllte die kleine Schale über dem Herd mit dem gebratenen Blutwurstkringel, den sie mit zwei Esslöffel heißer Fettsoße überzog. Dazu gab es gedünstete Kartoffeln, die sie in eine Schüssel tat, die mit der letzten Kartoffel aus dem Topf zur Hälfte gefüllt war, weil es nur diese Schüssel gab, die als Familienschüssel für zwei Personen zu groß ausgefallen war. Dazu gab es den aufgewärmten Gemüserest vom Vortag, die geschnipselten Bohnen und Möhrenwürfel. Luise Agnes reichte ihrem Mann zuerst die Schale, aus der er den halben Wurstkringel schnitt und auf seinen Teller legte, und aus der Schüssel mit den Kartoffeln weniger als die Hälfte und auch vom Restgemüse nur die Hälfte nahm. Luise Agnes bediente sich anschließend, nahm eine kleinere Portion, so dass noch ein kleines Stück der gebratenen Blutwurst in der Schale und noch etliche Kartoffeln in der Schüssel blieben. Vom Gemüse tat sie die restliche Hälfte auf ihren Teller. Eckhard Hieronymus sprach das Tischgebet, bei dem er der hungrigen Menschen gedachte, so hielt er es mit jedem Gebet, in dem er den lieben Gott bat, den Hungrigen doch auch zu essen zu geben. Er vergaß nicht den Dank auszusprechen, dass auf ihrem kleinen Küchentisch die Teller gefüllt waren. Sie wünschten einander einen guten Appetit und begannen zu speisen. Noch verlor Eckhard Hieronymus kein Wort über das Gespräch beim Konsistorialrat. Er muss seinen Grund für das verlängerte Schweigen haben, dachte Luise Agnes, die sich geduldete, wie es liebende Ehefrauen tun, und ihm die Zeit gab, von selbst über das Gespräch zu berichten. Dafür erzählte sie, was sie getan hatte. Sie sagte, dass sie einige Knöpfe festgenäht und die ganze Wäsche gebügelt und eingeräumt habe. "Großartig, meine Liebe, wie du das schaffst", lobte Eckhard Hieronymus seine junge Frau. Das Wasser, das Luise Agnes aufgesetzt hatte, blubberte im Topf. Sie goss das kochende Wasser in Abständen über das Teesieb, bis die Kanne voll war, der ein würzig-frisches Aroma entstieg. Dann räumte sie Teller und Bestecke, die Schale und Schüssel vom Tisch und stellte die Teetassen mit Untertassen und Teelöffeln und die Zuckerdose darauf. Sie goss die Tassen, wie sie es immer tat, dreiviertel voll, löffelte den Zucker ein und verrührte ihn. Beim Umrühren erzeugten die Löffelschläge die hellen Klänge der dünnen Porzellanwand.
"Was soll ich dir vom Gespräch beim Konsistorialrat berichten?", begann Eckhard Hieronymus, und Luise Agnes wunderte sich, dass er mit einer Frage begann, was kein gutes Zeichen war. "Sag einfach, wie es war, was ihr besprochen habt", sagte sie, um es ihm leicht zu machen. "Wie schon das Vorstellungsgespräch war auch dieses Gespräch kein Gespräch, denn der Konsistorialrat ließ mich auch diesmal nicht zu Wort kommen." "Aber er kann doch nicht reden, bevor er weiß , was du ihm zu sagen hast", meinte sie ganz folgerichtig. "Auch wenn du richtig bist, was die gute Sitte betrifft, beim Konsistorialrat Braunfelder liegst du falsch", folgerte Eckhard Hieronymus. Er fuhr fort: "Erst einmal hat er mich draußen am Tor lange warten lassen, obwohl ihn der Gärtner, der das Herbstlaub im Vorgarten zusammenrechte, von meinem Besuch in Kenntnis gesetzt hatte. Er hätte dringende Sachen in seiner Wohnung zu erledigen, die keinen Aufschub duldeten. Mit dieser Botschaft kehrte der Gärtner zurück. Im Büro sei der Konsistorialrat bis elf Uhr noch nicht gewesen. So wartete ich weiter am Gartentor, blickte den Kirchturm hoch, auf den Kirchplatz und in die Bahnhofstraße. Eine halbe Stunde war vergangen, als der Gärtner zum Rat in die Wohnung ging und ihn an mein Warten erinnerte. Schließlich erschien er auf dem Podest vor dem Eingang mit der rechten Hand am metallnen Brustkreuz und tat erstaunt, dass ich auf ihn wartete. Er sagte, ohne sich vom Podest in Richtung Gartentor zu bewegen, wenn er gewusst hätte, dass ich es war, hätte er mich nicht warten lassen. Ich ging die zehn Meter auf den Hauseingang zu, stieg die fünf Stufen zum Podest, auf dem der Rat steif wie ein Monument stand und das Brustkreuz in der rechten Hand hielt. Wir gingen zum Büro im Parterre, wo er die Fenster schloss, bedeutungsvoll um seinen großen Schreibtisch schritt, auf dem von Arbeit nichts zu sehen war, und sich im hochlehnigen Schreibtischsessel niederließ. Auf seine Frage, was mich zu ihm führe, zog ich Vaters Brief aus der Jackentasche und hielt ihn über dem Schreibtisch ihm entgegen.
Der Rat machte keinerlei Anstalt, den Brief entgegenzunehmen, hielt statt dessen mit seiner rechten Hand unbeirrt am Brustkreuz fest, während seine linke Hand die ledern eingefasste Schreibunterlage, dann das in rotem Kunstleder gebundene Terminbuch auf der Schreibunterlage, dann den teuren Füllfederhalter auf dem Terminbuch zurechtrückte. So begann ich mit dem Brief in der Hand das Problem zu schildern, sprach vom Tod meines Bruders Hans Matthias, dass er an der Front gefallen sei. Der Rat drückte sein Beileid aus, wollte wissen, an welcher Front Hans Matthias gefallen sei, was ich nicht sagen konnte. Ich sagte aber, dass es den Eltern schlecht gehe, die die lange Ungewissheit nach dem Schicksal ihrer zwei Söhne in hohem Maße verzehrt habe, die der Schlag von der Todesnachricht eines ihrer Söhne so hart getroffen hat, dass sie nun physisch am Boden liegen. Da sagte der Rat: "Aber ihre Eltern, Gott sei’s gelobt, leben doch noch." Ich sagte, dass mir der Gesundheitszustand der Eltern große Sorgen mache, und sprach die Bitte um einen Kurzurlaub aus, um die Eltern besuchen zu können und ihnen in der schweren Zeit beizustehen. Weiter bin ich nicht gekommen, denn nun legte der Rat los: "Herr Dorfbrunner, wollen Sie sagen, dass Sie am kommenden Samstag den Trauergottesdienst für Herrn Boschkewitz nicht halten wollen?" Ich hielt ihm entgegen, dass von "nicht wollen" keine Rede war, dass aber in Anbetracht der kritischen Lage der Eltern die Worte "nicht sollen" angebracht wären. Dem Rat zog die erste Blässe aufs Gesicht, ich bemerkte ein Zucken um seinen Mund. Er sagte, dass ihm noch keine Eltern begegnet seien, denen es nach dem Verlust des Sohnes nicht schlecht gegangen sei. Dann hielt er mir vor, dass ich erst vor ein paar Tagen den Dienst als Pfarrer an der Elisabethkirche angetreten habe; welche Reaktion ich denn von der Gemeinde erwarte." Luise Agnes atmete tief durch. Ihr tat ihr Mann in der Seele leid.
"Die kurzen dicken Finger des Rates krampften ums metallne Brustkreuz, als er mit dem Zusatz "Ich hoffe, dass Sie mich verstehen" sagte, dass ich den Tod von Hans Matthias weder objektiv, noch subjektiv vor mir oder den Eltern ungeschehen machen könne. An dieser Tatsache käme ich nicht vorbei; im Nebensatz fügte er hinzu: "wie Sie sich auch drehen mögen". Der Rat wurde heftiger und sagte, dass ich meinen Bruder nicht lebendig machen könne, denn so groß sei ich nun doch nicht." Luise Agnes erschrak über diese Anspielung, die sie für ungezogen erachtete und dem Konsistorialrat nicht zugetraut hatte. "Hatte Herr Braunfelder das so gesagt?", fragte sie. "Nicht anders hatte er es gesagt, und mir krampfte sich der Magen", fuhr Eckhard Hieronymus fort. "Jetzt schwoll seine Rede zum Strom, der nicht mehr aufzuhalten war. Bei allem Verständnis für das Schreckliche, dass meiner Familie widerfahren sei, und bei allem guten Willen mir persönlich gegenüber, das waren seine Worte, stände er meinem Anliegen auf einen Kurzurlaub zum Besuch der Eltern skeptisch gegenüber. Ich solle vielmehr bedenken, dass es millionen Eltern so ergangen sei wie meinen Eltern. Die Schläge des Schicksals seien unvorhersehbar und vor dem fürchterlichen Einschlag weder ablenkbar noch abwendbar oder abwehrbar. Ich könne daran nichts ändern und solle die Sache nicht noch schwerer machen, als sie ohnehin schon ist. Ich sollte nun nicht noch dramatisieren, damit endlich Ruhe eintritt. So hämmerte der Konsistorialrat auf mich ein, dass mir die Luft wegblieb. Ich hatte versucht, gegen den Redestrom anzuschwimmen. Es war vergeblich. Ich fühlte, wie ich in diesem Strom unterging und der Gefahr des Ertrinkens ausgesetzt war. Ich glitt mit meinen Gedanken ab und war bei den Eltern, die nicht nur vom Tod von Hans Matthias zutiefst getroffen waren, sondern sich über das ungewisse Schicksal von Friedrich Joachim den Rest ihrer Köpfe zerbrachen.
Der Konsistorialrat hatte sich fürchterlich aufgeregt, als ich ihm sagte, dass er mir doch einmal zuhören soll, damit er mein Anliegen, welches das Anliegen meiner Familie ist, besser versteht. "Was sagen Sie da: besser verstehen, als hätte ich Sie nicht verstanden", fuhr er dazwischen und schnitt mir gleich das Wort wieder ab. Wie hatte er doch gesagt: "Die Sorge um ihre Eltern ehrt Sie. Lassen Sie sich das von einem Älteren sagen, dass Sie in dieser Situation der großen Betroffenheit wenig ausrichten, aber mehr schaden können. Was ihre Eltern jetzt brauchen, ist die völlige Ruhe. Nennen Sie es Grabesruhe, diese Ruhe brauchen ihre Eltern jetzt." Luise Agnes sah ihrem Mann in die Augen, hinter denen die Betroffenheit hin und her flatterte; sie schüttelte den Kopf. Eckhard Hierronymus bemerkte ihre Ablehnung des enttäuschenden Verhaltens des Rates wohl. Er fuhr fort: "Ich hörte das Wort 'Grabesstille', das wie ein Blitz in mich einschlug. Sofort war ich aus meiner Abwesenheit zurück, nahm den Rat in seinem Stuhl ins Visier, dessen rechte Hand das metallne Brustkreuz weiter fest umklammert hielt, und unterbrach ihn laut, als ich sagte, dass meine Eltern noch leben. "Dann lassen Sie sie doch leben!, Herr Dorfbrunner", fauchte der Rat ungehalten zurück, wobei der Speichel auf die Tischplatte und mir ins Gesicht spritzte. Als ich davon überzeugt war, dass vom Rat nichts zu holen, mit ihm nicht zu sprechen war, stand ich auf und verließ sein Büro. Die Turmglocke machte ihre zwölf Schläge. Da wurde es mir schwer ums Herz, weil mich das Gefühl überkam, dass es in Bezug auf meine Eltern zwölf geschlagen hat und meine Mühen umsonst gewesen sind." "Wie hat der Rat darauf reagiert?", fragte Luise Agnes. "Als ich plötzlich und unerwartet aufstand, wurde der Rat blass, sackte auf seinem Stuhl in sich zusammen, dass die Rückenlehne um zwei Köpfe seinen Kopf überragte. Ihm fiel die Spucke weg, das Wort blieb ihm im Halse stecken. Der Rat rang nach Luft, seine Lippen bekamen den gefürchteten bläulichen Schimmer. Es war eine verzweifelte Situation, in der das Leben des Rates in Gefahr war. Ich war erleichtert, als sich der Spasmus der Atemwege löste und in einen Hustenanfall überging. Der zusammengesackte Rat hielt sich noch das Taschentuch vors Gesicht, als ich das Büro verließ. Rührend war die Anteilnahme des freundlichen Gärtners. Beim Verlassen des Hauses fragte er mich am Gartentor, ob ich ein gutes Gespräch mit dem Herrn Konsistorialrat hatte. Als ich ihm dies verneinte, machte er ein betroffenes Gesicht."
Luise Agnes war sprachlos. Sie hatte angenommen, dass Herr Braunfelder die kritische Situation bezüglich der Schwiegereltern begriff und es am guten Willen nicht fehlen ließ. Es sollte doch möglich gewesen sein, ihren Mann für ein paar Tage zu beurlauben, damit er nach seinen Eltern schauen konnte. Jeder Mensch mit einem normalen Empfinden für den Mitmenschen würde so einem Anliegen, wie es dem Konsistorialrat vorgetragen und begründet wurde, Verständnis entgegenbringen. Sie konnte nicht verstehen, warum gerade dieser Rat sich so unverständlich verhielt, der doch von Berufs wegen um die Fürsorge und Bedeutung der Nächstenliebe wissen sollte. "Du tust mir Leid, dass das Gespräch mit dem Konsistorialrat so negativ war. Dabei war dein Anliegen, die Eltern zu besuchen, um ihnen in ihrer Not beizustehen, nach meinem Dafürhalten durchaus berechtigt. Es wundert mich, dass das der Rat nicht verstand." Eckhard Hieronymus behielt die Augen seiner Frau, in denen das Feuer der Entrüstung brannte, im Blick. Er stellte die Frage: "Wie kann ein Mensch verstehen, wenn er nicht zuhört; liegt nicht die Fähigkeit zur Erkenntnis mehr im Zuhören als im Reden?" Luise Agnes nickte, "das glaube ich auch." "Aber der Rat machte keinerlei Anstalt, mich in Ruhe das Anliegen vortragen zu lassen", sagte Eckhard Hieronymus, "als befiele ihn eine Angst, wenn er anderen Menschen zuhören soll. Er verschanzte sich hinter dem Schreibtisch, der für ihn eine Art Verteidigungswall war." “Aber er wurde doch nicht persönlich angegriffen", meinte Luise Agnes, "wogegen sollte er sich denn verteidigen?"
"Gegen die eigene Angst. Etwas muss bei ihm nicht stimmen", erwiderte Eckhard Hieronymus, "denn das Weglaufen vor dem Zuhören ist doch am Ende nichts anderes als die Flucht vor sich selbst. Der Rat ist von begrenzter Kapazität, wenn er mit einem Problem konfrontiert wird. Er will sich das Problem vom Hals halten, damit er um die Lösung ohne Anstrengung vorbeikommt; er verhält sich nach dem Motto: viele Probleme lösen sich von selbst, warum soll es mit diesem Problem nicht auch so gehen." "Das hört sich nicht gut an", sagte Luise Agnes, "als dein Vorgesetzter hat er sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Da kann er nicht die Dinge abstreifen, als gingen sie ihn nichts an; er kann nicht die Probleme wie Mehlstaub von seiner Schulter abklopfen. Der Rat kann sich doch vor der Verantwortung nicht drücken! Das wäre ja fürchterlich." "Es ist furchtbar, man kann das Fürchten kriegen", meinte Eckhard Hieronymus, "wenn ich mir vorstelle, wie in den Zeiten wie dieser, wo mit gewaltigen Brüchen und Umbrüchen zu rechnen ist, die Arbeit in der Gemeinde ablaufen soll, wenn da die ordnende Kraft im Rücken nicht zu spüren ist, ja fehlt, weil einer der Konsistorialrat ist, der die Probleme von sich wegwälzt. Da kann es passieren, dass politische Dinge in die Kirche getragen werden, die da nicht hingehören."
"Sag nochmal", fragte Luise Agnes, "was der Küster dir sagte mit der Warnung." "Küster Krause sagte, dass ich es schwer haben werde, weil es hier Menschen gibt, die ihren Neid nicht unter Kontrolle bringen. Dabei nannte er keinen Namen." "Kann es nicht der Neid nach deiner Predigt sein, von der Menschen sagten, dass es die beste seit vielen Monaten und Jahren, wie es der Küster sagte, war, dass der Rat auf diese befremdliche Weise reagierte und dir das Wort abschnitt?" "Das tat er doch schon bei meinem ersten Vorstellungsgespräch", erwiderte Eckhard Hieronymus, "also noch vor der Predigt, als der Konsistorialrat mir das Thema mit dem 8. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief regelrecht aufdrückte und hinzufügte, dass er mich an der Auslegung des Textes beurteilen werde. Doch beides, nenne es Neid oder Weigerung, die Verantwortung zu tragen, entspricht einer fatalen Schwäche. Wenn schon der Kopf in der Verwaltung nicht stimmt, wie können seine Hände und Füße stimmen?" Luise Agnes machte ein betroffenes Gesicht: "Da muss ich dir zustimmen und muss dir auch sagen, dass ich mir Sorgen um deine Zukunft mache. Denn aus dem negativen Verhalten des Rates ist zu folgern, dass du deine Probleme selbst auszutragen hast. Wir müssen uns auf eine schwere Zeit einstellen, die um so schwerer ist, weil durch den verlorenen Krieg die Ideale, wie sie es vor dem Krieg noch gab, in der Ungewissheit der Folgen und im Durcheinander mit der aufkommenden Armut verschüttet gehen."
Eckhard Hieronymus schaute seine Frau an, dachte an ihre Schwangerschaft, bewunderte ihr Einfühlungsvermögen und ihren Fleiß, dachte an seine Eltern und Brüder, von denen das Schicksal bei Hans Matthias mit dem Tode besiegelt, bei Friedrich Joachim dagegen noch ungewiss war. Er dachte an die abgemagerten Menschen in der Gemeinde, sah sie im Geiste mit ihren blassen, zersorgten Gesichtern, wie sie am Totensonntag die Kirche verließen und er sie am Ausgang begrüßte. "Wir müssen die Dinge auf uns zukommen lassen", sagte er, “was sonst können wir tun, außer uns mit der Situation abzufinden, den lieben Gott um seinen Beistand zu bitten und hart zu arbeiten. Ich werde noch heute einen Brief an die Eltern schreiben, in dem ich ihnen erklären muss, warum ich sie nicht besuchen kann." Luise Agnes bekam feuchte Augen. Sie sagte, dass sie den Schmerz, den die Eltern zu erleiden haben, bereits empfinde. "Deine Eltern tun mir leid, dass sie das schwere Los allein zu tragen haben. Sie bräuchten den Beistand, und wir können ihn nicht bringen, weil der Rat es an der nötigen Menschlichkeit fehlen lässt. Wenn du ihnen schreibst, frage sie doch, ob sie nicht für eine Zeit zu uns kommen wollen, dass wir uns hier um sie kümmern können."
Eckhard Hieronymus hatte noch in der Nacht den Brief an seine Eltern geschrieben. In diesem Brief hat er ihnen mitgeteilt, dass es für ihn und Luise Agnes nicht möglich sei, sie zu besuchen. Als Grund führte er das Ergebnis des Gespräches mit dem Konsistorialrat an, das er jedoch umschrieb und als ein verwaltungstechnisches Problem bezeichnete. Es seien Aufgaben zu erledigen, die er wahrzunehmen hätte. Dabei dachte er an die Beerdigung des Geschäftsmannes Boschkewitz am Samstag, dem ein Trauergottesdienst voranzugehen hatte, und an den Taufgottesdienst am Sonntagnachmittag. Er erwähnte nicht, dass es auch finanzielle Probleme gab, weswegen er nach Absprache mit Luise Agnes allein kommen wollte, weil das Geld für die Reise der Reserve entnommen werden musste, die seine Frau mühsam angespart hatte. Das wollte er seinen Eltern nicht schreiben, weil sich sonst Mutter Dorfbrunner noch mehr Sorgen machen würde, die ihn ohnehin fragte, ob er und Luise Agnes mit dem Geld leben können, das er als Pfarrer verdient. Mit Gelddingen wollte er seinen Eltern nicht zur Last fallen, das entsprach nicht dem Dorfbrunnerschen Charakter, in dem sich Bescheidenheit, Stolz und Fleiß die Hand gaben. Er verschwieg deshalb auch die für ihn erschwerende Sache mit dem halben Monatsgehalt für die Dauer des Probejahres. Dagegen nahm er den Vorschlag von Luise Agnes in seinem Brief auf und fragte die Eltern, ob sie nicht für ein paar Wochen zu ihnen nach Burgstadt kommen wollen. "Ihr wisst, dass Ihr immer ganz herzlich eingeladen seid und wir uns über Euren Besuch sehr freuen würden." Als Eckhard Hieronymus diesen Satz schrieb, kamen ihm sogleich die Bedenken auf, weil die Eltern ihre Wohnung nicht verlassen würden, solange das Schicksal um seinen jüngeren Bruder Friedrich Joachim ungeklärt ist. Sie warteten mit Bangen und großer Sorge auf seine Rückkehr.