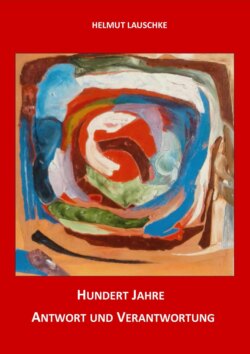Читать книгу Hundert Jahre - Antwort und Verantwortung - Helmut Lauschke - Страница 9
Im Sturz der Ereignisse
ОглавлениеDie graue Wolkendecke trübte den Morgen ein, als Eckhard Hieronymus den Brief zur Post brachte und in den Briefkasten warf. Stimmung und Wetter stimmten überein, sie entsprachen dem Niedergedrücktsein des verlorenen Krieges mit dem, was nun auf die Menschen zukommen würde. Der scharfe Geruch der Armut zog durch die Straßen. Eckhard Hieronymus sah es den Gesichtern der Erwachsenen an, die an ihm vorübergingen, von denen ihn einige, vor allem alte Menschen mit den tiefen Sorgenfalten grüßten, dass sie mit sich und dem Problem des Überlebens beschäftigt waren. An der Litfasssäule vor dem Kirchplatz begannen sich nach dem langen Regen zwei handgeschriebene Plakate zu lösen. Auf dem einen war geschrieben: Wilhelm, du hast uns verraten. Verschwinde, sonst helfen wir dir nach! Die Aufschrift auf dem andern Plakat hatte der Regen verwaschen, auf dem noch zu lesen war: Deutsche Ehre, wo bist du?
Der Winter war früher als erwartet hereingebrochen. Regen und Schneefälle wechselten einander ab. Von der Front kehrten die Kriegsteilnehmer erschöpft und ausgehungert zurück. Viele trugen Verbände an Köpfen und anderen Körperteilen. Sie kamen mit amputierten Armen und an Krücken mit amputierten Beinen aus den Feldlazaretten. Ein Großteil der Männer, die mit den Idealen fürs Vaterland an der Front kämpften, kehrten jedoch nicht zurück, als bereits mehrere Wochen seit dem Kriegsende verstrichen waren; sie waren auf den Schlachtfeldern verblutet. Andere waren in französische, belgische und britische Gefangenschaft geraten. Genaues von den Vermissten wusste keiner, wenn nicht die Todesmeldung die Angehörigen noch in den letzten Kriegstagen erreichte. Diese Ungewissheit, ob Gefangenschaft oder Tod, schwebte als Damoklesschwert über den wartenden Familien. Vor den Geschäften standen die Menschen Schlange, um Milch, Butter und Fleischwaren zu ergattern, deren Preise nach oben schossen, die für kinderreiche Familien so gut wie unerschwinglich waren. Die Armut nahm rasant zu, mit ihr die Zahl bettelnder Kinder auf den Straßen und die Prostitution, für die sich auch minderjährige Mädchen verfügbar machten, die sich mit der ersten Abenddämmerung vor angelehnte Türen vergammelter Gassenhäuser und billigster Absteigequartiere oder an die Ecken abgelegener Seitenstraßen stellten. Die Not war groß und ruinierte das Letzte der guten Sitten.
In dieser grassierenden Armut mit den politischen Turbulenzen des Jahres 1918 tat Eckhard Hieronymus den Dienst als Pfarrer an der Elisabethkirche in Burgstadt. Außerdem unterrichtete er an drei Wochentagen die evangelische Glaubenslehre am vom Stein'schen Gymnasium, wie es mit Oberstudiendirektor Dr. Hauff vereinbart war. Das Verhältnis zum Konsistorialrat Braunfelder, seinem Vorgesetzten, blieb gespannt und dienstlich. Mit ihm gab es so gut wie keine menschliche Begegnung. Dagegen gab es ein herzliches Verhältnis zu Pfarrer Altmann, dem älteren Kollegen von angeschlagener Gesundheit. Sie vertraten sich gegenseitig, wenn es nötig war, was meist der Jüngere der zweiten Pfarrstelle für den Älteren der ersten Pfarrstelle tat, wenn dieser wegen Unpässlichkeiten oder Krankheit bettlägerig war. Eckhard Hieronymus konnte seine Eltern nicht besuchen, aber es kam von ihnen die Nachricht, dass sein Bruder Friedrich Joachim von der Front zurückgekehrt war, aber durch eine schwere Kopfverletzung auf dem rechten Auge erblindet war und nur mit Krücken gehen könne, weil er die Kontrolle über das linke Bein als Folge einer zentralen Muskellähmung verloren habe. Der Vater schrieb, dass die Mutter durch ihren Kummer psychisch stark geschwächt und körperlich gebrechlich geworden sei. Er drückte in zittriger Schrift seine große Sorge aus, dass es Mutter in ihrem angegriffenen Zustand nicht mehr lange aushalten werde. Das bedrückte Eckhard Hieronymus sehr, der diesen Kummer mit sich trug, egal wo er war, ob er seine Predigt im Gottesdienst hielt, trauernde Menschen durch seinen Zuspruch tröstete oder die Schüler in der Glaubenslehre am Stein’schen Gymnasium unterrichtete. Es gab kein Gebet, in dem er nicht seine leidgeprüften Eltern und die Brüder, von denen einer gefallen und der andere ein Kriegsinvalide war, mit einschloss.
Luise Agnes brachte ein Töchterchen zur Welt. Es war ein freudiges, wenn auch ungewöhnliches Ereignis, da in den Familien der Dorfbrunners meist Söhne geboren wurden. Luise Agnes hatte die Schwangerschaft tapfer durchgestanden und war unter den erschwerenden Umständen ihrer Hausarbeit voll nachgekommen. Die jungen Eltern waren glücklich und dankbar, dass das Zurweltbringen ihres ersten Familienzuwachses ohne nennenswerte Komplikationen verlaufen war. Sie gaben dem Mädchen die Namen Anna Friederike und ließen es auf diese Namen taufen, wobei die Großmütter für je einen Namen Pate standen. Die Taufe nahm Pfarrer Altmann während eines Gottesdienstes mit drei anderen Kindertaufen in der Elisabethkirche vor. Es war ein feierliches Ereignis, zu dem die Großeltern Dorfbrunner und Hartmann mit dem Zug aus Breslau angereist waren.
Eckhard Hieronymus erschrak, als der Bischof nach einem Karfreitagsgottesdienst drei Jahre später vor ihm stand und die Hand reichte. "Rothmann. Ich freue mich, Sie kennenzulernen." Eckhard Hieronymus nannte seinen Namen, weil ihm etwas anderes nicht einfiel. "Ihre Predigt hat mich angesprochen, Pfarrer Dorfbrunner", sagte der Bischof. "Danke, das ist sehr freundlich", erwiderte Eckhard Hieronymus. Darauf sagte der Bischof: "Ich habe Ihnen zu danken. Ich bin erstaunt und froh, dass die Elisabethgemeinde Sie als Pfarrer und Prediger hat." Eckhard Hieronymus überlegte sich, ob er sich dafür bedanken soll, obwohl er sich doch gerade bedankt hatte. Er tat es nicht und schwieg. "Herr Dorfbrunner, ich hätte Sie gern einmal vertraulich gesprochen. Können wir uns für vier Uhr im Schlesischen Hof verabreden?" "Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung, Herr Bischof." "Dann bis vier, Pfarrer Dorfbrunnner!" Der Bischof gab Eckhard Hieronymus die Hand, der danebenstehende Konsistorialrat nicht, und ließ sich aus der Sakristei führen. Küster Krause kam mit der Kollekte zurück. Er strahlte und sagte: "Heute haben wir eine gute Sammlung. Sie haben ja auch eine gute Predigt gehalten, Herr Pfarrer, dann können die Menschen sich auch erkenntlich zeigen." Eckhard Hieronymus, der mit seinen Gedanken noch immer nicht ganz zurück war, hob die Hand, um Küster Krause Einhalt mit dem Lob zu signalisieren. Der Küster hatte es verstanden, fügte aber hinzu, dass die Kollekte an den Sonntagen erfreulich sei, an denen Pfarrer Dorfbrunner den Gottesdienst ausrichte. Als Eckhard Hieronymus mit seinen Gedanken wieder ganz in der Sakristei war, fragte er Herrn Krause, ob die Lesung aus dem Evangelium zu lang und die Textauslegung zutreffend war. Der Küster sagte seine Meinung, dass die Lesung kürzer und die Predigt, auch wenn sie klar und deutlich war, etwas schärfer -"wie es der Herr Pfarrer sonst doch tut"- hätte sein können.
Draußen wartete Luise Agnes mit Anna Friederike auf dem Arm. Er nahm ihr das Töchterchen ab, und sie gingen unter einer dicken Wolkendecke nach Hause. Luise Agnes sprach die Befürchtung aus, dass sie das Haus nicht mehr trocken erreichen würden. So legten sie einen Schritt zu, und Anna Friederike hatte ihren Spass und fuhr dem Vater mit der Hand durchs Haar, während er von der Begegnung mit dem Bischof in der Sakristei seiner Frau erzählte. Sie erreichten das Haus in der Wagengasse 7 trocken, als ein leichter Nieselregen einsetzte und Eckhard Hieronymus vom Nachmittagstermin im Schlesischen Hof sprach, wo ihn der Bischof vertraulich sprechen wolle. Luise Agnes nahm ihm das Töchterchen ab und setzte es aufs Töpfchen, während Eckhard Hieronymus Schuhe und Mantel auszog, den Mantel an den Kleiderständer im schmalen Flur hängte und den verbeulten Wasserkessel füllte und über die Gasflamme setzte. "Deine Predigt hat mir gut gefallen", sagte Luise Agnes, als sie mit Anna Friederike auf dem Arm aus dem Badezimmer in die Küche kam. "War sie nicht zu lang?", fragte er. "Nein", sagte Luise Agnes, "sie war nicht zu lang bei den vielen Punkten, die du in ihr angesprochen hast." "Meinst du, dass sie verstanden wurde?" "Die Predigt war klar und gut verständlich; man musste nur richtig hinhören. Deine Darstellung des Leidensweges hat mich erschüttert. Ich bekam die Gänsehaut. Ein zweites Mal bekam ich sie, als du das Bild vom Gnadenstrom entwarfst und davon sprachst, dass wir uns von diesem Strom mitreißen lassen sollen, der uns zu neuen, wunderbaren Ufern trägt, von denen wir nicht einmal träumen können. Schon das Bild war mitreißend." "Vieles in der Bibel ist bildhaft geschrieben. Weil die Sprache anschaulich ist, geht sie auch leicht ein." "Man muss kein Akademiker sein, um die Sprache zu verstehen", meinte Luise Agnes, worauf Eckhard Hieronymus erwiderte: "Je weniger akademisch gelesen wird, um so lebendiger ist die Sprache und natürlicher ist die Aufnahme des Wortes." "Du hast den Bischof zum ersten Mal gesehen. Ist er ein freundlicher Mann?", fragte sie und goss den frisch gebrühten Tee in die Tassen, gab den Zucker dazu und rührte ihn unter den hell klingenden Schlägen gegen das dünne Prozellan ein. "Er machte zumindest einen höflichen Eindruck", antwortete Eckhard Hieronymus, "ich erschrak, als er plötzlich vor mir stand und seine Hand reichte." "Warum hast du dich erschrocken?" "Weil ich mit den Gedanken bei den Eltern war und mir Vater nach dem Schlaganfall vorstellte, wie er sich die Worte aus dem Mund herausquält, sie beim Aussprechen verwäscht und zermalmt, mir Mutter vorstellte, wie sie unter Aufwendung ihrer letzten Kräfte Vater wäscht, bettet, kleidet, füttert und zur Toilette schleppt." "Ja, mir tun die Eltern sehr leid; und keiner von ihren Kindern kann ihnen helfen, Friedrich Joachim nicht, der selbst an Krücken geht, und wir auch nicht", sagte Luise Agnes betroffen und sah in das nachdenkliche Gesicht ihres Mannes. "Hat der Bischof etwas zur Predigt gesagt?", fragte sie. "Er sagte, dass ihn die Predigt angesprochen habe und er erstaunt und froh sei, dass die Gemeinde so einen Pfarrer und Prediger hat." "Und hat der Konsistorialrat etwas verlauten lassen?" "Nicht einen Ton. Der hat auch nicht, wie es der Bischof tat, mir die Hand gereicht." Luise Agnes machte ein ernstes Gesicht. "Hast du eine Ahnung, was der Bischof von dir will?" "Nicht die leiseste."
Eckhard Hieronymus hatte sich den Regenmantel übergezogen und machte sich auf den Weg zum Schlesischen Hof. Luise Agnes hatte Anna Friederike auf dem Arm und wünschte ihm ein gutes Gespräch. Sie stand noch eine Weile in der Haustür und schaute ihrem Mann nach, der mit hochgeschlagenem Mantelkragen ohne Hut und ohne Schirm durch den Nieselregen ging. Seinem Gang las sie den Zustand der Erschöpfung ab. Es waren wenige, und wenn, jüngere Menschen unterwegs. Von der Wagengasse bog er in die Grabenstraße und von dort in die Marktstraße ein. Von da nahm er den kürzeren Weg zum Bahnhof durch die Schinkengasse, die schräg gegenüber der Bäckerei von der Marktstraße abging. Es war die Gasse mit den scharfen Gerüchen, die im Volksmund die >Strichgasse< hieß, weil da Frauen und Mädchen der unterschiedlichen Altersgruppen mit einsetzender Dämmerung kurzberockt und strammbrüstig in durchsichtigen Blusen vor den offenen oder angelehnten Türen vergammelter Häuser standen und ihrem Gewerbe nachgingen. Wenn auch die runtergekommenen Gassenkneipen mit dem Anschlag am Fenster "Karfreitag geschlossen" außer Betrieb waren, so klebten an den Türen der Absteigequartiere Zettel mit Aufschrift "Zimmer zu vermieten!". Frauen und Mädchen hatten sich an diesem Tage nicht vor die Türen oder neben sie postiert; doch bewegten sich bräunlichgrau verblichene Gardinen hinter kleinen Fenstern, als stünde die Gasse unter permanenter Beobachtung, würde auch an diesem Tage, wenn nicht mit Kundschaft gerechnet, so doch auf Kundschaft gewartet. Diese Gasse, mit ihren scharfen Gerüchen, führte direkt auf den Bahnhofsplatz, von dem aus die Burg zur Linken, ein massiver Bau, den sich die Raubritter des späteren Mittelalters errichtet hatten und seitdem das Wahrzeichen im Stadtwappen der Altstadt ist, dann zur Rechten die drei Fördertürme als Wahrzeichen der neuen, der Kohlestadt und in entgegengesetzter Richtung der nicht allzu hohe Turm mit der kurzen Kegelspitze der Elisabethkirche zu sehen waren.
Eckhard Hieronymus erreichte den Schlesischen Hof fünf vor vier. Er wartete auf einem der Sessel vor der Rezeption bis punkt vier, fuhr mit dem Taschentuch übers Gesicht und über die Haare, um sich das Nass wegzuwischen. Auf einem der anderen sechs Sessel saß Bankdirektor Hobel von der schlesischen Raiffeisenkasse mit schwarzem Hut und zusammengeklapptem Regenschirm in der Hand. Er grüßte freundlich zurück und beschrieb das Wetter mit wenigen Worten als unfreundlich. Direktor Hobel sagte, dass er auf einen Gast warte, der ein aus Breslau angereister Geschäftsmann sei. Eckhard Hieronymus bat den älteren, schwarz gekleideten Herrn an der Rezeption Bischof Rothmann von seiner Ankunft in Kenntnis zu setzen. Dieser Herr war offensichtlich kein Protestant, oder wenn er es war, ein notorischer Nichtkirchengänger, weil er nach dem Namen des Besuchers fragte, den er dem Bischof melden dürfe. Als Eckhard Hieronymus den Namen Dorfbrunner nannte, geriet der Herr an der Rezeption in Verlegenheit, die er dadurch auszubügeln versuchte, dass er sagte: "ach, natürlich Herr Pfarrer!". Er schickte den jungen Pförtner, der den Gästen das Gepäck rein und raus trug, nach Zimmer 17 im ersten Stock, um dem Bischof die erwünschte Mitteilung zukommen zu lassen.
Nach weiteren zehn Minuten, Bankdirektor Hobel hatte mit seinem Gast das Hotel verlassen, kam der Bischof auf dem ausgetretenen roten Stufenteppich herunter, ging auf Pfarrer Dorfbrunner zu und begrüßte ihn mit den Worten: "Das ist schön, dass wir uns wiedertreffen." Eckhard Hieronymus ließ es sich sagen, ohne darauf eine Antwort zu finden, also nichts sagte, als der Bischof ihn zu einer Tasse Kaffee im Speiseraum des Hotels einlud. Die Tische im Speiseraum waren bereits mit weißen Tischdecken für den Abend mit großen und kleinen Tellern, den seitlich angelegten Bestecken und dreieckig gefalteten Tuchservietten gedeckt. "Nehmen wir an einem der Tische Platz", sagte er und schritt auf den hinteren Tisch am Fenster zu, der der fünfte in der Reihe war, und nahm den Stuhl mit dem Blick zum Bahnhofsplatz ein. Eckhard Hieronymus setzte sich dem Bischof gegenüber, also mit dem Rücken zum Fenster. Der Ober in weißer Livree, schwarzer Hose und mit blassem Gesicht kam auf den Fenstertisch zu und nahm die Bestellung für zwei Kännchen Kaffee mit der Miene der Selbstverständlichkeit entgegen. Er ging durch eine Pendeltür, die beim Pendeln quietschte, offenbar in die Küche, um die Bestellung weiterzugeben. Der Bischof sah dem jungen Pfarrer ins Gesicht, der wiederum dem Bischof auf die Brust schaute und nach dem metallnen Kreuz suchte, wie es der Konsistorialrat mit dem Dienstblick nach oben trägt und dann ständig mit den Fingern umfasst hält, wenn er einem jungen, ihm untergegebenen Geistlichen hinter dem großen Schreibtisch mit der polierten Schreibtischplatte im hochlehnigen Schreibtischsessel gegenübersitzt. Der Bischof saß also ohne Kreuz am Tisch, obwohl ihm das Kreuz mindestens so auf die Brust gehörte wie dem ihm untergegebenen Konsistorialrat. Während sie auf die Kaffeekännchen warteten, nahm der Bischof das Gespräch auf. "Pfarrer Dorfbrunner, wie lange sind Sie nun hier Burgstadt?" "Es ist das dritte Jahr, Herr Bischof." "Zu meiner Freude darf ich ihnen sagen, dass mir Gutes über Sie berichtet wurde. Sie haben sich das Vertrauen der Gemeinde in kurzer Zeit erworben. Die Menschen loben ihre Hilfsbereitschaft und ihren Fleiß." Was sollte Eckhard Hieronymus nun sagen? Er schwieg. Der Bischof fuhr fort: "Was ihren Namen über die Gemeinde hinaus bis an meine Ohren brachte, das sind ihre Predigten. Von der Kraft, die aus ihrer Predigt kommt, konnte ich mich heute selbst überzeugen." Eckhard Hieronymus, der nur die enttäuschenden Gespräche mit dem Konsistorialrat hatte, irritierte die positive Stellungsnahme des Bischofs. Er wusste nicht, wie er darauf reagieren sollte, wollte aber auch nicht unhöflich sein. "Vielen Dank, das ist sehr freundlich", sagte er, weil ihm nichts Besseres einfiel. Die Kaffeekännchen wurden gebracht. Jeder goss sich den Kaffee in seine Tasse, gab Milch dazu und rührte den Zucker ein.
"Pfarrer Dorfbrunner", setzte der Bischof das Gespräch fort, "das Domkapitel in Breslau sucht einen Prediger ihres Formats. Wären Sie bereit, nach Breslau zu kommen? In den nächsten drei Monaten wird die erste Pfarrstelle frei, da Pfarrer Möller aus gesundheitlichen Gründen um den vorgezogenen Ruhestand bat." Eckhard Hieronymus glaubte nicht richtig gehört zu haben. Nach Breslau, da wo seine Eltern sind, um dort im Dom als Prediger zu wirken. Er war sprachlos, suchte vergebens nach dem metallnen Kreuz auf der Brust des Bischofs und sah in ein väterlich freundliches Gesicht, dem er die Aufrichtigkeit des Angebots zutraute. "Haben Sie, Herr Bischof, schon mit Konsistorialrat Braunfelder gesprochen?", fragte er, "Ich frage deshalb, weil der Gesundheitszustand von Pfarrer Altmann ein angegriffener ist." Der Bischof blickte mit ruhigen Augen dem jungen Pfarrer ins Gesicht und sagte: "Noch habe ich nicht mit dem Konsistorialrat gesprochen, weil ich erst ihre Meinung erkunden will. Wenn Sie mein Angebot annehmen und als Domprediger nach Breslau kommen, dann werde ich selbstverständlich Herrn Braunfelder von der Entscheidung in Kenntnis setzen." Eckhard Hieronymus glaubte noch immer, sich verhört zu haben, zu verlockend war das Angebot. "Können Sie mir eine kurze Bedenkzeit einräumen, dass ich mit meiner Frau über ihr freundliches Angebot sprechen kann?" Der Bischof willigte in die Bedenkzeit ein. Er sagte, dass er nur noch den morgigen Samstag in Burgstadt sei, weil er Ostersonntag selbst im Dom zu predigen habe.
Eckhard Hieronymus sagte, dass er den Herrn Bischof noch am diesem Abend von seiner Entscheidung unterrichten werde. "Sagen wir morgen zehn Uhr", schlug der Bischof vor, "denn heute Abend haben mich Herr und Frau Braunfelder zum Essen eingeladen." Eckhard Hieronymus, der im Begriff war, sich von seinem Stuhl zu erheben, um die Botschaft eilends Luise Agnes zu bringen, ohne dass er die erste Tasse Kaffee ausgetrunken, geschweige sich die zweite Tasse eingegossen hatte, blieb sitzen, weil der Bischof noch wissen wollte, welche Erfahrungen er im Umgang mit dem Konsistorialrat gemacht hatte. Für Eckhard Hieronymus war es eine peinliche Frage, die der Bischof ihm nicht stellen sollte, weil einerseits die Kritik am Vorgesetzten etwas Delikates ist, was leicht missverstanden und falsch ausgelegt würde, andererseits aber ein fester Standpunkt einzunehmen war, um der Wahrheit ans Licht zu helfen. Eckhard Hieronymus sagte es heraus: "Herr Bischof, jetzt stellen Sie mir eine schwierige Frage, weil es mir peinlich ist, auf sie zu antworten." "Wieso peinlich, Pfarrer Dorfbrunner?", fragte der Bischof. Eckhard Hieronymus sah, dass das Gesicht des Bischofs ernste Züge bekam, die für ihn in dem bisher so freundlichen Gesicht neu waren. "Sprechen sie sich offen aus", forderte ihn der Bischof auf. "Wenn ich mich mit einer Zusammenfassung begnügen darf, Herr Bischof", druckste Eckhard Hieronymus herum, "dann muss ich leider sagen, dass es ein menschliches Verhältnis zu Konsistorialrat Braunfelder eigentlich gar nicht gab. Es gab nur zwei Gespräche in meinen bald drei Jahren als Pfarrer an der Elisabethkirche in seinem Büro, die eigentlich keine Gespräche waren, weil ich einfach nicht zu Worte kam. Für mich beschränkten sich beide Gespräche aufs Zuhören. Die Ergebnisse und die Art und Weise, wie sie mir vorgesetzt wurden, haben mich sehr enttäuscht." Der Bischof behielt die ernsten Züge auf dem Gesicht und schwieg für einen Moment. "Wollen Sie sagen", fand er zur Rede zurück, "dass ihnen Konsistorialrat Braunfelder nicht genügend Raum zum Sprechen gab, ich meine, ihnen nicht so zuhörte, wie Sie es von ihm erwarteten?" "Ja, das kann man so sagen", erwiderte Eckhard Hieronymus. Der Bischof schien das Problem begriffen zu haben; er fragte in väterlicher Weise, ob er den Konsistorialrat darauf ensprechen soll. "Herr Bischof, das überlasse ich ihnen. Ich glaube allerdings nicht, dass es etwas bringen und zu einer normalen menschlichen Beziehung zwischen dem Rat und mir führen würde", setzte Eckhard Hieronymus hinzu. Der Bischof sagte: "Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich danke ihnen, dass Sie gekommen sind", und er trank seine zweite Tasse Kaffee aus. Sie standen auf, verließen den Speiseraum, als die kleine Glocke vom Turm der Elisabethkirche die fünf Schläge tat, gingen gemeinsam zum Ausgang, wo Bischof Rothmann dem jungen Pfarrer Dorfbrunner die Hand gab und ihn mit den Worten: "Dann bis morgen um zehn!" verabschiedete.
Eckhard Hieronymus ging den kürzesten Weg, also durch die Schinkengasse, die der Volksmund die "Strichgasse" nannte, zurück. Ihn hatte die Euphorie gepackt. Er fühlte sich von jeglicher Schwere befreit, auch wenn er an Menschen in seiner Gemeinde dachte, die er in den bald drei Jahren liebgewonnen hatte. Die Füße liefen wie von allein. Weder der scharfe Gassengeruch noch der Nieselregen, der zugenommen hatte, störte ihn. Ja, ihm kam der Geruch der herumliegenden Abfälle und das Nass, das von seinem Gesicht tropfte, erst gar nicht in den Sinn. Luise Agnes stand mit Anna Friederike auf dem Arm in der offenen Tür der Wagengasse 7 und wartete auf ihren Mann. Sie stand genauso da, wie sie dastand, als sie Eckhard Hieronymus zu seinem Gang zum Schlesischen Hof verabschiedet und ihm für das Gespräch mit dem Bischof alles Gute gewünscht hatte. Sie wunderte sich schon, ihn so leichten und schnellen Schrittes ankommen zu sehen, weil sie noch den müden, schweren Gang in Erinnerung hatte, mit dem er weggegangen war, dem sie die Zeichen der physischen Erschöpfung ablas und sich deshalb Sorgen machte. Eckhard Hieronymus strahlte aus einem pitschnassen Gesicht und sagte, als er das Gartentörchen schloss und die paar Meter zur Haustür nahm: "Meine liebe Frau, wenn mich nicht alles täuscht, sind deine guten Wünsche heute Nachmittag in Erfüllung gegangen." Er küsste die beiden Wartenden auf die Stirn, hing den nassen Regenmantel an den Ständer, zog die Schuhe aus, die er vor der Haustür im Flur abstellte und ging in Socken in die Küche und setzte sich an den kleinen Tisch.
Eckhard Hieronymus nahm das Töchterchen auf den Arm und liebkoste es, während Luise Agnes frischen Tee in die Tassen goss und den Zucker unter den hellen Porzellanklängen verrührte. Sie war gespannt auf die Botschaft und setzte sich an den kleinen Tisch dazu. "Stell dir vor", legte Eckhard Hieronymus ohne Umschweife los, "der Bischof will mich nach Breslau an den Dom holen." "Mal langsam!", bremste ihn Luise Agnes, "jetzt machst du einen Scherz, der zu schön ist, um wahr zu sein." "Nein, das ist kein Scherz, der Bischof fragte mich, ob ich die erste Pfarrstelle am Dom übernehmen wolle, weil der bisherige Stelleninhaber aus gesundheitlichen Gründen um den vorzeitigen Ruhestand gebeten hatte." "Und wie kommt er ausgerechnet auf dich?" "Da muss ein Engel im Spiel sein, denn der Bischof sagte, dass er gute Nachrichten von hier bekommen hat, was Hilfsbereitschaft und Fleiß, aber auch was meine Predigten betrifft. Er sagte, dass er sich heute selbst von der Kraft der Predigt überzeugt hätte. Luise Agnes überfielen Freudentränen: "Da hat sich ein Wunder über uns ergossen. Das ist ja nicht zu fassen." "Ich hatte den Bischof um eine Bedenkzeit gebeten, um die Sache mit dir zu besprechen. Er erwartet mich morgen um zehn mit meiner Entscheidung." Sie tranken genüsslich den Tee, streichelten und küssten Anna Friederike, als sei sie der Engel mit dem unverhofften Wunder. "Große Dinge kommen plötzlich, ohne dass man an sie denkt", sagte Luise Agnes im Überschwang der wunderbaren Botschaft. "Du meinst auch", fuhr Eckhard Hieronymus fort, "dass ich das Angebot annehmen soll." "Das ist eine Sternstunde, die dir da zugeflogen kam. So eine Chance bekommst du nur einmal im Leben. Um Gottes Willen, nimm das Angebot an!"
Eckhard Hieronymus unterrichtete den Bischof am Karsamstag, zehn Uhr, im Schlesischen Hof von seiner Entscheidung. Bischof Rothmann war mit der Entscheidung zufrieden, weil sie seinem Plan entsprach, einen jungen, fleißigen und dynamischen Pfarrer und wortstarken Prediger ans Domkapitel nach Breslau zu holen. "Pfarrer Dorfbrunner, Sie werden bald von mir hören." Das waren die Abschiedsworte unten vor der Rezeption. Dann machte sich der Bischof auf den Weg zum Bahnhof. Er ließ sich von dem jungen Wärter begleiten, der ihm den Koffer über den Bahnhofsplatz trug. Der Zug nach Breslau sollte in wenigen Minuten eintreffen.