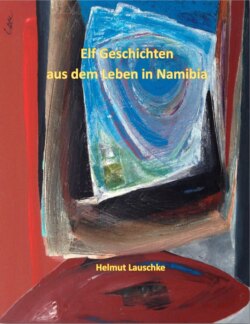Читать книгу Elf Geschichten aus dem Leben in Namibia - Helmut Lauschke - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Von den frühen moralischen Entgleisungen
ОглавлениеDie Sandalen mit den verschwitzten Korksohlen streifte Ferdinand vor der Tür ab, betrat die Wohnung und erschrak vor dem Durcheinander im Wohnraum und Schlafzimmer. Einbrecher hatten mit Hebeln den Aluminiumrahmen der hinteren Schiebetür, die zum kleinen Garten führte, aufgebogen, den Riegel entsichert und die Tür aufgeschoben. Das haben sie am helllichten Tage veranstaltet, weil sie davon Kenntnis hatten, dass der Bewohner zu dieser Zeit im Hospital arbeitete. Es war das dritte Mal, dass über Tag in die Wohnung eingebrochen wurde. Dr. Ferdinand kam so in Rage, dass er mit dem Auto ins Hospital fuhr, um Dr. Nestor von diesem Vorfall zu berichten. Die Eingangstür schloss er nicht ab, weil es nun nichts mehr zu stehlen gab, was einen Wert von Bedeutung hatte. Dr. Nestor nahm es betroffen und hilflos zur Kenntnis. Er schickte den Koordinator für die Malariakontrolle und Prophylaxe durch Insektizid-Spritzaktionen mit DDT (Dichlor-diphenyl-trichloräthan) zur Wohnung, um sich ein eigenes Bild von der Verwüstung zu machen. Er war erschrocken und stotterte ein paar Worte des Bedauerns heraus. Dr. Ferdinand räumte die Reste zusammen. Die letzte von drei Uhren, das Radio mit Tape recorder, fünfzehn der neunzehn Tapes mit klassischer Musik, eine Brille, der graue Anzug, die besten Hemden, drei Schlipse und vier neue, noch nicht gebrauchte Frotteehandtücher sowie ein Parker-Kugelschreiber waren die diesmalige Beute. Es bestand Übereinstimmung, dass es sinnlos sei, eine Anzeige bei der Polizei zu machen. Die Erfahrung lehrte, dass bei den grassierenden Einbrüchen die Täter nie gefunden wurden. Der Verdacht wurde geäussert, dass da die Polizei ihre Hände mit im schmutzigen Spiel und bei der Veräußerung des gestohlenen Gutes habe. Dann machte sich Dr. Ferdinand am verbogenen Aluminiumrahmen zu schaffen. Er musste sich da anstrengen, bog und klopfte den Rahmen schließlich mit Hammer und anderem mikrigem Werkzeug so zurecht, dass der Riegel der Schiebetür wieder ins Schloss passte. Danach machte er einen Abendspaziergang durchs Dorf und ass im Lodge-Restaurant am Oshakati-Airport zu Abend und gönnte sich dazu ein großes Glas Bier vom Fass (draught beer) der Marke 'Tafel Lager'. Dort traf er einige Bekannte, denen er vom letzten Einbruch erzählte. Sie wunderten sich nicht und meinten ganz trocken, dass die Einbrüche epidemisch geworden sind, wogegen nichts unternommen werden kann, weil die Polizei da mit von der Partie sei, anstatt die Täter einzusperren und zur Verantwortung zu ziehen.
Es war Mitternacht, als Ferdinand die Wohnung betrat, sich ins Bett legte und nichts mehr von diesem Vorfall wissen wollte. Der volle Mond schien durchs Fenster, erhellte die Wände und schwieg sich aus. Alles war geeignet für einen bösen Traum. Den gab es dann auch und verlief etwa so: Es war ein langgezogener Raum mit hoher Decke und hohen Fenstern, als wäre es ein Nebenraum im Schloss Sanssouci, das verdeutscht Schloss Sorgenfrei hieße. In dem Raum stand ein altes Bett von anno dazumal mit einem durchhängenden Baldachin. Alles war ziemlich verstaubt und in den Ecken der hohen Fenster spannten sich riesige Spinnnetze, die an einigen Fenster von einer Seite zur andern gingen. Das Weiß der verschnörkelten Stuckdecke und Wände hätte mindestens alle hundert Jahre erneuert werden müssen. So war das Stuckwerk gelblichgrau und rissig. An vielen Stellen fehlten Formstücke, die offensichtlich abgefallen und in jährlichen Abständen vom Boden weggefegt wurden. Der verzierte Dielenboden hatte einen matten Glanz und roch nach Bohnerwachs. Da war die Restauration aus Gründen des Geldmangels oder Geizes vonseiten des Besitzers oder anderer Abgaben für Kriege und bei Niederlagen durch das Muss der Befolgung von Anordnungen vonseiten der Besetzer sträflich vernachlässigt worden. Myriaden afrikanischer Heuschrecken trommelten gegen die Scheiben, als wäre es das Trommelfeuer bei der Schlacht um Stalingrad oder um die letzte Festung Berlin. Das Stöhnen verwundeter und Röcheln verblutender Soldaten war zu hören. Durch das fortwährende Trommeln gegen die Scheiben öffnete sich ein Fensterflügel, dem vor hundert Jahren oder länger ein Riegel beim Öffnen oder Schließen abgebrochen wurde. Nicht dem Hausmeister, Rennt- oder Zeremonienmeister wäre zu danken, dass sich dieser Flügel nicht schon vor hundert Jahren oder länger geöffnet hatte, was verheerende Folgen für Wände, Decke und Boden und besonders für Bett und Baldachin gehabt hätte. Es war dem Zufall oder irgendeiner schicksalhaften Bewegung zu verdanken, dass damals vor langer Zeit eine Hand das Fenster anlehnte, ob sie es war, die den Griff abbrach, wer wollte es jemals wissen (?), und das Fenster sich durch Molekülverschiebungen im Holz bei den jahreszeitlichen Klimawechseln von Feuchtigkeit und Trockenheit im Fensterrahmen festsetzte und verklemmte. Mit dem Öffnen des besagten Fensterflügels nach nicht nachlassenden, sondern weiter zunehmenden Trommelschlägen afrikanischer Heuschrecken gegen die Scheiben aller Fenster, kam es nun zur letzten Schlacht um Bett und Baldachin. In dichten Verbänden flogen sie durchs Fenster und besetzten das Baldachin, das durch die Schwere der Ladung nach unten durchhing. Die Wände waren von Schwärmen besetzt. Selbst am Deckenstuck hingen sie zu Tausenden und lösten lockere Stücke aus dem Verband, die auf die Diele fielen und das Bild der Verwüstung gaben. Es war ein Geklappere und Geschlage im Raum, den die Schwärme verdunkelten. Trotzdem hielten die Trommelschläge gegen die verschlossenen Fenster unvermindert an. Es war ein Kampf auf verlorenem Posten. Gegen diese Übermacht war nicht anzukommen, die Lufthoheit nicht zurückzugewinnen. Die Bodenschlacht nahm an Heftigkeit zu. Die Verbände auf dem Boden waren unübersehbar. Es wurde mit dem Schuh auf den Boden um sich geschlagen, dass es knackte und krachte. Dennoch war die Schlacht verloren und die Flucht war unausweichlich. Inzwischen haben die "Schrecken" die letzten Winkel besetzt. Sie stelzen über Kopfkissen und Lake und heben die Decke ab und schieben sie zur Seite. Die Flucht gestaltet sich dramatisch, weil es nichts mehr gab, was frei von diesen "Schrecken" war, die selbst in den Taschen der Hose knackten und krallten und in der Hemdstasche ein und aus staksten und stakten. Es blieb nichts anderes übrig, als barFuß und nackt auf die dichten "Schreckens"-Verbände zu treten, gegen die fliegenden Schwärme anzurennen und sich durchzuschlagen und mit dem letzter Kraft aus dem offenen Fensterflügel gegen die weiter eindringenden "Schreckens"-Massen in die Freiheit zu springen, egal ob man den Sprung überlebt oder nicht. Da gab es nichts anderes als den nackten Sprung nach den Gesetzen des freien Falls (Traumende).
Was aus den schlaff hängenden Spinnnetzen, der bröckelnden Stuckdecke, den rissigen, gelblich grauen Wänden und dem quietschenden Bett im Quadratformat mit der durchgelegenen Matratze und dem verstaubten, durchhängenden Baldachin geworden ist, wusste niemand. Die Kenntnis entzog sich der Nachforschung, weil nach dem Einfall der afrikanischen Heuschrecken ein neuer Verschlussriegel am Fenster angebracht, das Fenster geschlossen, alle Fenster geputzt, Stuckdecke und Wände restauriert, der Raum weiß gestrichen und die Bodendielen frisch gebohnert und poliert worden war.
Ferdinand hatte geschwitzt. Die Hähne krähten den Mittwoch ein. Ferdinand stand unter der Brause, als gegen sechs Uhr das Telefon klingelte und die Schwester vom 'Outpatient department' von einem Verletzten berichtete, der nach einem Verkehrsunfall gebracht wurde. Dr. Ferdinand trocknete sich ab, zog sich an und eilte zum Hospital. Der Sonnenball glühte, als er hinter dem Horizont hervorkam und sich weiter erhob. Die roten Strahlen brachen sich in den beiden Fenstern der 'Intensiv'-Station, als er den Vorplatz überquerte und das OPD betrat. Es war ein junger Mann von etwa dreißig, der auf der Trage lag. Er hatte multiple Hautschürfwunden im Gesicht und an den Armen. Zudem hatte er sich das rechte Fußgelenk gebrochen. Der Fuß war jedoch nicht disloziert. Die Verletzungen waren also nicht schwer. Dr. Ferdinand fragte die Schwester, warum sie ihn gerufen hat, da diese Verletzungen vom ersten Dienst behandelt werden konnten. Die Schwester berichtete, dass die Kollegin sich den Patienten kurz angesehen hatte. Als sie die Knöchelverletzung sah, beauftragte sie die Schwester, den Kollegen vom chirurgisch-orthopädischen Dienst zu rufen, und verschwand. Es war eine junge Kollegin, die während des Exils in der Sowjetunion Medizin studierte. Sie hatte noch nicht einmal das Röntgenformular ausgefüllt und den Patienten zum Röntgen geschickt. Auch hatte sie nicht die Hautschürfwunden gesäubert und mit an den Armen mit sterilen Verbänden abgedeckt. Sie kam, sah das Fußproblem und ging. Was war das für eine Einstellung? Da war nichts von Hingabe oder Interesse zum Beruf. Da war die Tätigkeit eher eine Last. Der Dienst am Menschen war ohne Gefühl, ohne Zuneigung. Da war der Beruf mit dem hohen Ethos zum inhaltsleeren Job verwahrlost. Dr. Ferdinand sandte den Patienten zum Röntgen, sah in der Zwischenzeit die Patienten auf der 'Intensiv'-Station und den anderen Stationen. Dann ging er zum OPD zurück, studierte das Röntgenbild, richtete das Fußgelenk ein und stellte den Fuß in einem Unterschenkelgips ruhig. Als er noch beim Anlegen des Gipsverbandes war, dachte er an seine Lehrjahre zurück, wo ihm ein erfahrener Pfleger das Gipsen beibrachte. Der konnte es oft besser als viele der Doktoren, die sich einbildeten, es zu können. Als junger Assistent hatte er sich aber darum bemüht, einen Bruch einzurichten und einen Gipsverband richtig anzulegen. Nun bemühten sich die jungen Ärzte nicht einmal darum, das Richten einer Fraktur und das Anlegen eines Gipsverbandes zu lernen. Was waren das für Ärzte, die da kamen und gleich wieder gingen, wenn es ein kleines Problem zu lösen gab? Hatten sie die Scheu vor der Verantwortung im Exil gelernt?
Dr. Ferdinand säuberte noch die Hautschürfwunden und wickelte sterile Verbände an den Armen an. Die Schwester verabreichte die Spritze gegen den Wundstarrkrampf, und die Krankenpfleger fuhren den Patienten auf der Trage zum orthopädischen Männersaal. Dr. Ferdinand machte sich auf den Weg zur Morgenbesprechung, zu der er sich bereits verspätet hatte.
Der Raum des Superintendenten war bis auf den letzten Platz gefüllt, so dass sich Dr. Ferdinand einen Stuhl aus dem Sekretariat holte und sich neben die Tür setzte. Stoischer Gleichmut lag auf den Gesichtern der Teilnehmer. Bei einigen war sogar ein Gelangweiltsein im Gesicht zu lesen. Dabei hielt der Superintendent eine Rede über die ärztliche Verantwortung bei der Arbeit am Patienten. Da waren die Pünktlichkeit bei der Arbeit, die ordentliche Visite, die Eintragungen im Krankenblatt, das Einhalten der Disziplin, nicht vorzeitig das Hospital zu verlassen, und anderes herauszuhören. Die Matronen nannten die Unfreundlichkeit einiger Kollegen und Kolleginnen den Schwestern gegenüber, das Problem, den diensthabenden Arzt in der Nacht und am Wochenende zu erreichen, und das unerlaubte Essen von Angehörigen der Ärzte in der Kantine. Beim Vorbringen dieser Punkte dachte Ferdinand an die Morgenbesprechungen vor der Unabhängigkeit, bei denen der Superintendent in Majorsuniform und der hemdsärmelige Superintendent mit der roten Nase und der verrutschten Brille mit den verschmierten Gläsern ihre Monologe über das erhöhte Sicherheitsrisiko durch das angebliche Einsickern von Swapo-Kämpfern und Polit-Aktivisten gehalten hatten, ohne je einen Beweis für diese Behauptung zu bringen. Er erinnerte sich gut an den Morgen, als der ärztliche Direktor in Colonelsuniform und der Brigadegeneral in den Raum kamen, und der kurze Superintendent in Hemdsärmeln von seinem Tisch aufsprang, um die militärischen Größen zu begrüßen, wie der junge Leutnant Dr. Hutman, der auch den Namen: der Leutnant des Teufels trug, aufsprang und einen frisch angekommenen, noch jüngeren Kollegen in Uniform mit hochriss, um den hohen Offizieren ihre Stühle praktisch unter ihre Hintern zu schieben. Damals hielt der Brigadier einen langen Monolog über die kritische Sicherheitslage des Dorfes und sprach auch von den unterschlüpfenden Swapo-Kämpfern im Hospital, wofür er den Beweis aus "Sicherheitsgründen" nicht brachte und, wie sich später herausstellte, nicht bringen konnte. Er sprach fast pathetisch von der letzten Entscheidungsschlacht, bei der für alle viel auf dem Spiel stehe. Er sagte, dass alle Weißen einschließlich ihm selbst auf einem Pulverfass sässen, das jederzeit hochgehen könne. Das Pulverfass ging schließlich hoch, das weiße Kommandoschiff versank, und das schwarze Kommando fasste Fuß und nach den Hebeln der Macht. Nun waren es Probleme der Bequemlichkeit und Disziplin, die besprochen wurden, weil es an der Pünktlichkeit zur Arbeit, an der Ehrlichkeit des Einsatzwillens, an der Freundlichkeit anderen Menschen gegenüber und an der Leistung mangelte. Dr. Ferdinand hatte Schwierigkeiten, das zu verstehn. Er ging davon aus, dass die jungen, schwarzen Ärzte mit einer hohen ethischen Einstellung aus dem Exil zurückkamen und alles daransetzten, am Patienten und zum Wohle der Menschen zu arbeiten. Das nahmen auch die Patienten an, die in den zurückgekehrten Ärzte den gebildeten Teil ihres Volkes sahen. Beide sprachen bis zum Gang ins Exil dieselbe Sprache und teilten dasselbe Elend und dieselbe Not. Die Erkenntnis erschütterte daher die Erwartung, die an diese Ärzte gestellt wurden: pünktlich bei der Arbeit zu erscheinen und verantwortlich und mit vollem Einsatz am kranken Menschen zu arbeiten. Einige taten es auch in vorbildlicher Weise. Doch andere taten es nicht. Und weil es auffiel, dass andere eine Laxheit an den Tag legten, die die Zusammenarbeit behinderte, kamen nun Dinge zur Sprache, über die eigentlich nicht gesprochen werden sollte, wenn jeder ehrlich und selbstkritisch zum ärzlichen Beruf stände und die Zeichen der Zeit zum Anlass nähme, wach zu sein und die eigenen Schwächen zu überwinden, die Wissenlücken durch Lernen zu schließen und sich voll für das Wohl der Menschen einzusetzen. Das musste nun in den Morgenbesprechungen vom Superintendent gesagt werden, als spräche er zu Kindern in der ‘primary school’. Es war beschämend und warf Schatten über den Weg, der gemeinsam in die Zukunft zu gehen war. Dass dann die Matronen noch erwähnten, dass Angehörige in der Kantine aßen, die dazu nicht berechtigt waren, machte die Sache mit der Ehrlichkeit noch fraglicher.
Es wurden noch Themen besprochen, die mehr oder weniger zeitlos waren, weil sie bis zum Überdruss schon vor der Unabhängigkeit besprochen worden waren, ohne dass sich praktisch viel geändert hatte. Dazu gehörten die Toiletten mit den verstopften Abflüssen, die klemmenden und tropfenden Wasserhähne, die angebrochenenen Bettgestelle, die alten, nach Urin riechenden Schaumgummimatratzen, das fehlende und unzureichende Verbandsmaterial in den Sälen, die fehlenden Malariatabletten zur Malariazeit, die ausgehenden Antibiotika in der Hospitalapotheke, und manches andere mehr. Beim Vorbringen der alten "Dauerbrenner", die gegen den Wechsel politischer Systeme immun zu sein schienen, vermisste Dr. Ferdinand die Anwesenheit der hageren weißen Matrone, die mutig und kompromisslos die Missstände anprangerte, die jeglicher Grundhygiene widersprach. Sie sprach in härtester Form vom Uringestank des Vorplatzes, der für jeden Menschen, der etwas auf Sauberkeit achtet, unzumutbar ist. Sie drohte mit Beschwerdebriefen an die Administration für Gesundheit, wenn sich der Superintendent nicht um die katastrophale Situation der Toiletten kümmere, die entsetzlich stänken, weil sie voll Scheiße und die Abflüsse verstopft sind. Die Superintendenten versagten toilettenmässig kläglich. Keiner von ihnen schaute da mal in die vollgeschissenen Schüsseln, auch mit zugehaltenen Nasen nicht. Alle waren sie sich für die Toilettenbesichtigung zu fein. Für sie galt das Motto: ich habe doch nicht so viele Jahre Medizin studiert, um dann als Arzt in die Scheiße einer verstopften Toilette zu sehen und mir den Gestank in die Nase und die Kleidung zu holen. Daran änderte auch die Unabhängigkeit mit der neuen Freiheit nichts. Keiner der Ärzte packte sich bei der Verantwortung und inspizierte die Toiletten, damit endlich dieser Saustall behoben wurde. Die Toilettenzustände nahm Dr. Ferdinand weiterhin als den wichtigsten Maßstab für die Bemessung der Sauberkeit eines Patientensaales und der praktizierten Verantwortung eines Superintendent, eines Gesundheitsinspektors oder ärztlichen Direktors. Er selbst mutete sich solche Inspektionen zu und war tief besorgt über die hygienischen Missstände und ihre möglichen Folgen für die Patienten im allgemeinen und die Wundheilungen im besonderen. Wenn er von dieser Inspektion berichtete, fand er entweder keine Resonanz oder bekam ein leichtes Lächeln des Bedauerns. Da lag die Sauberkeit bereits im Grundsätzlichen schwer im argen. Doch die rundliche Hauptmatrone sagte zu diesen Missständen kein Wort bei der Morgenbesprechung. Und die zweite Matrone, die noch vor der Unabhängigkeit das Gesicht verzog und die Grimasse des Ekelgefühls schnitt, wenn die hagere weiße Matrone diese Schweinereien anprangerte, verzog nun kein Gesicht. Da fragte sich Dr. Ferdinand nach dem Sinn schweigender Matronen, wenn sie poltern und die Schweinereien herausschreien sollten. Die Hygiene hatte seines Erachtens die höchste Priorität für ein Hospital, egal, wie man die Personaldinge parteipolitsch sah.
Die opportunistische Anpassung mit dem Schielen nach dem höheren Posten mit dem größeren Gehalt am Monatsende bei geringerem körperlichen Einsatz durfte auf die Sauberkeit eines Hospitals keinen Einfluss nehmen. Die Hygiene musste dringend verbessert werden. Dann käme es auch ohne Antibiotika zu besseren Wundheilungen. Schließlich forderte der Superintendent die Leiter der verschiedenen Abteilungen auf, benötigte Instrumente und andere Gebrauchsartikel für die Arbeit am Patienten schriftlich aufzulisten, um sie in das nächste Jahresbudget des Hospitals einzuplanen. Damit ging die Morgenbesprechung zu Ende. Die Kollegen und Kolleginnen verließen den Raum mit denselben Gesichtern, mit denen sie eine Stunde vorher den Raum betreten hatten. Das Lesen dieser Gesichter gab wenig Grund zur Hoffnung, dass die Worte über Pünktlichkeit, Arbeitseinsatz und Verantwortung dort angekommen waren, wo sie hingehören, nämlich in die Köpfe derjenigen, die sich als Arzt oder Ärztin ausgaben und im weißen Kittel vor den Patienten traten und ihn glauben ließen, dass sie es waren, die seinetwegen viele Jahre studiert und die Hürden der Prüfungen genommen haben, und wenn es im Exil war, als hier die Granaten bis vors Hospital einschlugen, um ihn zu behandeln und wieder gesund zu machen. Auf den Gesichtern der philippinischen Kollegen lag die asiatische Maske der Undurchschaubarkeit, und bei den Kubanern waren die Züge der Unantastbarkeit unverkennbar. Die Gruppenzugehörigkeit verlieh so etwas wie eine kollektive Sicherheit. Bei den Filipinos konnte es der gedachte asiatische Riese und bei den Kubanern der Anblick der erhobenen Fidel'schen Faust gewesen sein. Die Betroffenheit zog lediglich über die Gesichter der jungen Kollegen und Kolleginnen, die im Exil waren und es dort vielleicht nicht anders gelernt hatten. Denn das ärztliche Ethos war in den sozialistischen Ländern ungeschützt und oft verwundet. Die materialistische Daseinslehre geriet mit dem Ethos oft in Konflikt, der aufgrund der unterschiedlichen Sichtweise und Denkprinzipien kaum, und wenn, nur in Ausnahmen, nicht aber in der Regel lösbar war. Deshalb verwunderte die Unsicherheit nicht, die sich auf die Gesichter dieser noch jungen und wenig erfahrenen Ärzte gelegt hatte, als sie aus der Morgenbesprechung kamen. Komplizierend kam hinzu, dass sie über diese Probleme nicht sprachen und sich scheuten, da selbst Stellung zu nehmen. Exil und Sozialismus hatten in Bezug auf das persönliche Verhalten, die Erkennung und Anerkennung ethischer Werte ihre Stempel tief eingedrückt.
Dr. Ferdinand unterließ es, die Kollegin mit der Frage zu konfrontieren, was sie sich am frühen Morgen gedacht hatte, als sie den Verletzten mit den Hautrschürfwunden und der Schwellung des rechten Fußgelenkes gesehen und einfach liegen gelassen hatte, ohne die Schürfwunden zu behandeln, den Patienten zum Röntgen zu schicken und die Röntgenbilder abzuwarten und zu bewerten. Er konfrontierte die Kollegin nicht, obwohl sie einen "Tritt" verdient hätte, weil er befürchtete, dass sie nichts Vernünftiges dazu sagen würde. Und mit einer Floskel von der Art: "Für orthopädische Patienten bin ich nicht zuständig", wäre ihr und ihrer Weiterbildung auch nicht geholfen, da so ein Satz Anlass für eine uferlose Diskussion gäbe, die mehr zu Missverständnissen als zur Problemlösung führen würde. Eine musste eine gewisse Reife und einen Bildungsgrad voraussetzen können, die es ermöglichen, ein Gespräch ehrlich und konstruktiv zu führen. Da er diese Voraussetzungen bei der Kollegin nicht erkannte, vermied er das Gespräch. Er ging zum 'theatre' und wechselte im Umkleideraum die Kleidung. Im Teeraum goss er sich eine Tasse Tee ein, rührte zwei Löffel Zucker ein, stellte die Tasse auf die verkratzte und mit Kugelschreiber vollgeschmierte Holzplatte der niedrigen Tisches und setzte sich auf einen der ausgesessenen Polsterstühle. Er dachte nach, wo er nach all den Jahren gelandet, wohin der ärztliche Beruf geraten, wie weit runter er ethisch gerutscht war. Ärzte wie Dr. van der Merwe und der junge Kollege und begabte Schriftsteller gab es an diesem Hospital nicht mehr. Diese beiden Ärzte waren in ihrem Beruf voll aufgegangen, als um das Hospital die Granaten einschlugen und Boden und Wände viele Male so stark vibrierten, dass mit einem Einsturz der Gebäude gerechnet wurde. Diese beiden Kollegen betrieben eine Medizin mit menschlichem Antlitz und achteten dabei nicht auf ihre Uniformen. Die Patienten hatten das begriffen und diese beiden Menschen in ihr Herz geschlossen. Auch die Schwestern hatten beim Abschied der beiden Ärzte die Tränen in den Augen. Sie sagten, dass es solche Ärzte am Hospital wohl nicht wieder geben werde. Sie hatten Prophet isch gesprochen, denn in der Tat hat es solche Ärzte von so hohem menschlichen Format an diesem Hospital nicht mehr gegeben. Dr. van der Merwe und der junge Kollege waren leuchtende Ikonen in der Erinnerung der Menschen, die den Weg des Hospitals von vor der Unabhängigkeit bis in die ersten Jahre nach der Unabhängigkeit verfolgt hatten. Zu diesen Menschen gehörten die Schwestern und Dr. Ferdinand, der als einiziger Arzt noch aus jener Zeit kam und sich mit den beiden Kollegen und noch wenigen anderen unter den Bedingungen des Krieges für die armen Menschen in Not eingesetzt hatte. Der andere Arzt, der es wusste, weil er zum kleinen Fähnlein der Aufrechten in der Zeit der großen Anfechtungen gehörte, war Dr. Nestor, der seit kurzem die Abteilung Primäre Gesundheitsfürsorge (Primary Health Care) im Ministerium für Gesundheit und soziale Dienste leitete. Er war der erste schwarze Superintendent am Hospital zu einer Zeit, als die Tage der Burenmacht bereits gezählt wurden. Da waren offensichtlich Opportunistische Überlegungen bei der Regionalverwaltung im Spiel, weil im Norden die Verwaltungsleute und der 'Sekretaris' so gut wie alle Menschen wussten, dass der Systemwechsel seinen Anfang im Norden nehmen würde. Denn über die angolanische Grenze sollten Tausende von Exilanten ins Land zurückkehren. Und so wollten die Weißen ihr politisches "Alibi" mit einer schwarzen Jacke bezeugen und sich für das neue System akzeptabel machen, wenn es um die Posten für die Büros in den oberen Etagen unter der schwarzen Regierung geht.
Der philippinische Kollege teilte Dr. Ferdinand beim Händewaschen mit, dass er am nächsten Tage, einem Donnerstag, seine Töchter von der Konventschule in Windhoek abholen wolle, da die Schulferien begännen. Sie trockneten sich die Hände im Fließpapier und ließen sich die sterilen grünen Kittel überziehen, als Dr. Ferdinand nach dem Standard dieser Schule fragte, die von denselben Ordensschwestern geführt wurde wie das angrenzende Hospital. Der Kollege sprach mit Achtung von der Schule und meinte, dass der Leistungsstand, verglichen mit anderen Schulen, hoch sei. Doch seien auch die Schulgebühren hoch. Das Gehalt seiner Frau, die Biologie in den höheren Klassen einer Grundschule unterrichte, helfe da aus der Enge.
Der Patient zur operativen Versorgung eines rechtsseitigen Oberarmbruches lag in Narkose, und die OP-Schwester deckte ihn mit grünen Tüchern ab. Dr. Ferdinand fragte den Kollegen, ob er die Operation durchführen wolle. Er erwiderte ohne einen gedanklichen Verzug: "It's okay. You do the Operation!" Die Schwester reichte das Skalpell, und Dr. Ferdinand schnitt die Haut längs an der Außenseite. Dann schnitt er die Muskelhülle ein und trennte die Muskelportionen in Faserrichtung stumpf mit dem Finger. Er stellte den Oberarmknochen dar, der in mehrere Stücke gebrochen war. Dann suchte er den Speichennerv auf, der den Knochen überquert, und sicherte ihn hinter einem Wundhaken. Die Bruchstücke wurden zusammengesetzt und in anatomischer Stellung an eine schmale Sechslochplatte geschraubt. Der Speichennerv blieb unbeschädigt. Dann erfolgte der schichtweise Wundverschluss des Weichteilmantels mit EinzelknOPfnähten und das Anwickeln des Verbandes. Der ukrainische Kollege, der sich scheute, einige Sätze in seinem Stakkato-englisch hintereinander zu sprechen, sagte "okay? Okay!" und zog den Atemtubus aus der Luftröhre. Der Operierte wurde vom Tisch auf die Trage gehoben und mit der Sauerstoffmaske über Mund und Nase in den Aufwachraum gefahren. Der philippinische Kollege zog sich nach dieser Operation im Umkleideraum die zivile Kleidung an und machte sich auf den Weg zum OPD (Outpatient department), um in Raum 4 die orthopädischen Patienten zu sehen und zu behandeln. Dr. Ferdinand machte eine kurze Teepause, da noch zwei Operationen ausstanden, eine Stumpfrevision am Oberschenkel und eine Vorfußamputation.