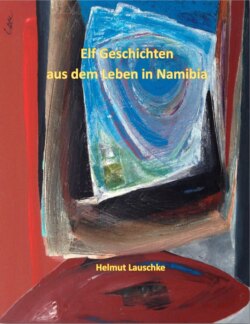Читать книгу Elf Geschichten aus dem Leben in Namibia - Helmut Lauschke - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Probleme in der Notfallchirurgie
ОглавлениеWas war passiert? Eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, lag auf dem OP-Tisch. Ihr "Freund" hatte ihr in den Bauch geschossen, weil sie ihn nicht mehr liebte und nicht mehr mit ihm schlafen wollte. Der junge Mann hatte sich anschließend selbst getötet, indem er sich durch den Mund in den Kopf geschossen hatte. Im eröffneten Bauch der jungen Frau stand ein Blutsee, den der junge Kollege nicht unter Kontrolle brachte. Der Narkosearzt hatte ihr bereits drei Konserven der Blutgruppe Null transfundiert. Nur zwei Konserven waren noch verfügbar. Das war alles, was im Labor aufzutreiben war. Von den Abdecktüchern tropfte das Blut auf den Boden, wo eine Schwester grüne Tücher auslegte. Dr. Ferdinand sog das Blut mit einem Sauger ab, während der Kollege eine große Kompresse auf die Milz und linke Niere drückte. Der Dünndarm wies an mehreren Stellen Löcher auf, aus denen Darminhalt heraustrat und sich mit dem Blut vermischte. Der Narkosearzt war nervös und sagte, dass der Blutdruck nicht mehr messbar sei. Dr. Ferdinand ordnete an, den Tisch in Kopftieflage zu bringen. Mit dieser einfachen Massnahme und dem ständigen Druck auf die Milz und linke Niere gelang es, die massive Blutung zu drosseln. Dann klemmte er die blutenden Gefäße zur Milz ab, sah, dass das Organ völlig zerrissen war, und entfernte die Milz mit wenigen Handgriffen. Er stopfte die Milzloge mit einer großen Kompresse aus. Der nächste Schritt galt der linken Niere, wo es aus einem Kapsel- und darunterliegenden Parenchymriss diffus blutete. Dr. Ferdinand legte einige Parenchym- und Kapselnähte und brachte so die Blutung zum Stehen. Er revidierte die großen Gefäße des Nierenstiels, die unverletzt geblieben waren. Dann revidierte er die Dünndarmschlingen von der oberen Flexur, wo der Zwölffingerdarm in den Leerdarm übergeht, bis zum Übergang des Krummmdarms in den aufsteigenden Dickdarm oberhalb des Blinddarms mit dem Anhängsel des Wurmfortsatzes. Die meisten Löcher konnten durch zweischichtige Wandnähte verschlossen werden. Doch war die Durchblutung einiger Schlingen des Krummdarms soweit gestört, dass Abschnitte, die livide verfärbt waren, herausgeschnitten und die Darmenden neu verbunden wurden. So mussten drei Anastomosen durch zweischichtige Nähte hergestellt werden. Dann wurden die keilförmigen Lücken am Darmgekröse durch Nähte geschlossen. Es war eine mehrstündige Operation, in deren Verlauf die Patientin viel Blut verloren hatte. Der Narkosearzt hatte seine Nervosität beibehalten, obwohl er den Blutdruck wieder für messbar erklärte, wenn auch der obere Wert weit unten lag und der Puls jagte. Von den fünf Blutkonserven waren vier gegeben und das Volumendefizit weitgehend mit Plasma- und Plasmaersatzlösungen aufgefüllt. Über den Blasenkatheter entleerte sich nur etwas Urin infolge des Kreislaufschocks. Der Urin war durch die Nierenverletzung blutig. Dr. Ferdinand führte ein Gummirohr in die Bauchhöhle, dessen Ende in die tiefste Bauchtasche hinter der Gebärmutter gesenkt wurde. Diese Tasche hieß Douglas-Tasche und war nach seinem Erstbeschreiber James Douglas, Arzt und Anatom in London (1675-1742) benannt. Erst beim Vorschieben des Gummirohres in diese Tasche fiel ihm die vergrößerte Gebärmutter auf, deren Größe einer frühen Schwangerschaft entsprach. Er bezweifelte, dass das noch junge Embryo diese Tortur überlebte und die Schwangerschaft ausgetragen würde, vorausgesetzt, die Mutter käme mit dem Leben davon. Die fünfte Blutkonserve lief und war bereits halbleer. Das Gummirohr wurde durch eine gesonderte Inzision durch die Bauchdecke gezogen und an einen Drainagebeutel angeschlossen. Dann entfernte Dr. Ferdinand die große Mullkompresse aus der Milzloge und unterzog die Bauchhöhle einer letzten Revision. Zwischen Hoffnung und Zweifel vernähte er schließlich die Schichten der Bauchwand und legte den Verband auf, der mit einigen breiten Pflasterstreifen fixiert wurde.
Die Operierte wurde vom Tisch auf die Trage gehoben. Da musste doch der Narkosearzt wirklich gebeten werden, für einen Moment die Eintragung seiner Notiz zu unterbrechen und mit anzufassen. Diese Art der Fehlkommunikation hatte es früher nie gegeben. Dr. Ferdinand nannte sie deshalb 'Post-independence-way of communication'. Mit der Sauerstoffmaske auf dem Gesicht wurde die Patientin in den Aufwachraum gefahren. Da sie sich in einem kritischen Zustand befand, war eine längere Kontrolle mit Aufzeichnung der lebenswichtigen Parameter erforderlich. Der Narkosearzt, der nach dem Zusammenbruch des Sowjetreiches den weiten Weg von der Ukraine zum Norden Namibias unternommen hatte, um am Oshakati Hospital für ein besseres Geld Narkosen zu geben, hatte nun den kurzen Weg genommen, sich umgezogen und aus dem 'theatre' entfernt. Er hatte das Narkose-geben streng wörtlich genommen und die Dinge um die Narkose herum einfach ignoriert, als wäre seine Tätigkeit mit dem Einsetzen der Spontanatmung beendet. So wechselte Dr. Ferdinand das durchschwitzte OP-Hemd gegen ein trockenes aus, ging in den Aufwachraum, betrachtete den Urinkatheter, der nur etwas Urin förderte, dessen Farbe unverändert blutig war. Es mass selbst den Blutdruck, dessen oberer Wert weiter im "Keller" lag und vom unteren, diastolischen Wert nicht weit entfernt war. Er musste einige Male die Druckmanschette aufpumpen und die Luft langsam herauslassen, um das Oben und Unten des Blutdrucks durch wiederholte Messungen allmählich herauszuhören. Der Puls raste in flachen Wellen wie verrückt, als läge das Leben in seinen letzten Zügen. Dr. Ferdinand ließ die EKG-Kabel an den Monitor anschließen und verfolgte mit Sorge die rasende Herzfrequenz mit den eingestreuten Extrasystolen. Die Infusion mit Plasmaexpandern wurde verstärkt, die Tropfzahl pro Minute drastisch erhöht. Die Blut- und Plasmakonserven waren verbraucht. Nun musste mit Expandern und kristallinen Lösungen ausgekommen werden. Es war eine peinliche Situation. Er legte Kissen unter die Beine, um den venösen Rückfluss aus den höherliegenden Beinen zu beschleunigen. In der Tat zeichnete sich nach etwa zehn Minuten eine erste leichte Verbesserung der Kreislaufverhältnisse ab. Das Herzrasen ließ nach, die Extrasystolen gingen zurück, die Entfernung des oberen vom unteren Messwert des Blutdruck nahm geringgradig zu, und der Puls wurde deutlicher fühlbar. Dr. Ferdinand bestand darauf, die Kontrolle im Aufwachraum fortzusetzen. Er setzte sich mit dem jungen Kollegen in den Teeraum, um bei einer Tasse Tee mit ihm den Fall zu besprechen. Dabei gab er dem Kollegen recht, ihn gerufen zu haben, meinte aber, dass er das schon zu Beginn der OP hätte tun sollen, weil dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der Blutverlust nicht so hoch gewesen wäre. Der junge Kollege, der in Kuba Medizin studiert und seine ersten Schritte in der Chirurgie am Oshakati Hospital getan hatte, sah es ein und begründete sein Verhalten doch recht menschlich, indem er sagte, dass er den Dr. Ferdinand nicht bei jeder Laparotomie rufen wollte, weil ihm etwas Ruhe auch gut tun würde. Sie besprachen einige technische Einzelheiten beim Vorliegen einer Milzruptur und Nierenverletzung. Dabei zeigte sich eine solide anatomische Kenntnis, die der Operativen Unerfahrenheit gegenüberstand. Sie gingen zum Aufwachraum zurück und fanden die Patientin in einem weniger kritischen Zustand. Der Blutdruck war besser messbar. Der obere, systolische Wert war noch unten, aber nicht so tief im "Keller" wie zuvor. Auf dem Monitor begann sich das Herzflattern zu beruhigen. Dennoch war die Frequenz der Kammerkontraktionen hoch. Die unregelmässig eingestreuten Extrasystolen waren weniger geworden. Aufgrund des angestiegenen Blutdrucks kam auch die Urinausscheidung etwas mehr in Gang. Durch die Nierenverletzung war der Urin jedoch noch blutig verfärbt. Die Patientin wurde dann zur 'Intensiv'-Station gefahren, wo Dr. Ferdinand die Schwestern der Nachtschicht über die durchgeführte Operation informierte und die weiteren Massnahmen der Überwachung besprach.
Der Morgen begann zu dämmern, als sich Dr. Ferdinand auf den Weg zur Wohnstelle machte. Die ersten Vögel zwitscherten in den Bäumen, als er den Platz vor dem Neubau der Ortsverwaltung überquerte. Es war noch still im Dorf. Die Menschen schliefen, und die Hunde und Katzen machten es ihnen nach. Er schloss die Tür auf, streifte sich die verschwitzten Sandalen von den Füßen und setzte sich mit einer Zigarette auf den Absatz der Terrasse. In seinen Gedanken sah er die junge Frau hilflos im Bett der 'Intensiv'-Station liegen, die zu schwach war, um über das, was vorgefallen war, zu weinen. Sie lag kraftlos im Bett, wusste vielleicht nicht, dass sie schwanger war, und überließ jede Entscheidung über Leben und Tod dem Schicksal, den Schwestern und dem Arzt. Es war ein Phänomen der Zeit, dass viele junge Menschen trotz Unabhängigkeit und der neuen Freiheit nicht nur unglücklich waren, sondern das Leben anderer Menschen bedrohten, ihnen das Leben bedenkenlos wegnahmen und sich dann in einigen Fällen selbst das Leben nahmen. Sie taten es mit Messern, mit denen sie wie Verrückte in andere Brustkörbe und Bäuche stachen, oder mit Pangas, die sie schwertmässig hantierten, wenn sie auf andere Köpfe einschlugen und sie spalteten, als müsste da Holz kleingehackt werden. Nun gab es Schusswaffen en masse im privaten Besitz, die mit den Leuten aus dem Exil ins befreite Land gebracht wurden. Diese Kalaschnikows und andere Waffen kamen mit genügend Munition zurück, um sie nach der Unabhängigkeit in der neuen Freiheit als eigener Befehlshaber in Betrieb zu setzen. Es war Opportun, einem Mann, der bewaffnet aus dem Exil zurückgekommen war, nicht auf die Nerven zu gehen oder anderswie querzukommen. Je dümmer der Kopf war, desto größer war die Gefahr, dass seine rohen oder anderswie 'verknoteten' Nervenstränge wie eine Zündschnur abbrannten und er von der Waffe Gebrauch machte. Da kannte sich ein solcher RohKopf schneller aus als im Sprachversuch, einen Satz mit Gegenstand und Aussage zu sprechen. Es war eine Tatsache geworden, dass Menschen, die gefährlich werden konnten und vor der Unabhängigkeit nicht der Koevoet (Brecheisen) sondern der PLAN (People’s Liberation Army of Namibia) angehörten, nach der Unabhängigkeit voll in die Familien integriert wurden. Da gab es also in fast jeder Familie eine Waffe, mit der geschossen und getötet werden konnte. Trotz Aufruf der Regierung, der einige Male wiederholt wurde, haben nicht alle 'PLAN-fighter' ihre Waffen abgegeben. Dieses Verhalten ließ den Denkschluss zu, dass man sich nach der Unabhängigkeit in Namibia, wie in anderen afrikanischen Ländern auch, mit einer Schusswaffe sicherer fühlt. Da war eben viel an menschlichem Vertrauen im Verlauf der jüngsten Geschichte zusammengebrochen. Es war ein pathologisches Zeichen, das seine bedenklichen Schatten in die Zukunft warf. Am schlimmsten war es, wenn einer jungen Mutter in ihrer Schwangerschaft in den Bauch geschossen wurde, wo der Föt in utero erschossen und die tragende Gebärmutter dermaßen zerrissen und zerfetzt wurde, dass sie mit der erschossenen Frucht entfernt werden musste, und die Schwangere trotzdem an den Folgen der Verblutung verstarb. Das war zutiefst entsetzlich und blieb kein Einzelfall. Auch stieg die Selbstmordrate nach und trotz der Unabhängigkeit an. Junge Menschen hingen sich an den Bäumen auf. Ihre leblosen Körper hingen "respektlos" herunter und baumelten bei leisem Windstoss sinnlos herum. Es traf die Familien schwer, die es nicht begreifen konnten, warum es geschah. Die Zeichen der Zukunft standen eben nicht so gut, dass sie vor allem jungen Menschen Trost und Zuversicht gegeben hätten, die möglicherweise dann am Leben geblieben wären. Die meisten jungen Menschen fanden keine Arbeit, selbst dann nicht, wenn sie einen mittleren Schulabschluss hatten. Und ohne Einkommen wollten sie nicht sein, wenn sie daran dachten, ein Mädchen nicht nur zu lieben, sondern es zu heiraten. Doch eine Lobola kostete Geld, wenn es den Vater oder die Mutter nicht gab, die da mit Rindern und Ziegen aushalfen. Es gab genug von denen, die es als gesunde junge Männer versucht hatten, zunächst in der großen Stadt (Windhoek) oder in einer der kleineren Küstenstädte (Walvis Bay, Swakopmund oder Henties Bay), die alle mehrere hundert Kilometer weit weg von den Familien waren. Sie hatten versucht, dort eine Arbeit zu finden, um ein Auskommen fürs Leben zu haben. So war ihre Absicht eine ehrliche. Doch diese Absicht ließ sich bei den meisten nicht durchhalten. Mit zunehmender Trübung der Lebensaussicht, weil sie keine Arbeit auf ehrlicher Basis fanden, rutschte auch ihre Absicht immer mehr ins Unehrliche ab. Sie pumpten sich das Geld und konnten es nicht zurückzahlen. Sie begannen zu stehlen und zu rauben. Sie beteiligten sich an Autodiebstählen und Hauseinbrüchen jeglicher Art. Sie glitten in die Drogenszene ab und verwickelten sich in Schlägereien, bei der es Verletzte und Tote gab. Einige von ihnen kamen hinter Gitter, von denen die Mehrzahl wegen Überfüllung der Gefängnisse zu früh auf Bewährung freigelassen wurden und ihr gefährliches Treiben fortsetzten. Es war schier unmöglich, ein geordnetes Leben mit einem bescheidenen Einkommen durch eine ehrliche Arbeit zu erzielen. Es waren immer Dummköpfe und Faulenzer, die da kriminell abrutschten. Oft war ihre Intelligenz auch in der ehrlichen Absicht jener Intelligenz überlegen, die ihre Sitzposten in den Ministerien und halbstaatlichen Organisationen hatten. Doch da war es die Vetternwirtschaft, dass Leute mit geringerer Intelligenz auf die Stühle kamen und mitunter nicht wussten, wozu sie einen Schreibtisch hatten, aber schnell herausfanden, dass man mit den Telefonen auf den Schreibtischen lange und ungestört auf Staatskosten telephonieren konnte. Zum guten Gehalt für die weniger gute Arbeit kamen die Zulagen für die staatliche Pensionskasse, die Krankenkasse und so manches andere Nützliche bis hin zu den regelmäßigen Gehalterhöhungen hinzu, an die ein Mann oder eine Frau von der Straße, auch wenn sie mit höheren IQ's aufwarten konnten, nicht herankamen, da sie eben keine Vettern und Tanten in den höheren Schreibtischetagen hatten. Es gab junge Männer, die enttäuscht in den Norden zurückkehrten, wenn sie nicht zuvor ganz abgerutscht waren und für längere Zeit ihre Strafen in den überfüllten Gefängnissen abzusitzen hatten. Andere kamen krank zurück. Andere hatten sich mit dem tödlichen AIDS-Virus infiziert. Man konnte es aus ihren mageren Gesichtern ablesen, dass sie bald am Ende waren. Andere kamen mit anderen Dingen und Verletzungen, einige von ihnen mit falschen Diamanten. Kaum einer hatte es geschafft, durch ehrliche Arbeit etwas erreicht zu haben, worauf die Familie stolz sein konnte. In vielen Fällen wurden die Familien beschämt.
Bei den Mädchen lief es etwas anders, aber meist nicht besser. Auch da gab es genug, die es zunächst ehrlich in einer der Städte versuchten. Manche schafften es zur Sekretärin, zur Angestellten bei der Post oder Telecom, zur Bankangestellten oder Serviererin in einem Hotel. Doch die meisten schafften es nicht, sich durch ehrliche Arbeit am Leben zu halten. Sie begaben sich in Abhängigkeit zu zweifelhaften Typen, die ihnen Räume vermieteten, wo sie zu zweit oder dritt lebten und schliefen. Sie schickten die Mädchen auf den Strich und kassierten sie beim Schichtwechsel gnadenlos ab. Sie fickten sie aus allen Richtungen, bumsten sie weich und schlugen sie handrücks ins Gesicht, wenn sie nicht parierten. Manche Mädchen hatten einen IQ, den manche Stuhlinhaber hinter den Schreibtischen in den Ministerien und anderen Organisationen nicht hatten. Das Dilemma war, dass die Mädchen keine Vettern oder Tanten in den höheren Verwaltungsetagen hatten, die sie da um Unterstützung und Nachhilfe bitten konnten. Es war eine bittere Erfahrung, dass ohne Vettern und Tanten, die einen bis zu einem gutbezahlten Schreibtischposten durchboxen konnten, einfach nichts zu machen war, egal, welchen Schulabschluss man hatte. So kehrten viele der Mädchen, oft schwanger oder vom tödlichen Virus befallen, zu den Familien im Norden zurück. Sie waren nicht mehr der Stolz der Familien, wenn sie mit nichts, stattdessen mit einem Baby im Bauch oder mit dem tödlichen Virus im Blut zurückkehrten. Die Heimkehrer waren dankbar, wenn sie wieder den gewohnten Papp bekamen und auf ihrem Schlafplatz schlafen konnten, ohne ständig belästigt zu werden. Sie nahmen es ohne Widerspruch hin, im Feld zu arbeiten, nach den Ziegen zu sehen und das Wasser in Kannen und Kübeln auf den Köpfen herbeizutragen, so wie es ihre Mütter und Großmütter taten. Mit der neuen Freiheit kamen neue Herausforderungen, die für viele Familien zur Zerreißprobe wurde und viele Familien zerrissen und zerbrochen hatten. Die Kinder waren die Leidtragenden. Sie, mit den Wasserbäuchen, den spindeldürren Armen und Beinen und die vielen anderen abgemagerten Kinder, gaben von der Halt-, Lieb- und Schutzlosigkeit in den zerbrochenen Familien erschütternde Zeugnisse. Ferdinand dachte an die Verse im Faust II (1. Akt):
"O Jugend, Jugend, wirst du nie
der Freude reines Mass bezirken?
O Hoheit, Hoheit, wirst du nie
vernünftig wie allmächtig wirken?"
Ferdinand stellte sich unter die Brause und machte sich frisch. Er fühlte sich abgespannt und müde. Doch war an Schlaf wie in so vielen Nächten nicht zu denken. Die Hähne krähten in halbstündlichen Abständen den Morgen ein, und die Sonne schickte ihre ersten Strahlen über den Horizont. Es war Donnerstag. Er musste ohne den philippinischen Kollegen zurechtkommen, der sich an diesem Morgen mit seiner Frau, die als Lehrerin im Norden das zweite Gehalt einbrachte, auf den weiten Weg nach Windhoek machte, um mit Beginn der Schulferien die Töchter von der Konventschule abzuholen. Er trank die Tasse Kaffee, drückte die Zigarette auf der Untertasse aus, zog sich die Sandalen über, verschloss die Eingangstür, hängte das Vorhängeschloss an der Gittertür ein und drückte den Bogen bis zum Klicklaut ins Gehäuse. Er nahm den direkten Weg zum Hospital. Sonnenstrahlen zogen durchs Laubwerk der Bäume und steckten die Ostwand des neuen Verwaltungsgebäudes in ein grelles Licht. Die Vögel in den Bäumen zwitscherten den frühmorgendlichen Wechselgesang von den Bäumen und freuten sich auf ihre "gregorianische" Art über den anbrechenden Tag. Bei den Vogelstimmen, die mitunter wunderschöne Melodien brachten, dachte Ferdinand an Maurice Ravel, der auf die Frage, ob ihn eine Beethoven-Sonate stimulieren würde, wenn er beim Komponieren war, worauf Ravel antwortete: nicht Beethoven, aber die singenden Vögel würden es tun.
Der zerfledderte Lattenzaun gegenüber den fünf hochgestelzten Caravan-Häusern löste sich mehr und mehr in seine Einzelteile auf. Da wurden die verbliebenen Latten aus den Planken herausgeschlagen und zu Brennholz in noch kleinere Stücke gebrochen. Der Drang, die Dinge dem eigentlichen Zweck zu entfremden, Zäune, Türen und anderes Gut zu entfernen, was öffentliches Eigentum war, setzte sich mit der neuen Freiheit noch ungenierter fort als vor der Unabhängigkeit. Es wurde zerhackt und zerschlagen, was man in die Hände bekam, es wurde geklaut und weggetragen, was nicht niet- und nagelfest war. Entsprechend veränderte sich das Erscheinungsbild des Dorfes in Richtung Verwahrlosung. Die zunehmende Versandung mit den immer tiefer greifenden Wüstententakeln tat ihr übriges. Auch die Verschmutzung mit Plastiktüten, Bierflaschen und leeren Coca- und Fantadosen auf den Straßen und in den Seitengräben nahm ungehindert zu. Es gab Bäume, in denen mehr Plastiktüten als Blätter an den gebrochenen Ästen hingen und vom Wind hin und her geschlagen wurden. So war es kein Wunder, dass an vielen Häusern die Fensterscheiben zerschlagen, die Vor- und Hintergärten verkommen und von einer Sandschicht überzogen waren, aus der die toten Gerippe vertrockneter Sträucher und Bananenbäume völlig unsinnig heraussteckten. Auch da nahmen herumliegende Bierflaschen und Cocadosen zu. Es ging noch nicht in die Köpfe, dass ein Dorf sauber zu halten war. Dazu kamen die durchs Dorf geführten Rinder- und Ziegenherden, die auch durch die Gärten gingen und das letzte Grün von den Büschen und jungen Bäumen frassen. Beim Abgrasen des Dorfes verhielten sie sich sportlich und sprangen über einmeterfünfzig hohe Zäune wie nichts. Da diese Herde im Dorf nächtigten, wurden die Gärten nicht nur tagsüber, sondern auch nachts heimgesucht, wenn man gerade eingeschlafen war. Bei dieser Art der Weidewirtschaft war ein kleiner lebender Garten schnell dahin. Diese Blattfresser, zu denen sich auch Esel und ein Schwein gesellten, nahmen keine Rücksicht, ganz gleich, ob die Pflanzen schon "röchelten" oder ganz erstickt waren. Diese Vierbeiner machten Tabula rasa und ließen nichts zurück. Am nächsten Morgen kannte man den "Garten" nicht wieder, als hätte es ihn nie gegeben. Und die unverschämten Ziegen knabberten noch die Enden der grünen Zweige weg, bevor man sie mit dem Stock erwischte und davonjagte.
Der Pförtner hinter der Einfahrt saß schief auf seinem Stuhl, dessen Hinterbeine tiefer im Sand steckten als die Vorderbeine. Er steckte das ganze Ei dann in den Mund, als Dr. Ferdinand an ihm vorbeiging und ihm den MorgenGruß in seiner Sprache gab. Der Pförtner konnte den Gruß mit vollem Mund nicht erwidern. Stattdessen rieb er die Eierschalenstücke mit dem rechten Schuh in den Sand. Auf dem Vorplatz, von dem der Uringeruch nie wegzudenken war, stand ein Karren mit vorgespanntem Esel, auf dem eine junge Frau saß, die sich beide Hände auf den vorgebuchteten Bauch hielt. Es war offensichtlich, dass diese Frau unter Wehen stand und alles dransetzte, ihr Baby im Kreißsaal und nicht hier auf dem scharf riechenden Vorplatz zur Welt zu bringen. Zwei Männer hoben sie vom Karren und führten sie an der Rezeption vorbei in das 'Outpatient department'. Dr. Ferdinand ging links am Esel vorbei, der sich nicht bewegte und mit runtergelassenen "Jalousien" zu schlafen schien. Die Schwestern der 'Intensiv'-Station berichteten, dass die junge Frau, die in der Nacht Operiert wurde, ruhig geschlafen habe. Die Patientin war ansprechbar und klagte über Schmerzen im Bauch. Ihre Körpertemperatur war erhöht. Dr. Ferdinand zog die Decke über ihr zurück und sah, dass sich im Drainagebeutel eine beachtliche Menge Blut angesammelt hatte. Die Bauchdecke war weich und der Verband blutig. Die Beine lagen auf zwei Kniekeilen, von denen der rechte höher als der linke war, weil es keine zwei gleichhohen gab. Beim Blutdruck lag der obere Wert noch immer tief, er war allerdings nicht ganz im "Keller". Der Puls ging schnell. Auf dem Monitor unterbrachen noch immer Extrasystolen die rhythmische Folge der Herzschläge. Die Urinausscheidung hatte leicht zugenommen, und die blutige Verfärbung des Urins war zurückgegangen. Er notierte im Verlaufsbogen, den Blutfarbstoff und die Elektrolyte im Serum zu bestimmen. Das Problem bestand weiter, dass der Patientin, die sich noch nicht aus dem Kreislaufschock erholt hatte, kein Blut oder Plasma gegeben werden konnte, weil da nichts vorrätig im Kühlschrank des Labors war. Der Patientenbus, der auch die Blut- und Plasmakonserven von der Blutbank aus Windhoek brachte, sollte erst am folgenden Tag, einem Freitag, zurückkommen, wenn alles planmässig verlief und er nicht mit einem Achs-, Rad- oder Motorschaden irgendwo auf der siebenhundertfünfzig Kilometer langen Strecke liegenblieb. Denn der Bus war bereits ein Veteran noch aus der Zeit der Apartheid, der nach der Unabhängigkeit längst durch einen neuen hätte ersetzt werden müssen.
Dr. Ferdinand sah noch nach den anderen Patienten, von denen einige auf die normalen Säle verlegt werden konnten, da sie einen stabilen Zustand erreicht hatten. Er wünschte den Patienten eine gute Besserung und den Schwestern der Frühschicht einen guten Tag. Dann ging er zu den orthopädischen Sälen, um dort nach den Patienten zu sehen. Im Kindersaal lagen wieder zwei Kinder, die eine explodierende Landmine überlebt hatten, dafür aber ein Bein bei einem elfjährigen Jungen und einen Unterarm und Fuß bei einem Mädchen von dreizehn Jahren verloren. Die herumliegenden Minen waren noch immer ein enormes Sicherheitsrisiko besonders für die Kinder, die meist aus Neugier oder beim Spielen vom Weg abwichen, den zu gehen ihnen aufgegeben war. In manchen Fällen ereigneten sich diese Verletzungen unweit vom Kraal, wenn Kinder die Ziegen zusammentrieben, um sie in die offenen Stallungen zu bringen.