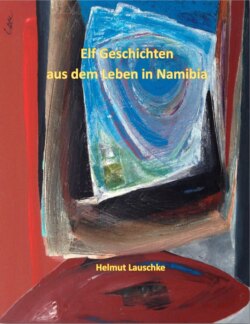Читать книгу Elf Geschichten aus dem Leben in Namibia - Helmut Lauschke - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vom Drang nach Freiheit; Platos Höhlengleichnis
ОглавлениеIm Teeraum saßen kubanische und einheimische Kollegen. Sie tranken Tee und schwiegen. Selbst der Kollege in der Chirurgie, der in Kuba auf der 'Insel der Jugend' in einem Heim aufgewachsen und dort zur Schule gegangen war und danach an der Universität in Havanna Medizin studiert hatte, sagte kein Wort, obwohl er sonst ein gut ansprechbarer und humorvoller Kollege war, der besser spanisch sprach als Oshivambo, die Sprache seiner Herkunft. Alle machten ernste Gesichter, als hätte ihnen das Leben eine schwere Bürde aufgegeben. Bei den kubanischen Kollegen konnten es auch Gedanken an die Freiheit gewesen sein, die in ihrem Lande stranguliert war. Da hatten einige die Gruppe verlassen. Einer, der als Urologe am Hospital in Windhoek arbeitete und der Gruppenleiter war, überquerte mit einem vom Ministerium zur Verfügung gestellten Auto die angolanische Grenze, meldete sich dort als politischer Flüchtling und setzte seinen Weg nach Luanda fort, wo er als Arzt seine Tätigkeit an einem Hospital aufnahm. Das Auto ließ er hinter der Grenze mit der grünen Nummernschildplatte eines Dienstwagens der namibischen Regierung zurück. Es wurde etwa zwei Wochen nach seinem Verschwinden von Angola nach Windhoek zurückgebracht. Dieser Kollege, der sich durch seine herzliche Freundlichkeit von seinen übrigen Kollegen unterschied, hatte Erfolg, der durch den dringenden Ärztebedarf in Angola nach dem langen Bürgerkrieg begründet war. Der Bedarf war so dringend, dass jeder Arzt willkommen war und mit Kusshand genommen wurde. Ein anderer kubanischer Kollege war ein Spezialist für Orthopädie, der anlässlich eines geplanten Heimaturlaubs in Toronto zur Überraschung der anderen das Flugzeug verließ, das dort kurz gelandet war und für den Weiterflug nach Havanna auftankte. Dieser Kollege lief mit seinem kubanischen Reisepass in der Hand zu den kanadischen Behörden im Flughafengebäude und meldete sich als politischer Flüchtling. Die anderen flogen ohne ihn und mit gemischten Gefühlen nach Havanna weiter. Der Kollege hingegen machte im Laufe eines Jahres seinen Weg nach Süden bis nach Miami in Florida, wo sein Bruder als Chirurg eine Privatklinik leitete. Es gab noch einen Fall, wo ein kubanischer Kollege und seine Freundin, die beide als Ärzte in den Norden abkommandiert wurden, die Urlaubsreise zu einer Reise nach Portugal benutzten, wo sie sich als politische Flüchtlinge registrieren ließen. Die Lehre aus der Geschichte war, dass die Urlaubsflüge von der Botschaft bei einer bestimmten Fluglinie organisiert und die ReiSpäße noch vor Besteigen des Flugzeugs von einem "zuverlässigen" Angehörigen der Botschaft eingesammelt wurden. Keiner verfügte über seinen Reisepass während des Fluges. Sie waren alle fest in der Hand am verlängerten Fidel'schen Arm. Man konnte die mächtige Faust auf die Tischplatte quasi krachen hören.
Der ukrainische Kollege leitete die Narkose bei dem Patienten zur Stumpfrevision am linken Oberschenkel ein. Es war ein älterer Mann, der sein Bein wenige Wochen vor der Unabhängigkeit durch eine Landmine verloren hatte. Bei der Explosion erlitt er außerdem Verletzungen im Gesicht und am linken Arm. Ein Splitter steckte in seinem linken Auge, das erblindet war. Er hatte Narben im Gesicht, von denen eine quer über den Nasenrücken lief. Eine andere Narbe zog vom Kinn bis zum rechten Ohr, dem ein beachtlicher Teil fehlte. Der linken Hand fehlten der Zeigefinger ganz und der Mittelfinger bis zur Hälfte. Aus dem Oberschenkelstumpf drückte sich der Knochenschaft durch den entzündeten Weichteilmantel durch. Die OP-Schwester war noch mit dem Abdecken beschäftigt, als Dr. Ferdinand gewaschen und mit grünem Kittel an den OP-Tisch trat und sich bei der Betrachtung des Stumpfes die OP-Handschuhe überzog. Der Tisch wurde mit dem Patienten hydraulisch gehoben. Die Schwester reichte das Skalpell. Dr. Ferdinand holte sich das 'grüne Licht' vom ukrainischen Narkosearzt, der mit "yes, yes, yes!" in schneller Folge sein Einverständnis gab, mit der Operation zu beginnen. Nach Setzen des Fischmaulschnittes wurde die Knochenhaut und Muskulatur mit einer Raspel nach oben geschoben und der exponierte Knochenstumpf mit der oszillierenden Säge um etwa sechs Zentimeter gekürzt. Der Knochenrand wurde mit einer Feile geglättet und die Lefzen des Weichteilmantels über dem Stumpf in Schichten vernäht. Der Narkosearzt sagte "okay?, okay!" und zog den Atemtubus aus der Luftröhre des Patienten. Der hustete, als Dr. Ferdinand ihm den Stumpfverband anwickelte. Mit jedem Hustenstoss stieß er den Stumpf hin und her, was das Anwickeln des Verbandes erschwerte. Schließlich wurde der Patient vom Tisch auf die Trage gehoben und mit der Sauerstoffmaske auf dem Gesicht in den Aufwachraum gefahren.
Eine junge Schwester wischte den Boden. Die OP-Schwester wusch sich die Hände, ließ sich den grünen Kittel überziehen, ging in den OP, öffnete das Instrumentensieb und legte die Instrumente auf dem erhöhten Tisch zurecht. Die Patientin zur Vorfußamputation, eine alte, hagere Frau, die über die sechzig gewesen sein musste, wurde in den OP gefahren und auf den Tisch gelegt. Dr. Ferdinand dachte beim Händewaschen an die vielen Füße, an denen er in den Jahren Operiert, Fremdkörper und Geschwülste entfernt und abgestorbene Zehen amputiert hatte. Auch gab es Situationen, wo der ganze Fuß oder große Teile von ihm entfernt wurden. Für die Freiheit des Menschen war der tragende Fuß unerlässlich. Er wusste um die Bedeutung des Fußes für die Würde des Menschen. Die Schwester zog ihm den grünen Kittel über. Er trat an den Tisch und dachte an die Würde des Menschen und seinen Drang nach Freiheit, als er sich den Fuß betrachtete, dessen Zehen bereits abgestorben waren, und darauf vertraute, dass die Vorfußamputation ausreicht und die Wunde verheilt. Er schnitt die Haut rings um den Fuß ein und durchtrennte die Streck- und Beugesehnen zu den Zehen. An der Fußsohle ließ er einen Hautlappen überstehen, der groß genug sein musste, als Weichteilmantel den Fußstumpf zu decken. Die MittelFußknochen wurden um über die Hälfte gekürzt und der Vorfuß abgesetzt. Der Hautlappen wurde von der Fußsohle über den Stumpf hochgeklappt und mit der Haut am Fußrücken vernäht. Dr. Ferdinand legte den Verband an und wünschte der alten Frau eine gute Wundheilung, da ihr sonst der Verlust des ganzen Fußes droht. Der ukrainische Narkosearzt sagte "okay!, okay!", als sie hustete, und zog ihr den Tubus aus der Luftröhre. Er fuhr die Patientin mit der Narkoseschwester in den Aufwachraum. Dabei hielt er ihr die Sauerstoffmaske aufs Gesicht und sagte noch etwas in einer Sprache, die keiner verstand.
Dr. Ferdinand wechselte im Umkleideraum die Kleidung, zog das durchschwitzte OP-Hemd vom Körper, warf es mit der grünen Hose in den Wäschesack und rieb sich den Schweiß von der Haut. Nun hörte er aus dem Teeraum ein lebhaftes Gespräch zwischen der kubanischen Kollegin und dem Kollegen, der auf der 'Insel der Jugend' aufwuchs, die Schule besuchte und danach an der Universität in Havanna Medizin studierte. Beide arbeiteten in der Chirurgie. Worüber sie sprachen, ließ sich vom Umkleideraum aus nicht sagen. Beide sprachen spanisch, und das sehr schnell. Dr. Ferdinand verließ das OP-Haus und ging zum 'Outpatient department', um zu sehen, wie voll die Wartebänke vor dem Untersuchungsraum 4 besetzt waren. Von den sechs Bankreihen war die erste Reihe ganz und die zweite Reihe nahezu halb geleert. Der Kollege war bereits nach Hause gegangen, um mit seiner Frau das Essen der philippinischen Küche zu geniessen. Auf dem Wege zum Speiseraum sah Dr. Ferdinand ins Sekretariat, dessen Schreibmaschine ohne ein Blatt zwischen den Rollen verwaist auf dem Tisch stand, weil die Sekretärin im Kasino ihr Essen einnahm. Die vier Stühle im Sekretariat waren leer. Er klopfte an die Tür des Superintendenten. Es gab keine Antwort. So verließ er das Sekretariat, ging an der Asbestwand des Flatgebäudes mit den verschmierten und tuchverhängten Fenstern entlang, bog am Ende des Gebäudes im rechten Winkel nach links und ging auf die offenstehende Tür der Teeküche mit der zersprungenen und eingedrückten Scheibe zu, bog vor der Tür im rechten Winkel nach rechts und betrat durch die dritte zweiflügige Glastür den Speiseraum. Die Essenszeit war praktisch vorüber. Die abgegessenen Teller mit den aufliegenden Bestecken und die gebrauchten Tassen standen auf den runden Tischen, die vom Wärter im weißen Küchendress mit den aufgenähten Flicken über beiden Ellenbogen und dem rechten Knie abgeräumt wurden. Dr. Ferdinand war der letzte und einzige im Raum, so dass sich das Anstellen in die Reihe erübrigte. Der Wärter füllte den Teller mit dem, was noch übrig war. Mit einem großen Löffel schaufelte er den Reis auf den Teller, goss von der scharfen Chilisauce darüber, legte einen kleinen Hühnerschenkel, das letzte Stück Fleisch, und zwei gekochte Pumpkinhälften dazu. Damit ging Dr. Ferdinand an den Tisch und wünschte sich einen guten Appetit. Der Wärter brachte von einem andern Tisch die mit Süßchemie vom Orangengeschmack gefüllte Blechkanne, die nun nur knapp halbvoll war. Die flüssige Süßchemie hatte Raumtemperatur, und Eiswürfel gab es nicht.
Dr. Ferdinand aß den Hühnerschenkel und das Fruchtfleisch aus den Pumpkinhälften. Der Reis war versalzen. Davon nahm er nur einige Gabeln voll. Den größten Teil ließ er auf dem Teller zurück. Die Süßchemie schmeckte zu Süß . Den Orangengeschmack musste man sich dazudenken. Der Speiseraum war nach der Unabgängigkeit frisch gestrichen worden. An den Wänden verliefen Streifen in den SWAPO-Farben blau, grün und rot von unten links nach oben rechts. Für das Essen selbst hatte die Unabhängigkeit keine Verbesserung gebracht. Im Gegenteil: eine Abwechselung in den Speisen gab es nun kaum noch. Da schmeckte das Essen am Sonntag genauso fad und langweilig wie an den Wochentagen. Der Reis wurde auch nach der Unabhängigkeit versalzen, und der Fleischlappen wurde zu einem zähen Leder, das mit dem verfügbaren Messer nicht mehr zu schneiden war. Beim Schneideversuch konnte man sich eher den Zeigefinger brechen als ein Stück Fleisch aus dem Lappen zu schneiden, der, wenn er den Mund erreichte, nach nichts oder nach Schmierseife schmeckte. Was aber noch schwerer für Dr. Ferdinand wog, war die Tatsache, dass das Essen im Speiseraum jeden kommunikativen Reiz verloren hatte. Die lebendigen Gespräche von einst, ob traurig oder heiter, ob mit Dr. Witthuhn, Dr. Nestor, Dr. van der Merwe oder dem jungen Kollegen und Schriftsteller über die verbotene Liebe, sie gab es nach der Unabhängigkeit nicht mehr. Man schwieg, kaute, schaufelte in den Mund und hatte sich nichts zu sagen. Dabei war es bei Gott nicht so, dass die alten Missstände um die Hygiene, die Betten, Schaumgummimatratzen und klemmenden Wasserhähne, um die fehlende Hospitalkleidung, die fehlenden Waschschüsseln und Spucknäpfe für die Tuberkulösen, die Probleme mit den fehlenden Milchrationen und zu kleinen Essensportionen gelöst waren. Im Gegenteil: die alten Problemen waren nach wie vor akut. Dazu kamen nach der Unabhängigkeit die Diebstähle von Bettwäsche, Handtüchern, Tassen und Bestecken, das Heraustragen von Kartons mit Medikamenten und vollen Töpfen mit Fleisch und gekochter Speise. Erst nach der Unabhängigkeit fand Dr. Ferdinand im chirurgisch-orthopädischen Kindersaal eine bereits übergewichtige Hilfsschwester, die in einer Ecke der 'Stationsküche' stand und sich das Essen in den Mund stopfte, was für die Kinder bestimmt war. Diese Hilfsschwester zog es vor, sich mit den Rationen für die Kinder abzufüllen, anstatt, wie es die andern Schwestern taten, die Kinder zu füttern, die aus eigener Kraft nicht essen konnten. Bei den Ärzten war die Unpünktlichkeit und Gleichgültigkeit bei der Arbeit am Patienten zu beklagen. Hier stürzte mit der Unabhängigkeit und neuen Freiheit das Berufsethos in einer beschämenden Weise ab. Das Gespräch, das einst gesucht wurde, um die Ängste und Sorgen um die Menschen in Not auszutauschen, die Anteilnahme und Disziplin im Zuhören und die Sorgfalt im Sprechen, die zusammen eine Kultur der Zusammengehörigkeit und gegenseitigen Hilfe prägten, sie waren gestorben und gehörten der Vergangenheit an. Da wirkten der Geist der Mitmenschlichkeit und der Wille zur gegenseitigen Hilfe, die wie Engel über den Erschütterungen nach jedem Granateneinschlag schwebten. Dieser Geist und dieser Wille waren es, die den erschöpften Menschen die Kraft zur Arbeit und zum Durchhalten gaben. Mit dem Verstummen der Einschläge blieben die seelischen Erschütterungen mit den Ängsten aus, die als Katalysatoren die Kommunikation förderten. Mit dem Verstummen schliefen die Menschen seelisch ein und ließen sich weder wecken noch wachrütteln. Sie verschliefen sich und ließen in der Sorge um sich selbst die Verantwortung für und vor den Menschen fahren, die in Not und Elend waren. Diese "Schläfer" mit den Merkmalen der Heuchelei und Verstellung setzten in kurzer Zeit viel Fett unter der Haut an. Das hatte zur Folge, dass sie schwerfällig und schwergängig (geistig wie körperlich) und schließlich sitzhängig wurden. Sie bekamen kurze, breite Hälse und ein dickes Fell. Körperpartien buchteten unnötig aus und wurden zu hängenden Lasten. Seelisch kam es zur Abflachung und Abstumpfung. Der Abfall im Interesse für die Nöte hungernder Kinder und anderer Menschen in Not war erstaunlich und rapide. Die "Schläfer" konnten hungernde Kinder sehen, ohne sich zu schämen. Ihre Augen blieben beim Anblick dieses Elends trocken. Ihre Gesichter verzogen keine Miene. Ihr Mund sagte dazu nichts. Wenn das so war, dann konnten die Gedanken, die sich hinter ihren Gesichtern versteckten, von der Gleichgültigkeit nicht so weit entfernt sein. Die Wahrheit vom zu vielen Essen stand im Gegensatz zu den lauten Lippenbekenntnissen von der Verantwortung und Hingabe an den Mitmenschen in Not. Diese Bekenntnisse waren substanzlos. Sie waren geheuchelt und kamen aus der Schwäche und Selbstsucht heraus. Die Motive solcher Bekenntnise im Kontrast zu den Taten waren oft nicht frei von Neid oder anderen politisch-Opportunistischen Klimmzügen. Solche Worte von solchen Menschen waren geheuchelt, weil ihre Teller immer voller und ihre Körper immer schwerer wurden. Dann fingen sie an, von den Hormonen zu sprechen, wenn sie bezüglich der Rücken- Hüft- und Knieschmerzen auf ihr Übergewicht hingewiesen und nach den Ess- oder Fressgewohnheiten gefragt wurden. Bei dieser Befragung gaben fast alle an, dass sie eher wenig als zuviel ässen. Und alle, wie sie waren und leutselig blickten oder verschmitzt lächelten, wussten, dass sie die Hormone auch hatten, als sie durch die Jahre der Apartheid schlank und mager waren und sich bei größerer Beweglichkeit viel mehr und stärker für die anderen Menschen einsetzten. Da trugen sie in der Tat noch die Verantwortung für den Menschen und praktizierten ehrlich und schlicht die Menschlichkeit. Da befriedigte sie die Arbeit, und der Frieden im Herzen war ihr Lohn. Es gab da noch Werte, die mit der Unabhängigkeit und neuen Freiheit verlorengingen. Dr. Ferdinand ging zum 'Outpatient department' zurück und begann mit der Sichtung der Patienten, die geduldig auf den Bänken vor dem Untersuchungsraum 4 saßen und warteten. Eine alte Frau wurde an einem Stock von der Tochter hereingeführt und auf den Schemel gesetzt. Der graue Star war ihr auf die Augen geschlagen und hatte sie erblindet. Sie war zwei Tage zuvor gefallen und hatte sich Hautschürfungen im Gesicht zugezogen und das rechte Handgelenk gebrochen. Die Röntgenapparatur war ausgefallen, so dass sich Dr. Ferdinand auf die körperliche Untersuchung beschränken musste. Er hatte keinen Zweifel am Vorliegen des Handgelenkbruches, nahm die alte Frau in den Gipsraum, legte sie auf die Liege, gab ihr die Spritze zur örtlichen Betäubung in den Bruchspalt und richtete den Bruch ein. Die Tochter zog den Daumen der Mutter nach oben, und Dr. Ferdinand legte die Gipsbinden an und stellte das gerichtete Handgelenk im Gipsverband ruhig. Er schrieb die Schmerztabletten in den Gesundheitspass , auf dem der Name völlig abgegriffen war, und gab ihn der Tochter, die die Mutter am Stock aus dem Gipsraum führte. Ein kleiner Junge saß nun auf dem Schemel, und die Mutter hielt sein rechtes Bein hoch, wo ein Fremdkörper im Fuß steckte. Dr. Ferdinand ging zum kleinen OP, wohin ihm die Mutter mit dem kleinen Jungen auf dem Rücken folgte. Die Schwester nahm ihn vom Rücken der Mutter und legte ihn auf den Tisch. Dr Ferdinand setzte die Spritze zur örtlichen Betäubung und entfernte nach einem kleinen Hautschnitt die abgebrochene Dornspitze aus seiner Fußsohle. Er adaptierte die Wundränder mit einer Naht und wickelte den Fußverband an. Die Schwester gab ihm die Tetanusspritze und setzte ihn auf den Rücken der Mutter, die mit ihm den kleinen OP verließ. Ein alter Mann setzte sich auf den Schemel und legte den Stock neben sich auf den Boden. Er zeigte auf sein linkes Knie, das geschwollen war. Dr. Ferdinand punktierte aus dem Knie einen bernsteinfarbenen Erguss, der fast eine Nierenschale füllte. und sagte dem alten Mann, dass er mit diesem Knie, das sich mit den Jahren verschlissen hatte, leben müsse, da Leute wie er, die es sich nicht leisten können, auch für ein künstliches Kniegelenk nicht in Frage kommen. Der Alte sah seinen Nachteil ein, nahm den Stock vom Boden und stand auf. Dr. Ferdinand reichte ihm den Pass, in dem er die entzündungshemmenden Tabletten eingetragen hatte. Der Alte verließ den Untersuchungsraum und trat durch die Tür, ohne seinen Kopf zur Seite zu drehen. Beim Anblick dieses Alten überwog doch die Armut den Stolz, den zu halten ihm nicht leicht zu fallen schien. Die menschliche Würde war spröde und verwundbar geworden.Es war ein besonderer Augenblick, als ein hochgewachsener hagerer Mann mit Gehstützen auf einem Bein vor ihm stand. Dr. Ferdinand schaute sitzend an ihm hoch und wieder runter, sah auf den sauber geputzten Schuh und das sauber hochgefaltete Hosenbein über dem Stumpf, das mit zwei Sicherheitsnadeln auf halbe Länge gehalten wurde. Er konnte aus dem Gesicht, in dem einige Narben waren, nicht erkennen, um welchen Patienten es ging. Es gab Hunderte von Patienten, denen er den Oberschenkel nach einer Explosionsverletzung abgesetzt hatte. Der hochgewachsene hagere Mann lächelte und frischte das Gedächtnis von Dr. Ferdinand mit den Worten auf, ob er sich nicht an ihn erinnern könne, den er Operiert hatte, nachdem ihm in einem Haus hinter dem Hospital eine Granate das Bein abgerissen hatte. Nun erinnerte sich Dr. Ferdinand. Es war in einer der letzten Wochen, das weiße Kommando war bereits im Versinken begriffen, als er an einem Mittag zu dem Notfall gerufen wurde. Im kleinen OP des 'Outpatient department', der in einer Bullenhitze mit Menschen gefüllt war, stand auch Dr. Nestor, der blutverschmiert Kompressen auf den blutenden Beinstumpf drückte, um die Blutung zu stOPpen und den Blutverlust zu mindern. Dr. Ferdinand erinnerte sich nun gut, wie er in der Hitze in dem engen und überfüllten Raum die großen Gefäße abklemmte und unterband, die Weichteilfetzen begradigte, den herausstehenden Knochen kürzte und die Schichten des Weichteilmantels über dem Knochenstumpf vernähte. Die Situation war völlig verrückt: Es giess, dass sich Swapo-Kämpfer in dem Haus an der Straße hinter dem Hospital versteckten. Die Straße führte nach 'Klein-Angola', wo die Schwarzen und Mischfarbigen in ärmlichen Hütten wohnten. Eine Einheit der Koevoet (was Brecheisen bedeutet) kam mit zwei 'Casspirs' vorgefahren und umstellte das Haus. Der Führer dieser Einheit forderte die Hausbesetzer auf, mit erhobenen Händen herauszukommen. Tür und Fenster waren geschlossen. So warf einer der Koevoet einen großen Stein gegen ein Fenster und zertrümmerte die Scheibe. Die Hausbesetzer kamen nicht mit erhobenen Armen heraus, sondern schossen aus dem Haus mit einer AK 47 auf die Koevoet, wobei einer schwer verletzt wurde. Ein anderer der Koevoet, der sich unter dem Fenster versteckt hielt, warf nun eine Handgranate in den Raum. Es kam zu einer gewaltigen Explosion, die das Dach des Hauses abhob und etwa fünfzig Meter weit schleuderte und zwei Mauerwände wegriss. Von den drei Hausbesetzern waren zwei auf der Stelle tot. Der dritte überlebte. Ihm riss die Explosion jedoch das rechte Bein ab. "Es ist ein Wunder, dass ich die Explosion überlebte", sagte der hochgewachsene, hagere Mann mit den Gehstützen in den Händen, und Dr. Ferdinand konnte ihm nicht widersprechen. Er sah sich den Stumpf an, der spitzkonisch zulief, und riet ihm, sich um eine Prothese zu bemühen und die nächste Session der orthOPädisch-orthotischen Klinik aufzusuchen, die vierteljährlich am Hospital abgehalten wurde und aufgrund der großen Zahl angeborener Missbildungen und erworbener Haltungsschäden und Verstümmelungen einen großen Zulauf hatte. Er trug seine Notizen im Gesundheitspass ein und gab ihn dem Patienten, der sich nochmals für seinen Einsatz bedankte, der, wie der hagere Mann im Einbeinstand sagte, ihm das Leben gerettet habe. Dr. Ferdinand war von der Herzlichkeit gerührt. Er schaute dem Mann ins Gesicht und ließ sich in der Erinnerung von den Narben zurück ans Geschehen mit den blutenden Wunden führen, das so kurz vor Toresschluss passierte und so sinnlos war wie alles, wenn es die Worte nicht mehr tun und der Hass die Sprache lähmt.
Eine Schwester vom orthopädischen Männersaal kam mit Krankenblättern zum Eintragen von Medikamenten, die weiter zu geben waren, da ohne Neueintrag die Pharmazie die Ausgabe der Medikamente verweigerte. Diesbezüglich entsprach die neue Zeit der alten, obwohl der allgemeine Vorrat an Medikamenten nach der Unabhängigkeit aufgestockt wurde. Dr. Ferdinand machte die erforderlichen Eintragungen. Der philippinische Kollege gegenüber schaute zu Boden, als eine junge Frau vom Stuhl herabglitt und von einem epileptischen Anfall geschüttelt wurde. Ihre Arme krümmten sich und schlugen dann wild auseinander. Sie bekam Schaum vor den Mund und eine schwere Atmung. Heftige Krämpfe verzerrten ihr Gesicht zu gruselhaften Grimassen und schaurigen Fratzen. Ihr Rumpf krümmte sich nach hinten. Arme und Beine versteiften in abartiger Position. Die Stationsschwester eilte mit den Krankenblättern aus dem Untersuchungsraum, aus dem die Patienten nach draußen gebeten wurden. Die beiden Ärzte knieten um die sich Krümmende, wischten ihr den Schaum vom Munde und drehten ihren Kopf zur Seite. Es dauerte einige Minuten, bis die Frau ihr Bewusstsein wiedererlangte. Sie machte große Augen über das, was abgelaufen war. Nur an den Anfang konnte sie sich erinnern, dann verlor sie die Kontrolle. Bei Durchsicht des Gesundheitspass es fand Dr. Ferdinand den ersten Vermerk eines epileptischen Anfalls zur Zeit des Machtwechsels von weiß nach schwarz. Über die Ursache der Epilepsie fand sich dagegen nichts. Bei den meisten Erwachsenen war die Epilepsie Folge von schweren Schädeltraumen, die oft durch Knüppelschläge oder Schläge mit Eisenstangen hervorgerufen wurden. Der philippinische Kollege notierte den neuerlichen Krampfanfall im Pass und vermerkte die Dauer des Anfalls mit fünf Minuten. Die junge Frau gewann ihr Bewusstsein zurück und wurde auf die Trage gehoben, wo ihr die Schwester mit einem feuchten Tuch den Speichel vom Gesicht wischte. Der verletzte Finger, weswegen sie gekommen war, wurde mit zwei Nähten versorgt und verbunden. Dann wurde die Frau zur weiteren Beobachtung in den orthopädischen Frauensaal gefahren. Die posttraumatische Epilepsie war eine relativ häufige Erscheinung unter diesen Menschen. Da wurde auf eine Besserung im sozialen Gefüge und Verhalten vor allem vonseiten der Männer mit der neuen Freiheit gehofft. Die Männer hatten Grund dazu, ihre Rolle in der Familie und Gesellschaft zu überdenken und von der groben Gewalt gegenüber wehrlosen Frauen und Kindern endgültig abzusehen. Sie mussten den Respekt vor dem körperlich Schwächeren, der ihnen intellektuell oft überlegen war, noch lernen.
Nach dieser Unterbrechung wurde die Sichtung der Patienten fortgesetzt. Ein junger Mann setzte sich auf den Schemel, dessen linke Hand den rechten Unterarm hielt. Er klagte über Schmerzen in der rechten Schulter. Nach einer Auseinandersetzung, die schließlich mit den Händen anstatt mit Worten ausgetragen wurde, verdrehte einer seinen Arm so stark, dass er ihn nicht mehr bewegen konnte. Dr. Ferdinand sah auf die rechte Schulter und fühlte die Delle der leeren Pfanne und den dahinterliegenden, ausgekugelten OberarmKopf. Er nahm den jungen Mann mit in den Gipsraum, legte ihn auf die Liege, gab ihm die Spritze zur Kurznarkose und renkte den Arm in das Schultergelenk ein. Mit einem Schulter-Armverband nach dem Pariser Chirurgen Desault stellte er das Schultergelenk ruhig. Nachdem der Patient aus der Narkose erwacht und voll ansprechbar war, erklärte ihm Dr. Ferdinand, dass er den Verband für eine Woche zu belassen hatte. Der Patient versprach, der Anordnung zu folgen, und verließ mit dem Gesundheitspass den Gipsraum, um sich am Tresen die im Pass eingetragenen Schmerztabletten von der Schwester geben zu lassen. Dr. Ferdinand entfernte im kleinen OP einen Holzsplitter aus dem Fuß eines Mädchen. Er setzte die örtliche Betäubung mit einer Spritze, schnitt die Haut ein, fasste den Splitter mit einer Klemme, zog ihn aus dem Fuß und vernähte die Wunde. Das Mädchen gab keinen Klagelaut von sich, auch dann nicht, als ihr die Schwester die Spritze gegen den Wundstarrkrampf ins Gesäß gab. Die Mutter wartete vor dem OP und nahm das Töchterchen, das einen Fußverband hatte, auf den Rücken. So ging sie zum Tresen der Medikamentenausgabe, um die Antibiotika und Schmerztabletten in Empfang zu nehmen. Der folgende Patient war ein Albino um die dreißig, dem die ultravioletten Strahlen zahlreiche Hautschäden im Gesicht und an den Armen gesetzt hatten, die nicht abheilten und über die Jahre den Boden für die Entstehung multifokaler Hautkarzinome gaben. Der Mann war wegen einer schmerzhaften Schwellung des rechten Kniegelenks gekommen. Zur Vorgeschichte gab er an, dass er etwa eine Woche zuvor gefallen sei. Die Röntgenaufnahme brachte keinen Hinweis auf eine knöcherne Verletzung. Die weitere Untersuchung ergab eine schmerzhafte Bewegungseinschränkung im Kniegelenk mit instabilem Außenband. Dr. Ferdinand punktierte einen blutigen Erguss aus dem Gelenk ab und nahm den Patienten zur operativen Außenband-Wiederherstellung auf. Er trug den Namen des Patienten mit der Diagnose in seiner vorläufigen OP-Liste ein.
Alle Patienten waren noch während der regulären Arbeitszeit gesehen und behandelt worden. Die Schwester der Spätschicht räumte die Sachen zusammen. Dr. Ferdinand und der Kollege wuschen sich die Hände und schlugen sie zum Trocknen durch die Luft. Sie verabschiedeten sich. Dr. Ferdinand wünschte dem Kollegen für den nächsten Tag eine gute Fahrt, um seine Töchter für die Schulferien in der Konventschule in Windhoek abzuholen und in den hohen Norden zu bringen. Sie standen noch vor dem 'Outpatient department' und besprachen einige Dinge bezüglich der Patienten, als der Superintendent vom 'theatre' kam und im Vorübergehen Dr. Ferdinand bat, in sein Büro zu kommen. Bei der Besprechung ging es um das Seminar, das bevorstand. Es wurden die Vortragenden und ihre Themen noch einmal durchgesprochen, wie sie auf dem Programm standen. Da hatte auch der Superintendent noch an seinem Referat zu arbeiten. Wie bei allen vorangegangenen, halbjährlich durchgeführten Seminaren lagen die technischen Vorbereitungen ganz in den Händen von Dr. Ferdinand. Es war ein erstaunliches Phänomen, dass sich von den schwarzen Kollegen keiner anbot, bei den umfangreichen Vorbereitungen mitzuhelfen. Sie hielten ihren täglichen Routinetrott ein und machten keinen Schritt schneller oder mehr. Sie taten es ohne jegliche Bedenken und Rücksicht, dass diese Arbeit für einen eigentlich zu viel war, ihn überforderte. Auf der anderen Seite waren diese Kollegen, wenn auch recht unterschiedlich, an einer Fortbildung interessiert. Einige von ihnen waren bereit, einen Beitrag in Form eines Referats zu leisten. Die Hauptredner kamen aus Südafrika von den Universitäten in Bloemfontein, Durban, Cape Town, Johannesburg, Potchefstroom und Pretoria. Die Reise-, Verpflegungs- und Unterbringungskosten für diese Referenten hatte jedesmal Herr Francois vom Orthopaedic Centre in Windhoek übernommen. Das Hospital hatte lediglich den Saal mit Bildprojektor und Leinwand zu stellen, für Tee und Kaffee mit belegten Brötchen und Broten am Morgen und in der Vor- und Nachmittagspause zu sorgen und zur Freude aller Teilnehmer ein Barbecue (Braai) am Abend des ersten Tages zu veranstalten. Da zeigte sich die Beliebtheit dieser abendlichen Einrichtung, die doch größer war als der Wunsch zu lernen und sich fortzubilden, weil da viel mehr, oft doppelt so viele Menschen erschienen als an den Arbeitssitzungen, um gratis zu essen und gratis zu trinken. Es war ein Phänomen, das ganz eng mit der neuen Freiheit einherging. Da spielte es keine Rolle, ob man an der Arbeit des Seminars teilnahm oder nicht. Den 'Braai' mit dem frisch gegrillten Fleisch und den Salaten, mit dem Bier und den andern 'cool drinks' wollte man sich nicht entgehen lassen. Es passte zur Formel: Annehmlichkeit: Ja; Arbeit: Nein. Es war ein Phänomen, dass es wahrscheinlich schon vor der Unabhängigkeit gab, da aber nicht aufgefallen war, da damals alle begriffen hatten, dass hart gearbeitet werden musste, um das Hospital zu erhalten und den Menschen in der großen Not zu helfen. Es mochte die ständige Angst ums Überleben gewesen sein, als die Granaten immer näher und lauter einschlugen, dass da keiner so sehr ans gratis Fleischessen und gratis Biertrinken dachte, weil es mit dem Mahangupapp und dem sauberen Wasser genug war, wenn es das gab. Damals stand noch die Idee der Freiheit ganz oben. Man war bereit, dafür zu hungern und zu dursten und anderswie zu opfern. Das hatte aufgehört, als diese Idee mit dem Eintritt der Unabhängigkeit sich zu verwirklichen schien. Da wollte man dann doch keine Opfermehr bringen, sondern sich das zugute führen, was man glaubte für die Freiheit geopfert zu haben. Da trat das zweite Phänomen ans Tageslicht: Lautstarke Menschen rückten sich in den Vordergrund und drückten die andern, die aufgrund der besseren Erziehung und des stärkeren Glaubens in die göttliche Geduld und Gnade nicht so laut herumschrien, in den Hintergrund. Dabei zeigte sich, dass die in den Hintergrund gedrückten Menschen meist die viel größeren Opferfür die Freiheit gebracht haben als die plärrenden Marktschreier und politischen Schreihälse auf den Märkten der Verdrehung und Wichtignehmerei. Die Lautschwachen waren oft die, die sich mit ganzer Kraft für die Unabhängigkeit und Freiheit eingesetzt, dafür gehundert und gedurstet hatten, die für die Idee der Freiheit geschlagen und gefoltert, in Erdlöcher gesteckt und ins Gesicht getreten wurden. Diese Menschen hatten sich verausgabt und oft alles für die Freiheit weggegeben und weggeopfert. Es waren ihre Männer und Söhne, die im Kampf für die Freiheit ihr Leben gaben oder als wehrlose Krüppel überlebten. Es waren ihre Mütter und Töchter, die in ihrem Einsatz geschändet, misshandelt und erschlagen wurden. Bei dieser Kategorie von Menschen gab es kein lautes Sprechen mehr. Die Schreihälse, die sich nach der Unabhängigkeit in den Vordergrund schrien, waren meist jene, die sich beim Opfern eher zurückgehalten hatten, die da berechnend waren und die Chancenwahrscheinlichkeit im Auge hatten. Sie ließen die andern opfern, damit sie noch genug Kraft zum Schreien und Klettern auf den Leitersprossen zur Macht hatten, wenn es mit der Freiheit soweit war. Da waren die Herzen andere Wege gegangen als der kalkulierende Intellekt. Die Wahrheit mit den Opfern war bei den Herzen, und die Lüge war bei den Schreihälsen. So kamen mit der neuen Freiheit auch ungleiche Dinge an den Tag, die mit den ungleichen Charakteren zu tun hatten, die ihre ungleichen Wege und Fußstapfen weit zurückverfolgen ließen, als es von der neuen Freiheit noch nichts gab. Doch, wer einmal laut gewesen war und das Gefühl des Getragenwerdens bei vollem Magens bekam, der wollte nicht mehr leise reden.
Dr. Ferdinand schaute nach den Patienten auf der 'Intensiv'-Station, trug die klinischen Daten in die Krankenblätter ein, wünschte den Schwestern, die gerade die Verantwortung für die Patienten der Nachtschicht übergaben, eine ruhige Nacht und machte sich auf den Weg zur Wohnstelle. Der Himmel hatte sich blutrot verfärbt, und der glühende Sonnenball senkte sich dem Horizont entgegen. Es war eine Art Nostalgie, dass er sich beim auf dem Vorplatz, dem der Uringeruch nicht wegzunehmen war, noch einmal zur Rezeption umdrehte. Doch mit der Unabhängigkeit war auch die nächtliche Sperrstunde verschwunden. Nun richteten sich hier die Menschen nicht mehr mit Decken, Pappen und Zeitungspapier ihr Lager für die Nacht ein, saßen nicht mehr nebeneinander, klapperten und löffelten nicht mehr in Blechdosen herum, pafften nicht mehr in den Pfeifenstummeln ihr scharfes Kraut. Die Zeit der nächtlichen Koevoetkontrollen mit den Verhören, Schlägen und Deportationen gehörte der Vergangenheit an wie die Ängste, von Granaten getroffen zu werden. Da war das Leben zu einer Norm der Ruhe und Sicherheit zurückgekehrt. Dennoch gab es kaum strahlende Gesichter. Die Armut drückte auf die Familien. Viele lebten in tiefer Not. Hinzu kam das Wegsterben der jungen Menschen durch AIDS. Da waren es mehr die Frauen als die Männer, und sie ließen ihre Kinder als Waisen zurück. So kamen auf die Alten mit der kleinen Rente die Waisenkinder noch dazu, die von ihnen verpflegt und aufgezogen wurden, wenn es die Tante nicht gab, die sich um die Verwaisten kümmerte, weil auch sie von diesem Virus getroffen war und entkräftet in den letzten Zügen lag. Dr. Ferdinand nahm den Weg an den fünf Caravan-Häusern vorbei, die nun von einheimischen Menschen bewohnt waren. Der Zustand der Häuser war heruntergekommen. Sie sahen schmuddelig und ungepflegt aus. Nur am ersten Blockhaus, in dem Sarah mit der Beinprothese und ihrem Kind wohnte, waren die Fenster geputzt und die Treppenstiegen sauber. An den andern Häusern waren die Fensterscheiben verschmiert und einige zerbrochen. Es gab Stiegen, die mit Eimern, Töpfen und anderem Zeug vollgestellt waren. Andere hatten angebrochene und eingeknickte Stufen. Er ging am zerfledderten Lattenzaun entlang, der auf der anderen Seite des Weges war, über den Platz vor der Stadtverwaltung mit den noch verbliebenen alten Bäumen, am botanischen Kasten mit den beschrifteten Blättern vorbei, betrat die Teerstraße und bog die zweite, die Sandstraße vor dem Funkgebäude rechts ab. Die Sonne hatte sich zu einem glutroten Ball verdichtet, der sich dem Horizont entgegenneigte. Dr. Ferdinand trat durch die Einfahrt, schloss das Tor hinter sich, überquerte den kleinen Vorplatz, öffnete die Eingangstür und eilte zum Telefon, das zu klingeln aufhörte, als er nach dem Hörer griff. Er streifte die Sandalen mit den schwitznassen Korksohlen von den Füßen und das durchschwitzte Hemd vom Körper, das er über die Rückenlehne eines Stuhles warf. Er zündete sich eine Zigarette an, setzte sich auf den Terrassenabsatz und sah dem untergehenden Feuerball nach, der mit dem Versinken am Horizont die Glutbänder vom Abendhimmel nachzog, dass mit der ersten Dämmerung der Abendstern dicht über der auffahrenden Mondsichel stand, als stünde der Steuermann schon in der Gondel. Bei der Abendbetrachtung fuhren ihm die Zeilen durch den Sinn:
An mir hängend mit dem Geist, o Prthã-Sohn,
Meditation übend, auf mich gestützt
wie du mich zweifelsfrei
vollständig erkennen wirst, das höre!
Dieses Wissen mitsamt dem Erkennen
werde ich dir verkünden ohne Rest.
Wenn du das erkannt hast, bleibt dir hier
nichts anderes mehr zu erkennen übrig.
Unter Tausenden von Menschen strebt
kaum einer nach Vollendung.
Von den erfolgreich Strebenden
kennt kaum einer mich in Wahrheit.
Erde, Wasser, Feuer, Wind
Luftraum, Geist wie auch Verstand
und Ichbewusstsein:
dies ist meine achtfach aufgeteilte Natur.
(Bhagavadgïtã, 7. Gesang)
Das waren Worte des Erhabenen (bhagavat) in seinem Gesang (gïtã) an den Helden Arjuna, dem Protagonisten der Pãndavas, der Verwandten, Freunde und Lehrer, die ihm im Kreig gegenüberverstanden. Arjuna fand es selbst für den Fall eines Sieges widersinnig, gegen seine Verwandten Krieg zu führen. Er fühlte sich unfähig und nicht gewillt, seine Verwandten zu töten. So entspann sich ein Gespräch mit dem Wagenlenker, der kein anderer war als Krsna, die Inkarnation des Gottes Visnu. Bhagavat vermittelt in der Gïtã dem Helden Arjuna (einer der fünf Söhne des Pãndu) die Grundsätze des pflichtgemässen Handelns. Das Kernstück seiner Belehrung ist die Ethik, in der drei Forderungen des Visnu-Krsna zu erfüllen sind:
1. Karman, die Tat, wobei die Tat selbstlos sein soll.
2. Streben nach Wissen und Erkenntnis (Jnãna). Wissen ist das beste Mittel der Läuterung. Wissen ist die Voraussetzung zur Meditation und Vereinigung mit der Gottheit.
3.Meditation und Abkehr von weltlichem Verlangen; die Hingabe zu Gott (Bhakti), die Verkündung der Gottesliebe. Wer Krsna ehrt und liebt, findet den Frieden im Herzen und gelangt einst zu ihm.
Ferdinand sprach die Zeilen langsam und lispelnd vor sich hin und hörte den Worten nach, wie sie in die Dämmerung hinaus flogen, die irdische Schwere abstreiften und sich weit weg in Silben und schließlich in Buchstaben auflösten. Sie formten Wolken, aus denen der große Regen kam, der die Menschen vor der Trockenheit und dem Hungertod bewahrte. Die gelispelten Metamorphosen liefen in der Stille ab. Der ersehnte Frieden war weit. Er war für die Worte nicht, vielleicht für einige Silben und ihre Bruchstücke noch unerreichbar. Doch die Laute, die da mehr gedacht als gesprochen wurden, waren voll im Klang mit nur kleinen Dissonanzen. Dr. Ferdinand ordnete den schwingenden Worten mit den ausschwingenden Silben und den weiterschwingenden Gedanken die Klänge Beethovens aus dem Andante der Mondscheinsonate zu und summte die Zeilen mit dem wörtlich Gedachten gebetsmühlenhaft bis ans Ende der Musik. Er betrachtete den Abendhimmel mit den aufkommenden Sternen und versuchte, die Tagesschwere abzustreifen und sich im Kosmos ganz zu integrieren. Es war sein Wunsch, in die Nacht fortgetragen zu werden, um den Frieden zu finden, den er zum Leben. Denn das Leben war gefährdet durch die Probleme, die sich im Alltag stauten und türmten, weil sie unlösbar waren aufgrund menschlicher Versagen mit den ständigen Versprechungen, die nie eingehalten wurden. Beim Wunsch des Fortgetragenwerdens erinnerte sich Dr. Ferdinand an Gandhi's Worte, die er irgendwo gelesen hatte, als der große, weise Mann die Bhagavadgïtã "the universal mother" nannte, "whose door is wide OPen to anyone who knocks". Er zündete sich eine Zigarette an und sah nach oben in die auffahrende Mondsichel, die nun leer und führerlos, ferngesteuert durchs Sternenmeer gondelte und bereit war, neue Passagiere aufzunehmen.
Ferdinand verlor sich in den Weiten. Ihm ging das Höhlengleichnis durch den Kopf, dessen Ausmaße kosmische Dimensionen bekamen. Plato hat das Gleichnis (Staat, 7. Buch) so geschildert:
1. Menschen leben in einer Höhle unter der Erde. Sie sind an Hälsen und Beinen gefesselt und sitzen an immer derselben Stelle. Sie blicken vor sich hin, da sie die Köpfe nicht zurückwenden können. Hinter ihnen führt ein langer Gang nach oben. Von dort dringt das Licht eines Feuers in die Höhle. Zwischen dem Feuer und den Gefesselten verläuft oben ein Weg entlang einer niedrigen Mauer, wo freie Menschen Gerätschaften und Bildsäulen vorbeitragen, die über die Mauer hinausragen. Die Gefesselten in der Höhle sehen von den vorbeigetragenen Gegenstände nur die sich bewegenden Schatten, die durch das Licht des Feuers an die ihnen gegenüberliegende Wand geworfen werden. Für die Gefesselten sind die Schatten die sichtbare Wahrheit, und sie ordnen die gehörten Worte den vorübergehenden Schatten zu. Für die in der Höhle sind die sich bewegenden Schatten an der Wand, die miteinander reden, die volle Wahrheit.
2. Ein Gefangener wird von den Fesseln gelöst. Diese Lösung kommt ganz unvorbereitet. Der Befreite wird nun von den andern in der Höhle aufgefordert, aufzustehen, den Kopf zu drehen und ins Licht zu sehen. Da werden seine Augen vom grellen Licht des Feuers geblendet. Die Augen schmerzen, aber erkennen die Dinge (im Licht) nicht, deren Schatten er vorher erkannt hatte. Es ist die Blendung mit dem Unvermögen, im (gleißenden) Licht die Dinge zu erkennen, weshalb er denkt, dass die vorher geschauten Schattenbilder wirklicher und wahrer sind, als was man ihm beim Blick ins Licht zeigen will. Der Befreite erlebt es, dass der Blick ins Feuer so schmerzhaft ist, dass ihm die Augen geblendet werden und er außer dem Feuer nichts anderes sieht. Die Erfahrung des Geblendetseins lehrt ihn, dass er sich vom hellen Licht abwendet, ja sich vor dem Licht fürchtet, um die Dinge wieder so zu sehen, wie er gewohnt war, sie zu sehen. Denn die vorübergehenden und miteinander sprechenden Schatten an der Wand waren für ihn gut sichtbar und gut hörbar. Die Schattenbilder entsprachen einer Tatsache, die für ihn wirklicher waren.
3.Es kommt zur Gewaltanwendung. Der Entfesselte wird durch den steilen Ausgang aus der Höhle geschleppt. Er wird gegen seinen Willen und seinen Widerstand in das Licht der Sonne gezerrt. Dort oben schreit er vor Schmerzen auf und ist völlig geblendet. Nach langsamer Gewöhnung an das Sonnenlicht beginnt er die Dinge oben zu sehen: zuerst die Schatten, dann die Spiegelbilder im Wasser, dann die wirklichen Gegenstände, dann den Sternenhimmel und den Mond bei Nacht, dann am Tage das Sonnenlicht und die Sonne selbst. So beginnt er die volle Wirklichkeit zu sehen und sie von den Schatten und Spiegelungen zu unterscheiden. Aus dem Sehen dieser Wirklichkeit folgert er: dass wir der Sonne die Jahreszeiten verdanken, dass die Sonne über allem waltet, dass sie die Ursache der Erscheinungen ist, die er vorher als Schatten in der Höhle sah. Der Befreite kommt zu neuen Erkenntnissen und ist glücklich, wenn er zurück an das Höhlenleben denkt, wo es Ehren und Auszeichnungen für den gab, der die Schatten der vorübergetragenen Gegenstände am schärfsten wahrnahm, am besten erinnerte und eintretende Dinge im voraus am genauesten erriet. Jetzt aber, nach Erkennen der wirklichen Dinge im Lichte des Tages, will der Sehende alles ertragen, als in den Bann der Trugmeinungen mit den Schatten zurückzukehren und ein Leben mit den Trugmeinungen und Schatten, wie es in der Höhle der Fall war, noch einmal zu führen.
4. Der Entfesselte und nach oben Verschleppte hat die Wirklichkeit der Dinge gesehen. Dieses neue Sehen und Erkennen will er seinen Kameraden vermitteln, die noch gefesselt da unten sitzen. Er kehrt deshalb in die Höhle zurück, um seine Kameraden loszubinden und zu befreien. Beim Gang in die Höhle wird es stockfinster, dass er nichts sieht. Er kann die Schattenbilder nicht deuten, weil er sie nicht sieht, und macht sich daher im Wettstreit der Deutung der Schattenbilder mit den Gefesselten lächerlich. Sie nennen ihn einen Tor, weil es falsch gewesen war aufzusteigen, und der Aufstieg schuld sei, dass seine Augen nun <erblindet> waren. Sie verdammten einen solchen Aufstieg und nannten ihn verwerflich. Sie drohten jeden umzubringen, der versuchen sollte, sie zu entfesseln und den Gang hinaufzuführen.
Das Gleichnis berichtet von den beiden Welten und Erkenntniswegen, vom Aufstieg und Abstieg und ihren Risiken, von der doppelten Blindheit aus gegensätzlicher Ursache, von der Weisheit der Wahrheit und vom Übersteigen der menschlichen Erkenntnis und des menschlichen Seins. Ferdinand schaute in den Sternenhimmel. Er fühlte sich als ein Höhlenmensch, dem die Fesseln gelöst wurden, um der Welt mit den ewigen Schatten zu entfliehen und die Wirklichkeit des Universums mit den eigenen Augen zu sehen, das von millionen Sternen erleuchtet war. Es war ein feierlicher Anblick, dessen Weite und Tiefe ihn erschütterte. Er war dankbar, dass ihm beim Anblick dieser Größe die Augen nicht geblendet wurden, denn er wusste von den Gefahren, wenn das Auge sich von den Schattenbildern auf die wirklichen Gegenstände umzustellen hatte. Da kam ihm der erleuchtete Nachthimmel bezüglich des begrenzten Lichtaufnahmevermögens der menschlichen Netzhaut wunderbar entgegen. Seine Augen schmerzten ihn beim Anblick der universalen Größe nicht. Dennoch saß er sprachlos auf dem Terrassenabsatz, weil ihn die aufkommenden Gedanken wie ein Strom mitriss. Er war zutiefst ergriffen und hörte, wie sein Herz beklommen schlug. Er konnte die Wirklichkeit, die er da erlebte, in Worten nicht wiedergeben, spürte beim tiefen Durchatmen, dass ihm die fesselnde Last mit dem Engegefühl im Hals und Brustkorb genommen waren. Die Ketten waren von Hand- und Fußgelenken gefallen. Sie schwollen ab und ließen sich frei bewegen. Es war die Freiheit, die mit dem Sauerstoff geatmet wurde. Dr. Ferdinand fühlte sich wohler, je länger er unter dem Sternenhimmel saß, der Fahrt der Mondsichel folgte und sich ganz in der Tiefe zwischen kleinen Sternen verlor, deren Lichtfunkeln er bei längerer Betrachtung zu erkennen glaubte. Wie der befreite und dann nach oben geschleppte Höhlenmensch aus dem Gleichnis, dem schließlich das Glücksgefühl überkam, als er nach dem anfänglichen Geblendetsein die Gegenstände in ihrer Wirklichkeit sah, überfiel auch ihn die unbeschreibliche Freude, aus der Enge mit all ihren Fesseln befreit zu sein. In der frühen Einbildung, ein Vertrauter des nächtlichen Universums zu sein, stellte sich Dr. Ferdinand die zwei Fragen: 1. Wie kann es der Mensch in der Höhle so lange aushalten? 2. Warum bleibt der Mensch in der Höhle, wenn er die Gelegenheit hat, die Wirklichkeit über der Höhle mit eigenen Augen zu sehen?
Ferdinand kam zu dem vorläufigen Ergebnis, dass es dem Menschen an Mut fehlt, sich sein eigenes Bild von den Dingen der Welt zu machen. Die Erkenntnis fällt keinem in den Schoss. Der Mensch muss lernen und nach Wissen streben, wenn er von der Wahrheit der Dinge etwas erfahren will. Da sagte er sich die Zeilen aus dem 7. Gesang der Bhagavadgïtã auf: "Unter Tausenden von Menschen strebt kaum einer nach Vollendung, von den erfolgreich Strebenden kennt kaum einer mich in Wahrheit." Es war ihm klar, dass es ohne Wissen und Streben nach mehr Erkenntnis eine Freiheit nicht geben kann. Denn es ist das menschliche Denken, das aus der Erscheinungswelt hinaus in die ewige Welt geht und von dort mit neuen Erkenntnissen in die Erscheinungswelt zurückkommt. Das konnte er bei der Betrachtung des Universums erfahren, als würde er diese Erkenntnis von den Sternen abgelesen haben. Zum Mut nach Wissen bedarf es des Willens zum Lernen. Wie sagt es Plato? Der Mensch ist hier in der Welt; er muss über die Welt hinaus dorthin blicken, wo das Wesentliche ist, um selbst wesentlich zu werden, indem er das Wesentliche berührt. Dann erst folgt dem Aufschwung des Gedankens der Wiedereintritt in diese Welt: der Abkehr von der Welt entspringt die Wendung an das mathematische und mythische Begreifen des Alls. Der Aufschwung führt daher nicht zum Verlassen der Welt und nicht zur kommunikationslosen Ekstase; er führt zur Lösung aus der "Weltbefangenheit".
Ferdinand berührte bei seiner ‘Fahrt’ durch den Sternenhimmel, wenn auch nur sehr lose, die Arbeit am Hospital. Die Probleme mit der Faulheit und der Angst, Verantwortung bei der Arbeit zu tragen, hingen seiner Meinung nach mit der Höhlenmentalität zusammen. Es bestand ein Defizit an Wissen, das erschreckend war. Doch noch erschreckender war die Bequemlichkeit, die von der Faulheit nicht zu trennen war, sich auf den Hosenboden oder einen anderen Boden zu setzen, hart zu sitzen und hart zu lernen, um die Wissenslücken in kürzester Zeit zu schließen. Denn das war jeder Arzt dem Patienten schuldig, gut vorbereitet und verantwortungsvoll die tägliche Arbeit zu verrichten. Jede Nachlässigkeit war für den Patienten schädlich und konnte für ihn fatale Folgen haben. Die fehlmotivierte Laissez faire-Einstellung war aus ethisch-moralischen Gründen zu verwerfen. Um das zu begreifen, brauchte es das Wissen von den Dingen der Wirklichkeit. Es war notwendig, sich ein eigenes und gründliches Urteil über die wesentlichen Aspekte der Arbeit am Menschen zu bilden. Das war möglich, wenn sich der Arzt von den Klischees, die den Schattenbildern an der Höhlenwand entsprachen, und von den Fesseln des Halbdenkens befreite. Die Denkfaulheit war das erste Übel und die Meinungslosigkeit und Feigheit, sich eine überlegte Meinung zu bilden, das zweite Übel. Das dritte Übel war dann die Großmäuligkeit gegen besseres Wissen, das vierte und fünfte Übel waren die Arroganz der Dummheit und die schnöde Rücksichtlosigkeit gegenüber dem Leben. Sicher war nicht jeder zum Arztsein geboren. Aber jeder war als Mensch geboren, sich zur rechten Zeit Gedanken über den Beruf zu machen, so auch über den Beruf eines Arztes. Das galt besonders denen, die ein Arzt oder eine Ärztin sein wollten und sich bereits als Ärzte ausgaben. Die Arzteinbildung musste durch die Arztbildung ersetzt werden. Die fehlte eben bei vielen, so dass die Einbildung wie Unkraut wucherte. Das Wissen, das für diese Bildung fehlte, musste erst noch gebracht werden. Doch der Lernmangel war da und der fehlende Wille katastrophal, um das Wissen nachzuholen. Für die Bildung musste man sich aus den Fesseln der Klischees und Schattenbilder losReißen und sich offen den ethischen Anforderungen des Arztberufes stellen. Man hatte sich zu öffnen und von Menschen mit Erfahrung belehren und aufschließen zu lassen. Die Motive, ein Arzt zu sein, mussten stimmen, wo der kranke Mensch im Mittelpunkt des Denkens und Handelns steht. Da passte es nicht, bei der Ausübung dieses Berufes noch nach politischen oder anderen Dingen und Seitenwegen zu schielen, die der persönlichen Eitelkeit mit der widerwärtigen Wichtignehmerei und den finanziellen Zulagen dienen. Diese Dienereien trüben oder nehmen ganz den Blick für den Menschen, wenn er krank ist und die ärztliche Hilfe braucht. Sie führen in die Unfreiheit zurück und ketten den Menschen aufgrund des fehlenden Wissens und der mangelnden Bildung dort fest, wo es finster und ungeheuerlich ist. Schatten ziehen wieder an der Wand vorüber, weil es eine Höhle ist, in der man (aufs neue) gefesselt ist und wartet. Da gibt es dann die Probleme mit der Blindheit, wenn der Mensch wehrlos in die Höhle gestoßen und festgekettet oder umgekehrt losgekettet und über den schmalen Aufstieg nach oben geschleppt wird. Um mit Wissen und Bildung am kranken Menschen zu arbeiten, muss der Arzt frei, gesund und motiviert sein, muss gut sehen und hören können, muss einen klaren Verstand mit einem guten Augenmass haben, wenn er dem Menschen eine echte Hilfe sein und bringen will. Deshalb ist es für den Arzt unverzichtbar, sich auf das Wesentliche, den kranken Menschen, zu konzentrieren und dem Leben die ihm gebührende Achtung mit dem größten Respekt entgegenzubringen. So gibt Plato's Höhlengleichnis Anlass, gründlich über das Leben nachzudenken. Es ist auch für den Arzt von großer Bedeutung geblieben.
Es war kurz vor Mitternacht, als das Telefon klingelte. Die Schwester rief aus dem 'theatre' an und sagte, dass der diensttuende Kollege Probleme bei der Operation habe und seine Hilfe brauche. Dr. Ferdinand zog sich Hemd und Sandalen an und machte sich auf den Weg zum Hospital. Der klare Sternenhimmel gab genug Licht, um die Schlaglöcher und Baumstümpfe zu umgehen. Die Mondsichel hatte den halben Weg genommen, den Centaurus erreicht und fuhr dem Kreuz des Südens entgegen. Im Kopf saßen die Gefangenen an Hals und Beinen gefesselt in der Höhle. Bizarre Schatten mit zu breiten Gesichtern auf zu kurzen Hälsen oder langgestreckte Kopfprofile mit zu langen Nasen auf langgezogenen Hälsen zogen vorüber. Da waren Hände mit verbogenen und langen Fingern, Hände, an denen Finger fehlten. Es gab Fäuste von gigantischer Größe, die groß genug waren, die Höhle mit wenigen Schlägen zu zertrümmern. Dr. Ferdinand stolperte über einen Stein, weil er dem Höhlengleichnis nachhing und sich nicht auf den Weg konzentrierte. Er hörte im Geiste das Klappern und Schlagen von schweren Ketten, das sich zum ohrenbetäubenden Kreischen und Quietschen der Ketten einrückender T-34 Panzer der roten Armee bei Kriegsende verstärkte; er hörte das wochenlange Stöhnen der Gefangenen aus seiner Kindheit. Als er den Platz vor der 'Municipality' überquert hatte und am ersten der fünf aufgestelzten Blockhäuser vorüberging, hatte er das Kettengeräusch so stark im Ohr, dass ihm der Weg da nun verkettet, ja zugekettet schien, wo vor der Unabhängigkeit der Stacheldraht ausgerollt war und man aufpassen musste, von diesem Draht nicht aufgerissen zu werden. Er erreichte das Hospital, zog die Kette vom verbogenen Torflügel der Einfahrt, schob ihn auf, wobei der Rahmen unten über den Boden kratzte, ging hindurch und schob den Torflügel zu, ohne die Kette wieder umzuschlagen. Er überquerte den Vorplatz, ohne auf den Uringeruch zu achten, ging den Gang links von der Rezeption geradeaus, drehte hinter dem OP-Haus im rechten Winkel nach rechts, öffnete die Tür zum 'theatre', schloss sie hinter sich und stand im Umkleideraum, wo im Teeraum nebenan eine Schwester mit ernstem Gesicht bereits auf ihn wartete und ihn bat, sich zu beeilen. Er tat es, warf seine Zivilkleidung über den Haken, zog sich die grüne Hose an und streifte sich das grüne Hemd noch über, als er schon im Waschraum stand und durch die offene Glastür in den OP blickte, den Schweiß auf der Stirn des jungen Operateurs und das besorgte Gesicht der OP-Schwester sah. Er meldete sich, drehte sich um, öffnete den Wasserhahn, unterzog seine Hände einer Notwäsche, schloss den Wasserhahn durch einen Druck des Ellenbogens gegen den Hebel, trocknete sich die Hände, ließ sich den grünen Kittel überziehen und streifte noch mühsam die schlecht gepuderten Gummihandschuhe über, als er schon am OP-Tisch stand.