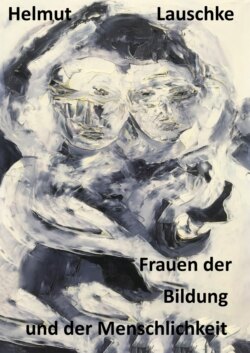Читать книгу Frauen der Bildung und der Menschlichkeit - Helmut Lauschke - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Lydia Grosz
ОглавлениеHoffnung und Zuversicht wurden “festgetönt”. Sie wurden im Schlussakkord des B-Dur mit der Fermate verankert, als stünde der Himmel mit der Erde im Einklang, wären die Sterne greifbar, wäre der Himmel bereits auf Erden. So klang das 2. Klavierkonzert von Brahms in der Warschauer Philharmonie unter der großartigen Stabführung seines hoch musikalischen Meisters aus.
Wiktor Kulczynski ordnete eine Pause von dreißig Minuten an, die er dazu nutzte, ein informatives Gespräch mit Boris zu führen. Die Mitglieder des Orchesters verließen die Bühne, um sich im Foyer eine Zigarette anzustecken und im kleinen Getränkeladen außerhalb der Philharmonie eine Tasse Kaffee oder ein Erfrischungsgetränk anderer Art zu beschaffen. Kulczynski: “Herr Baródin, ich möchte ihnen mein Kompliment machen; ihr Spiel hat mit sehr gut gefallen. Das Andante habe ich noch nie so schön spielen gehört wie von ihnen. Das haben Sie den ganz hohen Standard nicht nur erreicht, Sie haben ihn mit ihrem Spiel übertroffen. Darf ich fragen, wann Sie zuletzt das Brahms’sche Konzert gespielt haben?” Boris: “Es war vor einem dreiviertel Jahr, als ich es in der Carnegie Hall in New York unter Bernstein gespielt habe. Dann habe ich es im Leipziger Gewandhaus unter Sir Solti gebracht.” Kulczinski: “Ich gehe davon aus, dass auch diese beiden großen Dirigenten von ihrem Vortrag begeistert waren.” Boris: “Bernstein schlug mir mit einem breiten Lachen und der Bemerkung auf die Schulter: “Boris, das war große Klasse”. Sir Solti machte es auf seine feine Art; er lächelte mir zu, gab mir die Hand und sagte: “Brahms würde sich freuen, von einem Pianisten so gut verstanden worden zu sein. Ich gratuliere ihnen zu ihrem Spiel.” Kulczynski: “Den beiden kann ich mich nur anschließen, denn ihr Vortrag hatte Weltklasse. Sie wissen, dass Brahms für uns Polen nicht so leicht zu spielen ist wie Mozart, Tschaikowsky oder Mendelssohn Bartholdy, weil er ganz deutsch im Beethoven’schen Sinne geschrieben hat. Aber Sie haben uns mit ihrem Spiel ganz eingenommen, haben uns mitgerissen, haben uns den guten Brahms auf ihre Weise lieben gelernt. Das ist ein Verdienst, das ihnen zukommt, wofür ich, auch im Namen der Philharmonie, ihnen meinen Dank ausspreche.” Boris: “Nun übertreiben Sie aber, Maestro Kulczynski. Denn selten habe ich ein so inniges Zusammenspiel mit einem Orchester erlebt wie mit der Polnischen Philharmonie.” Kulczynski: “Sehr freundlich von ihnen. Doch, das darf ich sagen, wir haben uns auf ihr Kommen gefreut und uns auch gründlich vorbereitet.” Boris: “Das habe ich mit großer Freude gespürt.”
Kulczynski: “Lieber Baródin, im Saal sitzt meine Schwester. Sie war neugierig, ihr Spiel zu verfolgen und würde sich sehr freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Würden Sie das tun und mir die Ehre geben, Sie meiner Schwester vorzustellen?” Boris: “Das tu ich gern. Es ist mir eine Ehre.” Er drehte sich dem Saal zu und sah in der fünften Reihe eine alte Dame in dunkler Bekleidung und schneeweißem Haar. Sie gingen die sechs Stufen herab und auf die fünfte Reihe zu.
“Lydia”, sagte Wiktor Kulczynski, als sie die fünfte Sitzreihe erreichten, “darf ich dir Herrn Baródin vorstellen? Das ist meine Schwester Lydia Grosz.” Boris verbeugte sich vor der Dame, als sie ihm ihre Hand entgegenhielt und sie sich die Hände gaben. “Ich freue mich, Sie kennenzulernen”, sprach sie in fehlerfreiem Hochdeutsch, “ich habe viel von ihnen gehört und in den Kritiken über Sie gelesen.” Boris: “Hoffentlich waren Sie dann nicht enttäuscht.” “Nein, ganz im Gegenteil, Sie sind ein großartiger Pianist, davon konnte ich mich heute morgen persönlich überzeugen. Selten habe ich das Brahms-Konzert so eindrucksvoll erlebt wie bei ihrem Spiel. Ich habe das Konzert noch von Kempff, Horowitz und Goulda gehört. Denen stehen Sie nicht nach. Das ist bei ihren jungen Jahren eine Leistung, die Anerkennung verdient!”. Wiktor Kulczynski, ihr Bruder strahlte bei dem Kompliment seiner Schwester, auf deren Urteil er offensichtlich großes Gewicht legte, Boris an: “Nun hören Sie es von meiner Schwester, die sehr kritisch ist und in ihren jüngeren Jahren selbst eine hervorragende Pianistin war.” Boris sah der Dame hilflos in die Augen, denn ihm fiel eine bessere Antwort nicht ein als: “Vielen Dank! Das ist sehr freundlich von ihnen.” Lydia Grosz: “Herr Baródin, ich würde Sie gerne zum Tee in meinem Haus einladen. Wäre es ihnen möglich, zwischen fünf und sechs bei mir zu sein? Dann können wir uns ein wenig unterhalten. Ich habe erfahren, dass Sie im Polnischen Hof sind. Ich wohne in der Pesulski Straße 17. Diese Straße führt direkt zu ihrem Hotel. Wenn Sie aus dem Hotel kommen, sind es etwa vierhundert Meter.” Boris hatte eigentlich vorgehabt, sich mit Vera zu treffen, wusste aber nicht, ob sie am Abend frei hatte: “Es wäre mir eine große Ehre, Sie in ihrem Hause besuchen zu dürfen.” Lydia Grosz: “Dann sehen wir uns zwischen fünf und sechs.”
Das Orchester versammelte sich auf der Bühne, um die Probe fortzusetzen. Auf dem Programm stand Tschaikowsky’s Fünfte in e-Moll, Opus 64. Wiktor Kulczynski hatte sich auf’s Podium begeben und blätterte in der Partitur. “Nehmen wir uns nun die Fünfte vor. Es ist ein großes Werk, das uns Polen ins Herz geschrieben ist. Konzertmeister, ich darf um das ‘A’ bitten.” Der junge Konzertmeister mit den dunkelbraunen Augen und dem schwarzen, zurückgekämmten Haar strich den Bogen auf der A-Saite auf und ab. Er hatte den Saitenton zuvor mit dem ersten Fagott abgestimmt. Kulczynski: “Nun bitte alle das ‘A’. Bei den Celli ist das ‘A’ zu tief. Bitte noch einmal stimmen”, worauf der Konzertmeister noch einmal und so lange über die leere A-Saite strich, bis die Saiten der Streichinstrumente gleichmäßig gestimmt waren. Kulczynski: “Danke. Nun wollen wir beginnen. Beachten Sie die Lautzeichen mit den Crescendi und Decrescendi. Die Befolgung dieser Zeichen ist von größter Wichtigkeit.” Er hob den Stab und senkte ihn. Die A-Klarinetten bliesen das Thema des Andante: B-C-B-A-B-G / D-Es-D-C-D-B / G-F-ES-D-C-B. Boris liebte die Fünfte von Tschaikowsky wegen der Stärke, mit der slawisches Fühlen zum Ausdruck kommt. Er hatte sich neben Frau Lydia Grosz gesetzt, der Schwester des Dirigenten, um sich den ersten Satz anzuhören. Schon in den ersten sechs Takten des Klarinettenvortrags trat wieder der breite Wolgastrom vor seine Augen. Aus den gebundenen Sechzehnteln nach den punktierten Vierteln hörte er das Schluchzen der Menschens, so auch seines Vaters Ilja Igorowitsch. Drückender war slawische Schwermut nicht zu bringen als mit dem Beginn des Andante dieser Symphonie. Im Vergleich dazu drückte der Beginn des Brahms’schen Klavierkonzertes weit weniger, auch wenn Boris da schon das Gefühl der Schwermut überkam. In der Fünften von Tschaikowsky, da war es das Trauerlied, der Trauermarsch, die Melancholie von größter Schwere. Diese Melancholie der Ausweglosigkeit konnte die Häftlinge in den Arbeits- und Vernichtungslagern der Nazis oder Stalins (“Archipel GULAG”) befallen haben, sie konnten den Trauermarsch gesummt haben, wenn sie abgerungen und ausgezehrt mit der frühesten Dämmerung zur Arbeit ausrückten, mit der letzten Dämmerung zurückkehrten, oder sich im Morgengrauen eines kalten Wintertages versammelten, zerrissen und gedemütigt bis in die Dürftigkeit der Kleidung und des Schuhwerks hinein durch den tiefen Schnee stapften und über eisig gefrorene Wege schlurften, um unter scharfer Bewachung zum ausgehobenen Massengrab, zur Erschießungsmauer oder Gaskammer geführt wurden. Das Thema des Andante fuhr Boris durch Mark und Bein. Es erschütterte ihn. In der Vorstellung solch letzter Einsamkeit und Verlassenheit des Menschen überkam ihn das hilflose Zittern.
Ergriffen und erschüttert saß Boris neben Lydia Grosz, der alten dunkel gekleideten Dame mit dem schneeweißen Haar und hörte sich den tragischen Satz bis zu Ende an. Die Melancholie hatte ihn aufgewühlt. Er nahm sich zusammen und hoffte, dass die Dame sein Zittern, das ihm durch die Glieder gefahren war, nicht merkte. Nach diesem ergreifenden Tschaikowsky’schen Andante legte das Orchester eine Pause ein. Wiktor Kulczynski gab Instruktionen, wie der Ausdruck des Andante noch zu steigern war. Da merkte Boris, dass Dirigent und Orchester mit der russischen Musik bis ins Blut vertraut waren. Er dachte jedoch, dass eine Steigerung im Vortrag des Andante mit dem noch Mehr an Melancholie nicht möglich sei, denn die Zuhörer sollten nicht überfordert werden und gleich zu Beginn in Weinkrämpfe verfallen. Er raffte sich zusammen, verabschiedete sich von Frau Grosz, die bei der Verabschiedung leise hinzufügte: “Wir sehen uns heute Nachmittag in der Pesulski Straße 17.”
Boris verließ den Saal, während Wiktor Kulczynski seine Instruktionen beendet hatte und um Wiederholung des Satzanfangs bat. Beim Verlassen der Philharmonie atmete Boris einige Male tief durch, um sich mit der Welt außerhalb der Musik vertraut zu machen. Er ging zum nächsten Taxistand und ließ sich zum Hotel ‘Polnischer Hof’ zurückfahren. Er sah aus dem Fenster und spürte, wie das Andante aus der Fünften in ihm nachklang, die Melancholie in ihm nachwirkte. Die Außenwelt mit ihren Auto, den Radfahrern und eilenden Passanten kam ihm fremd und leer vor. Das Amusische dieser Welt stieß ihn ab. Das Taxi hielt vor dem Hotel, er stieg aus, zahlte, was zu zahlen war, und gab dem Fahrer ein fürstliches Trinkgeld. Der dankte und reichte Boris seine Notentasche durch’s offene Fenster: “Die sollten Sie nicht vergessen.” Boris dankte für die Aufmerksamkeit.
Tief wirkte die Probe in ihm nach, dass er das Lächeln, das ihm Vera von der Rezeption zum Eingang schickte, als er durch die Tür trat, nicht bemerkte. “Wie war es?”, fragte sie, als er sich der Rezeption näherte. “Es hat geklappt”, antwortete Boris in knappen Worten. Von der Wirkung, die das Andante aus Tschaikowsky’s Fünfter in ihm ausgelöst hatte und noch stark in ihm arbeitete sowie von den Bildassoziationen der breiten, träg dahinfließenden Wolga, an deren Ufer sein Vater, Ilja Igorowitsch, stand und nach ihm rief, sagte er kein Wort. Vera entging das angespannte Gesicht des jungen, von ihr verehrten Pianisten nicht, dem sie im Geheimen ihre Liebe gab. “Nun sollten Sie sich ausruhen und pünktlich am Mittagstisch sein. Als Spezialität gibt es heute Eisbein mit Sauerkraut und Dampfkartoffeln”, sagte Vera. Sie behielt ihr freundliches Lächeln auf dem Gesicht und bemühte sich, Boris zu entspannen. Da kein anderer Gast an der Rezeption stand und auch keiner auf die Rezeption zukam, sagte sie, dass sie sich für den Nachmittag freigenommen hatte: “Da können wir vielleicht einen Spaziergang durch die Stadt unternehmen und irgendwo eine Tasse Kaffee zusammen trinken.” Boris schaute sie mit großen Augen an, denn er kam langsam aus der Welt der Philharmonie in die Außenwelt zurück: “Das ist eine gute Idee, Fräulein Vera. Von wann ab haben Sie sich denn freigenommen? Ich frage deshalb, weil mich Frau Lydia Grosz, die Schwester des Dirigenten, zum Nachmittagstee zwischen fünf und sechs in ihr Haus in der Pesulski Straße eingeladen hat.” Vera: “Dann verkehren Sie bereits in der großen Gesellschaft, denn diese Dame ist durch ihre Leitartikel in verschiedenen Zeitungen und ihre Wohltätigkeit für Waisenkinder in Warschau bekannt. Um ihre Frage zu beantworten, ich habe mir ab zwei Uhr freigenommen.” Boris: “Dann haben wir doch einige Stunden Zeit für einen Stadtbummel, den ich gern mit ihnen unternehmen würde.” Vera: “Nur wenn es Sie nicht überfordert, Boris Baródin, denn Sie müssen sich für das Konzert schonen. Da will ich Sie nicht strapazieren.” Boris: “Das tun Sie ganz und gar nicht. Ein Rundgang durch die Stadt mit ihnen, daran hatte ich letzte Nacht schon gedacht.” Vera: “Gut, dann treffen wir uns halb drei draußen vor dem Eingang. Nun vergessen Sie das Mittagessen nicht.”
Die Schwermut, die im Beginn des Brahms-Konzertes herauszuhören war, für mich so deutlich, dass mir plötzlich Bilder mit dem breiten, träg dahinfließenden Wolgastrom in den Sinn kamen, reichte im Vergleich zum Beginn der Fünften von Tschaikowsky, dem Andante, nicht heran. Die Emotion der Schwermut, wie sie russisch empfunden und vom großen russischen Genius vertont wurde, ist um ein vielfaches stärker. Sie ist so stark, dass ich erzitterte, weil mir mit der Eingangsmelodie im Andante die fürchterlichen Bilder der verzehrten, ausgehungerten Häftlinge in den KZ’s der Nazi oder den Stalin’schen Arbeitslagern vor das Auge traten und ich sie im Geiste diese Melodie summen hörte, wenn sie im frühen Morgengrauen zur Arbeit ausrückten, in der späten Abenddämmerung zurückkehrten oder sich an einem kalten Wintermorgen versammelten, um entkräftet und entwürdigt zum frisch ausgehobenen Massengrab, zur Erschießungsmauer oder zur Gaskammer geführt zu werden. Bei der Vorstellung dieser Einsamkeit und Verlassenheit des Menschen hat es mich geschüttelt.” Vera: “Da hat Sie Tschaikowsky aber hart getroffen.” Boris: “Das hat er mit Sicherheit, und jedesmal, wenn ich den Beginn des Andante höre, erfasst mich das Zittern von neuem.” Vera: “Aber Boris Baródin, Sie sind zu jung, um von diesen Grausamkeiten zu wissen. Ihr Wissen davon können Sie doch nur von Erzählungen bekommen haben.” Boris: “Das stimmt. Aber schon die Erzählungen, die ich von meinem Vater, dem Sowjetgeneral Ilja Igorowitsch Tscherebilski, und meinem Großvater, dem ehemaliger Breslauer Superintendenten Eckhard Hieronymus Dorfbrunner, bekommen habe, haben sich schwer auf meine Seele gelegt. Die Erzählungen, wie grausam da mit den Menschen umgegangen wurde, haben sich tief in mein Gedächtnis eingemeißelt. Sie sind für mich furchtbar und unvergesslich. Glauben Sie mir, Vera, die Musik, die ich spiele, ist in erster Linie und jedesmal diesen Menschen gewidmet, die von diesem Terror ergriffen, getötet oder zu Krüppeln geschlagen wurden.” Vera: “Nun versteh ich Sie viel besser. Ich verstehe, warum die Musik für Sie so wichtig ist. Sie ist das Medium, um den Menschen nicht nur in die Köpfe, sondern in ihre Herzen zu reden und den Kontakt zum Menschen zu halten, auch dann, wenn er getötet wurde.” Boris: “So können Sie es sehen. Da sehen Sie in die richtige Richtung. Die Botschaft, die ich zu bringen habe, begnügt sich nicht mit der Oberfläche, lässt sich von ihr nicht aufhalten, sondern zielt in die Tiefe. In die Tiefe der Herzen soll die Botschaft gehn. Wie sonst sollten sich die Menschen bessern, sind sie noch ansprechbar oder wachzurütteln, das Gute zu tun und das Böse zu lassen?!” Vera: “Ich verstehe, Boris Baródin, Sie sind ein Missionar, der die Menschen durch ihre Musik zur Umkehr bekehren will.” Boris: “Das Problem ist die fehlende Kommunikation unter den Menschen. Dazu kommt der eiskalte Materialismus, bei dem nur das Geld zählt. Die Jugend in Deutschland fühlt sich von der älteren Generation unverstanden.
Die Maßstäbe der guten Erziehung sind abgebrochen, verstümmelt; die guten Sitten sind verkommen. In der Gesellschaft sind Ordnung, Respekt vor dem Mitmenschen und der Wille zur Nächstenhilfe verlorengegangen. Das Laissez-faire der Gleichgültigkeit und das Drogenproblem haben überhand genommen. Ist das in Polen auch so?” Vera: “Es hat auch hier begonnen. Auch hier ist der Materialismus in die polnischen Köpfe eingezogen. Auch hier ist es zu spüren, wie sich die Jugend von der älteren Generation absetzt und ihre eigenen Wege gehen will. Auch hier gerät die Gesellschaft aus den Fugen der guten Sitten. Die jungen beklagen, von den alten nicht verstanden zu werden; die alten halten der Jugend die zunehmende Respektlosigkeit und Unwilligkeit beim Lernen vor. Boris, hier ist nicht alles gut, was für den ersten Augenblick glänzt. Für mich als junge Frau kommen dann noch die Frechheiten hinzu, die sich Männer den Frauen gegenüber herausnehmen. Das hat es früher, in den ersten Jahren nach dem Kriege nicht gegeben, als alle Hand in Hand gearbeitet haben, das verwüstete Polen wieder aufzubauen, aus den Ruinen wieder ansehnliche Städte zu errichten. Da gab es den Respekt vor dem anderen Menschen noch; da galt das Wort der Alten viel, und die Jugend hörte auf die Eltern und befolgte ihren Rat. Das hat sich mit dem aufkommenden Wohlstand geändert. Nun meint jeder, er könne es besser als der andere, der jüngere besser als der Alte.” Boris: “Dann gibt es auch hier das Drogenproblem.” Vera: “Das gibt es in der Tat. Das Rauschgift kommt aus Kasachstan und Turkmenistan und nimmt den weiten Weg über die transsibirische Eisenbahn bis nach Moskau oder die Krim, von wo es per Schiff oder Laster nach Polen kommt.” Boris: “Den Menschen in Deutschland ist mit dem Wohlstand das Lachen vergangen. Auf den Straßen gehen sie grußlos aneinander vorüber. Sie sind hektisch geworden, kümmern sich nicht um den andern, der durch’s Betteln sein Leben fristet. Auch in Deutschland gibt es die Straßenkinder, die unter den Brücken mit den Trinkern und in leerstehenden Altbauten übernachten, die vor dem Abbruch stehen, um neuen Verwaltungs- und Mietshäusern, nennen Sie die Kolossbauten auch Mietskasernen, Platz zu machen.
Vera: “Es gibt staatliche Einrichtungen, um diesen Menschen zu helfen. Vor allem ist es die Kirche, die sich der Obdachlosen und Waisenkinder angenommen hat, ihnen eine warme Mahlzeit pro Tag und eine Schlafstelle gibt. Doch reichen diese Einrichtungen nicht aus.” Boris: “Dann frisst in Polen der Sozialismus seine Kinder.” Vera: “Und das im gesamten Ostblock. Können Sie sich vorstellen, wie das erst in der Sowjetunion ist, ich meine in Moskau, Leningrad, der ukrainischen oder weißrussischen Republik? Die Menschen sind dort noch ärmer als hier in Polen. Dort im Osten hat der Staat den Kirchen das Schweigen verordnet. Da schweigen die Kirchen zu diesem Problem, gibt es keine Predigt wie hier in Warschau, die zur tätigen Nächstenliebe aufruft.” Boris: “Vera, mit der Kirche fassen Sie ein heißes Eisen an. Mein Großvater, Eckhard Hieronymus Dorfbrunner, war bis zur Flucht mit der Großmutter und meiner Mutter aus Schlesien Superintendent in Breslau. Er hat erzählt, wie trotz seiner Predigten mit der Botschaft zur tätigen Nächstenliebe, er soll ein wortgewaltiger Prediger gewesen sein, die Juden, Sozialisten und andere Systemkritiker von den Nazis aus ihren Häusern und Wohnungen gezerrt und geprügelt wurden. Er erzählte, wie zweimal in der Woche voll gepackte Güterzüge durch Breslau in den Osten fuhren, in denen Juden mit ihren Familien bis zu den Babys in die Vernichtungslager von Treblinka und Auschwitz-Birkenau transportiert wurden. Mein Großvater bekam Tränen, wenn er davon und vom Versagen der Kirche, dem Opportunismus der Bischöfe und der allgemeinen Ignoranz mit dem Wegsehen der Menschen sprach.”
Sie gingen die Allee des Widerstand herunter. Vera fasste Boris’ Hand, der die Weichheit ihrer Hand fühlte. Sie hatte eine schmale, schön ausgezogene Hand mit schmalen, langen Finger, eine Hand, die zum Klavierspielen prädestiniert war. Boris: “Vera, wissen Sie, dass Sie die erste Frau sind, der ich die Hand halte, ich meine, der ich zubillige, ihre Hand in meine zu tun.” Vera lachte: “Dabei dürften Sie sich vor Frauenhänden nicht retten können. Dabei möchte jede Frau ihre Hand in die Hand eines berühmten Pianisten geben.” Nun lachte auch Boris: “Aber bei mir sind Sie die erste, die das ohne meinen Widerstand tut.” Vera: “Ihre Hand zu spüren, mit der Chopin und Brahms gespielt wird, ist mir ein großes, unvergleichliches Erlebnis. Ihre Hand ist für eine Männerhand weich und feingliedrig. Es ist eine ganz besondere Hand, die ich nicht mehr loslassen wollte, wenn ich es könnte.” Boris: “Sie haben auch eine schöne und weiche Hand, die sich vielversprechend anfühlt. Haben Sie mal ein Instrument gespielt?” Beide bildeten ein schönes Paar, dem die Entgegenkommenden mit neugierig großen Augen entgegensahen und sich nach dem Vorübergehen nach ihm umdrehte. Hinzu kam die deutsche Sprache. Wenn sie von den Passanten gehört wurde, war sie doch für Warschauer Cafés und Straßen die seltene Ausnahme. Das wusste Boris auch, dass nach dem Krieg die deutsche Sprache in Polen nicht gern gehört, geschweige denn gesprochen wurde. Das hatte mit dem harten Deutsch der Nazis und der SS zu tun, mit der die Polen gedemütigt und gefoltert wurden. Auch wenn die Polen die deutsche Sprache beherrschten, sprachen sie im Nachkriegsexil in der Bundesrepublik Deutschland französisch oder englisch, alles andere nur nicht deutsch. Vera: “Ich wollte immer gern Klavier spielen. Doch dazu kam es seit dem Tode meines Vater nicht mehr. Wie schon gesagt, ich hatte für die Familie zu sorgen und das Geld für den Unterhalt zu beschaffen.” Boris: “Wenn ich ihnen auf dem Klavier etwas zeige, würden Sie das auch annehmen wollen?” Vera: “Das Wollen ist das kleinere Problem, ich meine, das ist überhaupt kein Problem. Das Problem, was das größere sein wird, ist das Können.” Boris: “Das wird sich herausstellen, wenn ich ihnen die ersten Schritte auf dem Klavier zeige.” Vera: “Das kann ich einem Pianisten, wie es Boris Baródin ist, nicht zumuten, sich mit so kleinen, ungelernten Leuten abzugeben.” Boris: “Vera, Sie erinnern sich an den Freiraum bezüglich der Erfüllung des Glücks in unserem Gespräch.” Vera: “Soll das heißen, dass Sie mich lieben?” Boris: “Ich sagte ihnen, dass Sie ein Feuer in mir entzündet haben, dass es mir ganz heiß geworden ist. Vera, Sie sind die erste Frau, der ich das Angebot mit dem Klavier mache, weil Sie die erste Frau sind, der ich die Hand halte, weil ich Sie liebe. Und nun sage ich es ihnen auch.” Vera drückte seine Hand und gab ihm den zweiten Kuss auf die Wange. Dabei scheute sie vor den neugierig schauenden Passanten nicht zurück. Sie musste ihn küssen, weil sie für dieses “Statement” der Liebe so schnell keine Worte fand. Boris legte seinen Arm um ihre Schulter, und sie gingen aneinander geschmiegt die Straßen weiter. Der Druck des rhythmischen Ausladens ihrer Hüfte beim Gang gegen seinen Oberschenkel erweckte in ihm erotische Empfindungen, die für ihn bislang unbekannt waren. “Auch das ist das erste Mal, dass ich den Gang einer jungen Frau so reizvoll empfinde”, sagte er zu sich, während er auf die wunderbare Natürlichkeit des Schrittes ihrer Beine sah.
An der Abzweigung zur Pesulski-Straße verabschiedeten sie sich voneinander und hatten für den späten Abend ein Treffen im Musiksaal des Hotels vereinbart, wo Boris ihr die ersten Schritte auf dem Klavier zeigen wollte. Er umarmte sie und küsste sie auf den Mund. “Dann können wir auch Du zueinander sagen”, schickte Boris dem Kuss hinterher. Vera: “Bis später, Boris. Ich liebe dich!” Boris schaute ihr kurz nach und bewunderte ihren Gang mit den ausladenden Hüften, was durch ihr kniekurzes, eng anliegendes olivgrünes Kleid und ihre Taille vorteilhaft betont wurde. Beeindruckt und mit den Neuigkeiten des Nachmittags ging er die Pesulski-Straße bis zur Nummer 17. Er stand vor einem alten Bürgerhaus mit einem kleinen Vorgarten hinter einem schmiedeeisernen Zaun. Die Einschlagslöcher der Granaten waren mit Zement geschlossen, doch waren die Kriegsschäden nicht so perfekt wegrestauriert worden wie am Alten Rathaus und den anderen Gebäuden der Innenstadt.
Boris klingelte am Tor des Vorgartens. Frau Lydia Grosz öffnete die Haustür und rief: “Kommen Sie, Herr Baródin, ich erwarte Sie.” Boris ging den Weg zur Haustür. Dort streckte ihm Frau Grosz die Hand entgegen und begrüßte ihn mit den Worten: “Ich freue mich, dass Sie gekommen sind.” Er schloss die Tür und folgte ihr durch den langen Flur, der mit Ölgemälden behängt war, in den Salon, einem großen Raum am Flurende. Der Raum war mit einem Perserteppich ausgelegt und mit alten Barockmöbeln geschmackvoll ausgestattet. Auf dem kleinen, schmucken Schreibtisch mit mehreren Schubladen im Aufsatz, zwei rechts, zwei links und der kleinen gefächerten Ablage in der Mitte, waren zwei Fotos hinter Glas aufgestellt. Es waren Fotos von Männern, von denen der eine etwa im Zenit des Lebens gestanden haben mochte und der andere ein junges schönes Gesicht mit hoher Stirn, einer schmalen Nase, großen dunklen Augen und einem ausdrucksvollen Mund mit ausladenden und geschwungenen Lippen hatte.
“Nehmen Sie doch Platz, Herr Baródin.” Frau Grosz führte ihn zur Klubgarnitur in die Salonecke, die im Winkel zweier Wände mit je einem Fenster war. Das eine Fenster gab den Blick auf die Pesulski-Straße frei, während das andere Fenster, vor dem rechts der kleine Barock-Schreibtisch stand, den Einblick in einen kleinen Garten mit dem hohen Nussbaum, zwei Birken und einem Blumen- und einem Gurkenbeet gab. Frau Grosz wies ihm den einen der drei Barock-Sessel zu, während sie sich im dunkelblauen Kostüm mit violettem Seidenschal auf die zweisitzige Couch setzte. “Sie haben hoffentlich keine Schwierigkeiten gehabt, mich zu finden”, begann Frau Grosz die Konversation. Boris: “Nachdem Sie es mir erklärt hatten, war es wirklich leicht, Sie zu finden.” Frau Grosz: “Dann bin ich froh, dass Sie nicht lange suchen mussten. Vor einer halben Stunde hatte mich mein Bruder angerufen. Er ist des Lobes voll über ihren Brahms-Vortrag.” Boris: “Vielen Dank.” Frau Grosz: “Und nicht nur er ist von ihrem Spiel begeistert. Auch mir hat ihr Spiel sehr gefallen. Wie ich schon in der Philharmonie sagte, steht ihr Brahms-Vortrag dem anderer großer Pianisten nicht nach. Ich habe das Klavierkonzert von Kempff, Horowitz und Goulda gehört. Doch Sie haben es großartig gespielt. Sie haben die Begabung, die Seele des Werkes zu entfalten und dem polnischen Ohr hörbar zu machen. Wie oft haben Sie das Konzert gespielt, Herr Baródin?” Boris: “Ich habe es schon einige Male gespielt. Doch mit jeder Wiederholung bin ich reifer geworden, bin näher an das herangekommen, was Brahms sagen will.” Frau Grosz: “Und er hat so vieles zu sagen. Es reicht von der Melancholie zu Beginn des ersten Satzes mit dem Aufschwung, der Brahms’schen Frage nach dem Leben, der die akzentuierten Motive, ich möchte sagen, die Reitermotive mit den Sprüngen folgen, über die verhalten schwingende Heiterkeit im Allegro appassionato bis zur nachdenklichen Bestimmtheit des Andante im Zuspruch, das Leben anzunehmen und zu seiner Bewältigung mit dem Mut nicht nachzulassen und dabei aufrichtig und standfest zu sein. Ein aufweckendes und wachrüttelndes Werk, das zur Nachdenklichkeit stimmt.” Boris: “Ja, das Klavierkonzert ist ein großes Werk, in der die Gefühlsskala von der Schwermut bis zur Heiterkeit, vom Erwachen zum Erstaunen, von den Tiefen des Leides bis zu den Höhen der Freude und der großen Hoffnung mit dem vollendeten Glück führt.” Frau Grosz: “Das er selbst nie bekommen hat. Brahms hatte eine überempfindliche Seele, die er in seiner Musik großartig und nobel zum Ausdruck bringt.
Als Mensch war Brahms schwierig im Umgang. Er war leicht verletzbar, liebte Kinder und konnte schroff zu den Erwachsenen sein. Von meinem Mann, der Geiger in der Wiener Philharmonie war, habe ich die folgende Anekdote noch in Erinnerung: folgte Brahms einer Einladung, was er nicht immer tat, dann fiel er durch seine Schweigsamkeit auf. Auf Äußerungen der Erwachsenen reagierte er empfindlich und oft gereizt. Beim Verlassen einer Gesellschaft soll er sich an der Tür umgedreht und gesagt haben: wenn noch einer sein sollte, den er nicht beleidigt habe, dann möchte er sich dafür entschuldigen.” Boris: “Diese Anekdote kannte ich nicht, aber ich stimme ihnen zu, dass Brahms in seiner Überempfindlichkeit schnell verletzbar gewesen sein musste. Das ist aus seiner Musik herauszuhören.” Frau Grosz: “Und stets schwingt das Geheimnisvolle durch seine Musik.” Boris: “Wie oft das Tragische durch die Musik Tschaikowsky’s schwingt.”
Frau Grosz: “Das haben Sie gut herausgehört, Herr Baródin. Doch wissen Sie, mit der Tragik können wir Polen besser umgehen als mit dem Geheimnisvollen, das sich nicht immer offenbart. Die Tragik ist uns Polen ins Herz geschrieben. Nehmen Sie die polnische Geschichte bis zum zweiten Weltkrieg. Sie ist von Tragik und Trauer gesättigt.” Boris: “Obwohl beide auch dem deutschen Volk aufgegeben wurden.” Frau Grosz: “Das stimmt, wenn auch nicht in diesem Ausmaß, wie sie dem polnischen Volk aufgegeben wurden. Denken Sie an die Besetzung Polens durch die deutsche Armee, denken Sie Treblinka und Auschwitz. Das haben die Deutschen in diesem Maße nicht erlitten. Das werden Sie von ihren Eltern gehört haben.” Boris: “Mein Vater war sowjetischer General und der erste Nachkriegskommandant von Bautzen. Meine Mutter wurde am zweiten Tag von zwei Russen auf dem Dachboden vergewaltigt.” Frau Grosz: “Das tut mir leid, und das mit ihrem Vater stimmt mich neugierig. Dann sprechen Sie auch russisch? Mein Vater hat mir einiges beigebracht, von dem allerdings nicht mehr viel geblieben ist.” Frau Grosz: “Und von wem haben Sie ihre musikalische Begabung geerbt?” Boris: “Vom Vater, der ein ausgezeichneter Pianist war und sagte, dass er beim Klavier hätte bleiben sollen, wo er glücklich geworden wäre, was er als General der Roten Armee nicht wurde.” Frau Grosz: “Die Musikalität ist bei den Russen weit verbreitet. Doch erstaunt die Kombination von Pianist und General, wenn ich vergleichbare Kombinationen bei Berufsoffizieren mit einer mathematischen oder künstlerischen Ausbildung schon angetroffen habe.”
Boris: “Mein Vater hat mir die ersten Schritte auf dem Klavier beigebracht. Dafür bin ich ihm zeitlebens dankbar.” Frau Grosz: “Da tun Sie aber recht. Er ist dann sicherlich ein sensibler Mensch…” Boris: “Dem jedes Kind auf dem Kopf rumtanzen kann, ohne dass er die Geduld verliert. Die Untergebenen hatten großen Respekt vor ihm.” Frau Grosz: “Das ist interessant und eine besondere Geschichte, aus der Sie hervorgegangen sind. Haben Sie noch Kontakt zu ihrem Vater?” Boris: “Ich werde ihn in Moskau treffen, wenn ich dort das Brahms-Konzert spielen werde. Wie Vater schrieb, zählt er die Tage bis zu meinem Kommen.” Frau Grosz: “Wie wunderbar. Sie vereinen in ihrem Blut die deutsche und die russische Kultur. Das zeichnet Sie zum besonderen Kulturträger aus. Ich hatte mir schon so etwas gedacht, denn Baródin ist kein deutscher Name.” Boris: “Es ist der Name der Mutter meines Vaters.” Frau Grosz: “Auch aus ihrem Brahms-Vortrag konnte ich heraushören, dass ein gut Teil slawisches Blut durch ihre Adern fließt. Vielleicht ist es das Mischblut in ihnen, dass Sie das Konzert für uns Polen so aufweckend, empfindsam und liebenswert spielen. Denn mein Bruder ist mit Komplimenten dieser Art, dass er durch ihr Spiel Brahms wieder lieben gelernt hat, im allgemeinen äußerst zurückhaltend. Offen gesagt, ich kann mich an keinen Fall erinnern, dass er das getan hat.” Boris: “Selbst kann ich dazu nichts sagen, weil ich mir gegenüber nicht objektiv bin. Aber wo Sie das mit dem slawischen Blut erwähnen, kann ich mir auch besser erklären, warum mir beim Andante in Tschaikowsky’s Fünfter Tränen in die Augen stiegen und ich anfing zu zittern. Diese Schwermut wirft mich jedesmal um.” Frau Grosz: “Herr Baródin, weil Sie durch den slawischen Teil in ihrem Blut auch slawisch fühlen. Das ist für mich ganz offensichtlich. Dabei muss ich gestehen, dass auch mich dieses Andante zutiefst erschüttert. Da ist es keine Schwäche, wenn die Tränen in die Augen steigen. Es ist die Teilnahme am Schicksal der Menschen, unter denen es so viel Leid und Trauer gibt.” Boris: “Darf ich Sie fragen, wer die beiden Männer auf den Fotos sind?” Frau Grosz: “Der eine war mein Mann, der Geiger in der Wiener Philharmonie war und mit anderen Orchestermitgliedern nach Ausschwitz deportiert und vergast wurde; der andere war mein Sohn, der bei den Straßenkämpfen in Warschau von den Deutschen erschossen wurde. Er wollte Medizin studieren, war sehr musikalisch und sprach fünf Sprachen.” Boris: “Ich darf ihnen nachträglich mein tiefempfundenes Beileid ausdrücken.” Frau Grosz: “Das ist sehr lieb von ihnen. Das ist mein Schicksal, mit dem ich fertig werden muss, aber nicht fertig werde. Es waren zwei Männer von hoher Intelligenz und großer Fürsorglichkeit. Mein Mann war polnischer Jude, mein Sohn ein halbjüdischer Patriot, der überhaupt nicht zögerte, sein Leben für die Befreiung Warschaus einzusetzen, das er schließlich auch ganz gegeben hat.” Boris: “Das sind ja erschütternde Geschichten, die Sie mit sich tragen.” Frau Grosz: “Wissen Sie, Herbert von Karajan leitete die Wiener Philharmonie. Aber er war ausschließlich auf seine Karriere bedacht. Er war ein frühes Mitglied der Nazipartei in Österreich und nach dem “Anschluss” 1938 gleich auch Mitglied der deutschen Nazipartei. Der hat sich überhaupt nicht für seine jüdischen Orchestermitglieder eingesetzt, hat nicht um ihr Leben gekämpft. Er war kein Furtwängler, der die Nazis verabscheute, persönlich bei Goebbels vorstellig wurde und um das Leben der Mitglieder der Berliner Philharmonie kämpfte.” Boris: “Leider hat auch dieser große, hagere Mann nicht alle aus seinem Ensemble retten können.” Frau Grosz: “Aber er hat es versucht und dabei sein Leben riskiert, was Karajan nicht getan hatte. Wissen Sie, Herr Baródin, für mich sind die Deutschen ein Rätsel geblieben. Sie sind gebildet und fleißig, haben einen Bach, Beethoven, Brahms, einen Goethe, Schiller und Lessing hervorgebracht, aber den Faust, die Glocke oder den Nathan haben sie nicht verstanden. Nehmen Sie die Ringparabel im Nathan. Sie ist das Vermächtnis zur Toleranz und Gerechtigkeit.” Boris: “Ich habe den Nathan in der Schule gelesen. Er war sogar ein Aufsatzthema. Soweit ich mich erinnere, hatte der Vater seinen Ring kopieren lassen und kurz vor seinem Tod jedem Sohn einen Ring gegeben. Nun erhob jeder Sohn seinen Anspruch auf den Titel des hinterlassenen Besitzes des Vaters, weil er seinen Ring geerbt hatte. Doch Vater’s Ring, der Musterring, war von den Kopien nicht zu unterscheiden.” Frau Grosz: “Nun kommt die Pointe in der Frage, wer im Recht ist. Nathan sagt, der rechte Ring ist nicht erweislich, fast so unerweislich wie der rechte Glaube ist. Der Vater hat die Kopien in der Absicht machen lassen, dass die Ringe nicht zu unterscheiden sind. Das ist doch die Lehre, die wir aus dem Nathan zu ziehen haben: das Gebot zur Toleranz und zum Großmut. Da hat sich die Hybris der Nazis schwer vergriffen, als gäbe es nur die Deutschen, die eine Kultur und den richtigen “Glauben” haben.” Boris: “Für die Fehler und ihre Einschätzungen ist das deutsche Volk schwer bestraft worden. Frau Grosz: “Da stimme ich ihnen zu, denn viele gute Deutsche hat es ja auch fürchterlich getroffen.
Nun soll das neue Kapitel unserer Völker geschrieben werden. Deshalb sind Sie hier, um mit dem Brahms-Konzert zur Verständigung und Aussöhnung beizutragen.” Frau Grosz goss den Tee nach: “Das ist eine verantwortungsvolle, antwortschwere, aber ehrenwerte Aufgabe im Sinne des Vermächtnisses des Nathan, die auf Sie wie auf die Künstler unserer Völker im Allgemeinen zukommt. Kennen Sie die Vorgeschichte des Nathan?” Boris: “Nein, die kenne ich nicht.” Frau Grosz: “Lessing war als Bibliothekar der Wolfenbütteler Bibliothek mit dem hamburgischen Hauptpastor Götze in einen literarisch-theologischen Streit geraten. Der Streit ging um die Freiheit der Forschung in religiösen Fragen, der soviel Aufsehen erregte, dass der Bibliothek (im Juli 1778) durch Kabinettsbefehl weitere Veröffentlichungen verboten wurden. Durch diesen Befehl ließ sich Lessing jedoch nicht mundtot machen. Er verfasste den Nathan und hoffte, dem Theologen einen “ärgeren Possen” zu spielen als mit den zuvor verfassten zehn Fragmenten, die den Streit auslösten.
In seinem Brief an Elise Reimarus schrieb Lessing am 6. September 1778, dass er versuche, wenigstens auf seiner alten Kanzel, dem Theater, noch ungestört “predigen” zu können. Die Quelle zum Nathan war eine Novelle aus dem ‘Decamerone’ von Giovanni Boccaccio (1313-1375). Eine Aufführung des Nathan hat Lessing nie erlebt. Erst nach der Bearbeitung von Schiller wurde der Nathan in Weimar am 28. November 1801 uraufgeführt.” Boris: “Ich bewundere ihr Wissen um den Nathan.” Frau Grosz: “Der Nathan wurde von Lessing in deutsch geschrieben, der zur Weltliteratur zählt, weil er die Fragen der Freiheit und Toleranz behandelt. Wir Polen lieben und verehren den Nathan. Ich habe ihn als Mädchen in der Schule in der Originalfassung gelesen. Später habe ich den Nathan in den verschiedenen Sprachen auf der Bühne erlebt. Von Goethe, der den Nathan verehrte, kommt der Satz: ‘Möge das im Nathan ausgesprochene göttliche Duldungs- und Schonungsgefühl der Nation heilig und wert bleiben!’ Da spricht doch die große Kultur zu uns.” Boris: “Ja, ich verstehe Sie. Darum müssen wir die schlimme Vergangenheit abschließen und den Neuanfang machen; wir müssen die Aufgabe der Verzeihung und Aussöhnung annehmen und unseren Beitrag dazu leisten, damit das Kapitel des unsäglichen Leides ein für allemal abgeschlossen wird.” Frau Grosz: “Nach diesem Gespräch freue ich mich noch mehr auf ihr Konzert, zu dessen Gelingen ich ihnen die Daumen drücke.” Frau Grosz brachte Boris an die Tür, wo sich Boris für das Gespräch bedankte.