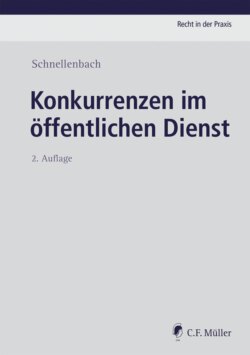Читать книгу Konkurrenzen im öffentlichen Dienst - Helmut Schnellenbach - Страница 12
ОглавлениеII. Exegese
1. Zu Art. 73 Abs. 1 Nr. 8 GG
7
Die Bestimmung umfasst auch Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts; für die Bahn- und Postfolgeunternehmen gelten Art. 143a und Art. 143b GG.[1] Auch Tarifbeschäftigte – und nicht nur Beamte – im Bundesdienst[2] sowie Bundeswehrangehörige[3] sind dem hier angesprochenen Kreis von Dienstnehmern zuzurechnen. Für die Bundesrichter enthält Art. 98 Abs. 1 und 2 GG die spezielleren Normen. Der Begriff der „Rechtsverhältnisse“ wird allgemein weit interpretiert – in dem Sinne, dass er sich unter anderem auf das Personalvertretungsrecht des Bundes erstreckt.[4]
2. Zu Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG
8
Der Sachkomplex der „Statusrechte und –pflichten“[5] umschließt denjenigen Teilbereich des Beamtenrechts, der durch die Typisierung des Beamtenverhältnisses als „öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis“ (Art. 33 Abs. 4 GG) und die institutionelle Garantie des Berufsbeamtentums mitsamt der sie prägenden „hergebrachten Grundsätze“ (Art. 33 Abs. 5 GG) bundeseinheitlich verbürgt ist und verbürgt bleiben soll.[6],[7]
a) Zur Regelung des Laufbahnrechts der Landesbeamten[8]
9
Die Länder müssen beachten, dass das Laufbahnprinzip[9] als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums nicht zu ihrer Disposition steht[10] und dass das gleichfalls verfassungsrechtlich durch Art. 33 Abs. 5 GG prinzipiell gesicherte Amt im statusrechtliche Sinne[11] nicht nur an die besoldungsrechtliche Einstufung, sondern auch an die Zugehörigkeit zu einer Laufbahn und Laufbahngruppe anknüpft.[12] Der Verzicht des Bundes auf eine rahmensetzende Regelung zum Laufbahnrecht der Landesbeamten hat erwartungsgemäß von Land zu Land zu mehr oder weniger stark differierenden Ausgestaltungen – etwa bei der Anerkennung von Laufbahnbefähigungen – geführt, die sich durchgängig durchaus nicht als mobilitätsfördernd erweisen (können) und die – wie es sich z.B. im Zusammenhang mit dem Fehlen einer zureichenden länderübergreifenden Harmonisierung bei Höchstaltersgrenzen für die Einstellung zeigt[13] – nicht immer einem fairen Procedere bei der Gewinnung geeigneten Nachwuchses zuträglich sind.
b) Zum Besoldungsrecht in den Ländern[14]
10
Die zwischenzeitlich eingetretene Entwicklung auf dem Besoldungssektor offenbart ein starkes Auseinanderdriften. Der Umfang des beträchtlichen Besoldungspartikularismus wird anschaulich, wenn man die Schwankungsbreite anhand der Besoldungsgruppen A 7, A 9 und A 13 betrachtet. Nach dem Besoldungsreport 2016 des DGB haben sich die dort erfassten Differenzen der durchschnittlichen Jahresbruttobesoldung zwischen Bayern mit dem höchsten und Berlin mit dem niedrigsten Jahresbetrag auf jeweils 3.975,22 €, 4.371,56 € bzw. 6.336,77 € belaufen. Wirtschaftlich schwache Länder hinken infolge der Föderalismusreform mithin hinter wirtschaftlich starken Ländern hinterher – unter anderem mit der Konsequenz eines Vorsprungs der „reicheren“ Länder bei den Bemühungen um qualifizierten Nachwuchs. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 25.5.2015 – BvL 17/09 –[15] wird die Spreizung der Besoldung in den Ländern im Kern kaum aufheben, sondern im Laufe der Zeit allenfalls mindern.[16]