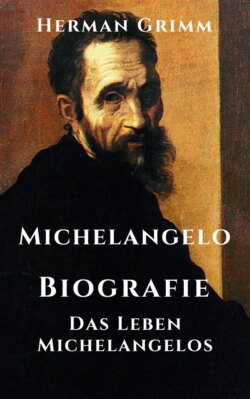Читать книгу Michelangelo - Biografie - Herman Grimm - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zweites Kapitel
ОглавлениеI
Nach denselben Gesetzen, nach denen in unserem Gedächtnisse das, was wir erlebten, feste Formen annimmt, bildet sich im Bewußtsein der Völker die eigene Geschichte und in dem der ganzen Menschheit das Gefühl vom Inhalte ihrer Vergangenheit. Es wäre als Resultat der vergleichenden Wissenschaft vielleicht natürlich, die Schöpfungsfrage ganz beiseite zu lassen und ein in unabsehbare Jahre rückwärts sich verlierendes Menschengewimmel anzunehmen, dessen Entstehung einstweilen nichts aufklärt. Das aber widerspricht noch dem allgemeinen Geiste. Die Leute verlangen zu hören, daß ein Paar geschaffen sei, plötzlich, durch einen Willensakt Gottes, daß von ihm die Völker abstammen, die heute noch leben. Je weiter wir zurückschauen, um so leerer und lichter erscheinen die Länder. Stärkere, schönere, einsamere Menschen wohnten in ihnen. Immer volkreicher werden dann die Erdteile und gewöhnlicher ihre Bewohner, immer seltener die großen Männer, und diese selbst geringer der Qualität nach. Endlich kommen wir so auf die eigene Zeit, die keine Helden mehr gebiert, wo der erbärmlichste Kerl, der lebt, ißt und trinkt, wie der edelste seinen eigenen Namen hat, dem er mit gemeinen Mitteln ein Echo aus den vier Enden der Welt verschaffen könnte.
Diese Betrachtung der Begebenheiten scheint dem Gefühle des Volkes zu entsprechen. Wir begegnen ihr überall. So erzählen wir und lassen uns erzählen; das Reine, Heroische liegt in der Vergangenheit, das Gemeine in der Gegenwart.
Allein es greift eine andere Ansicht von den Dingen um sich.
In der Zeit, in welcher ein Vulkan erkaltet und sich aus seinen erstarrten Lavaströmen ein waldbewachsenes Gebirge bildet, während der Krater nun ein stiller, tiefliegender See ist, sterben Generationen auf Generationen hin. Es bedurfte drei- bis viertausend Jahre etwa, um diese Umwandlung zu vollenden. Sie ist heute so deutlich zu erkennen, daß gar kein Zweifel darüber waltet, wie sie vollbracht worden sei. Solcher Langsamkeit gegenüber erscheinen die längsten Kriege der Menschen wie das rasche Wegflackern eines Reisigfeuers und das durch Jahrzehnte hingezogene Leiden eines Mannes kurz wie der augenblickliche Tod eines Käfers, dem man mit dem Fuße gelegentlich sein bißchen Leben austritt; die fernsten mythischen Zeiten der Geschichte liegen in ganz behaglicher, handgreiflicher Nähe vor uns. Es lebten damals Menschen wie heute, aßen, tranken, liebten und zankten sich. Man hat in den Seen der Schweiz Überbleibsel von Völkern entdeckt, deren Dasein all dem vorauszugehen scheint, was wir heute die Geschichte Europas nennen. Man fand halbverbranntes Korn, Scherben, Handwerkszeug und allerlei Knochenwerk. Es erscheint so wenig riesenhaft wie die Werkzeuge und Schädel der Indianer, die heute wahrscheinlich unter denselben Bedingungen leben, wie jene Leute getan, von denen wir nicht wissen, wohin sie gegangen sind.
Was sind wir mit unseren Maßen von Raum und Zeit? Was bedeutet die Erde, wenn wir sie als den einen Stern unter unzähligen anderen betrachten? Wie viel Revolution erlebte sie, ehe Menschen da waren, wie lange waren Menschen da, ehe sie sich der Vergangenheit zu erinnern anfingen? Die paar tausend Jahre, die wir mit dem Namen Geschichte bezeichnen, sind ein spannenlanger Abschnitt von einer Strecke, die nach Meilen gemessen werden könnte. Nicht mehr lange, und es wird die richtige Ansicht über diese Verhältnisse in das Volk dringen. Den Römern waren noch die Teile von Deutschland, welche jenseits der Elbe liegen, ebenso nebelverhüllte Märchenländer wie dem Mittelalter zur Zeit der Entdeckung von Amerika die Inseln des stillen Ozeans. Heute spricht der gemeine Mann von Südamerika, Australien und Japan und von den Epochen der Erdbildung. Unserem Gefühl von heute liegt die Zeit des Heroismus schon nicht mehr in der Vergangenheit, sondern wir erwarten sie als die schönste Frucht der Zukunft, wir steigen empor, nicht abwärts. Wir befinden uns in einer Krisis der Anschauungen. Wir blicken mit Geringschätzung hinter uns und erwarten neue Offenbarungen des Menschengeistes, größere Dinge, als sie die Welt jemals gesehen hat.
So gewiß die Bahnen der Gestirne ineinandergehen, daß jedes den Weg des anderen bedingt und mit seinen geringsten Eigentümlichkeiten sich fühlbar macht, so gewiß bilden die Menschen, welche leben, gelebt haben und leben werden, in sich ein ungeheures System, wo die kleinste Bewegung jedes einzelnen unmerklich meistens, aber dennoch bedingend auf den allgemeinen unaufhaltsamen Fortschritt einwirkt. Die Geschichte ist die Erzählung der Schwankungen, die im Großen eintreten, weil im einzelnen die Kräfte der Menschen ungleich sind. Unser Trieb, Geschichte zu studieren, ist die Sehnsucht, das Gesetz dieser Funktionen und der sie bedingenden Kraftverteilung zu erkennen, und indem sich hier unserem Blicke Strömungen sowohl als unbewegliche Stellen oder im Sturm gegeneinander brausende Wirbel zeigen, entdecken wir als die bewegende Kraft Männer, große, gewaltige Erscheinungen, die mit ungeheurer Einwirkung ihres Geistes die übrigen Millionen lenken, die, niedriger und dumpfer, sich ihnen hinzugeben gezwungen sind. Diese Männer sind die großen Männer der Geschichte, die Anhaltspunkte für den in den unendlichen Tatsachen herumtastenden Geist; wo sie erscheinen, werden die Zeiten licht und verständlich, wo sie fehlen, herrscht unverwüstliche Dunkelheit; und werden uns Massen sogenannter Tatsachen aus einer Epoche mitgeteilt, der große Männer mangeln, es sind lauter Dinge ohne Maß und Gewicht, die zusammengestellt, so bedeutenden Raum sie einnehmen, kein Ganzes bilden.
Es gibt ein allgemeines Gefühl über das, was groß ist. Die Menschheit hat es immer gewußt, es braucht nicht erklärt zu werden. Jedes Menschen Wert und Einfluß hängt davon ab, inwieweit er fähig ist, selber groß genannt zu werden oder sich denen anzuschließen, die es sind. Nur was unter diesem Gesichtspunkte sichtbar wird vom Menschen, bildet seine unvergängliche Persönlichkeit. Ein Herrscher, der mit eiserner Willenskraft Nationen in das Fahrgeleise seiner Launen hineinzwängt, wird spurlos vergessen werden; nachdem er eine Zeitlang als eine Art Affe der Vorsehung genannt worden ist, verschwindet der Begriff seiner Person, und der Name folgt ihr. Ein elender, dunkler Sterblicher, der den Zustand seines Volkes tief empfindend einen fruchtbaren Gedanken faßte und aussprach, dessen das Volk bedurfte, um einen Schritt vorwärts zu kommen, ist unsterblich in seiner Wirksamkeit. Und wenn sein Name vergessen werden sollte, man wird immer fühlen, an jener Stelle muß ein Mann gestanden haben, der eine Macht war.
So erweckt in uns das Studium der Geschichte nicht mehr Trauer über den Hingang schönerer Tage, sondern Gewißheit ihrer zukünftigen Erscheinung. Wir schreiten fort, wir wollen die kennen lernen, die zu allen Zeiten vorangingen. Das Studium der Geschichte ist die Betrachtung der Begebenheiten, wie sie sich zu den großen Männern verhalten. Diese bilden den Mittelpunkt, von dem aus das Gemälde konstruiert werden muß. Der Enthusiasmus für ihre Person verleiht die Fähigkeit, den richtigen Standpunkt ihnen gegenüber einzunehmen. Man will betrachten und anderen die Gabe der Betrachtung mitteilen. So meinte es Goethe, als er sagte der einzige Nutzen der Geschichte sei die Begeisterung.
Unsere Sehnsucht ist, die edelste Ansicht von der Menschheit zu gewinnen. Wenn wir die großen Männer anschauen, ist es, als sähen wir eine siegreiche Armee als die Blüte eines Volkes einherziehen. So hoch als im Momente eines solchen Triumphzuges auch der niedrigste Soldat des Heeres über allen Zuschauern steht, so erhaben über der unübersehbaren Masse der Sterblichen steht auch der geringste unter jenen, die wir große Männer nennen. Es schmückt sie alle derselbe Lorbeer. Eine höhere Gemeinschaft findet statt unter ihnen. Sie schieden sich ihrem irdischen Auftreten nach: jetzt stehen sie dicht beieinander, Sprache, Sitten, Stand und Jahrhunderte trennen sie nicht mehr. Sie reden alle eine einzige Sprache und wissen nichts von Adel oder Pariatum, und wer heute oder zukünftig wie sie denkt und handelt, steigt hinauf zu ihnen und wird in ihre Reihen aufgenommen.
II
Aus der Zahl der Bürger von Florenz sind drei als große Männer zu bezeichnen: Dante, Leonardo da Vinci und Michelangelo. Raffael stammte aus Urbino; doch darf er dazu gerechnet werden, weil er als Künstler für einen Florentiner gelten könnte. Dante und Michelangelo stehen am höchsten. Es ist nicht die Folge einseitiger Vorliebe, wenn dies Buch, das sich mit der Blüte der florentinischen Kunst beschäftigt, Michelangelos Namen an der Stirn trägt. Ein Leben Raffaels oder Leonardos würde doch nur ein Bruchstück von dem des Michelangelo bedeuten. Seine Kraft überbietet die ihre. Er allein beteiligt sich an der allgemeinen Arbeit des Volkes. Samt seinen Werken ragt er empor wie eine Erscheinung, die sich von allen Seiten der Betrachtung bietet, wie eine Statue, während jene beiden mehr wie prächtige Bildnisse erscheinen, die stets dasselbe lebendige Antlitz, aber auch stets von derselben Seite zeigen.
Das Gefühl, daß Michelangelo so hoch stehe, bildete sich früh bei seinen Lebzeiten in Italien nicht allein, sondern verbreitete sich über Europa. Es kommen deutsche Edelleute nach Rom: das erste, was sie verlangen, ist Michelangelo zu sehen. Auch daß er so alt wurde und in zwei Jahrhunderten lebte, ist ein Teil seiner Größe. Wie Goethe genoß er im Alter die Unsterblichkeit seiner Jugend. Er wurde zu einem Elemente in Italien. Wie ein alter Felsen, um den man einen Umweg macht im Meere, ohne sich mit Gedanken aufzuhalten, was er daliege und die gerade Straße versperre, respektierte man in Rom seine politische Festigkeit. Man gestattete ihm, seiner eigenen Überzeugung nach zu leben, und begehrte nichts als den Ruhm seiner Gegenwart. Er hinterließ ein weites Reich, das seinen Namen trug, jedes seiner Werke war ein Samenkorn, aus dem zahllose andere erwuchsen. In der Tat, zahllos sind die Arbeiten, die im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert nach dem Muster der seinigen ausgeführt wurden. Wie sich in Dantes Persönlichkeit das dreizehnte Jahrhundert und der Beginn des vierzehnten spiegelt, so umfaßt der Name Michelangelos jene folgenden, und weil zu derselben Zeit in Deutschland Luther, in ganz anderer Weise freilich und auf anderem Gebiete, einen ähnlichen allumfassenden Einfluß gewann, so bildet das Leben Michelangelos zu dem Luthers einen Gegensatz, der den Unterschied der Nationen darlegt, in deren Mitte die beiden Kräfte tätig waren.
Nach dieser Richtung hin ist Michelangelo kaum bekannt. Mehr instinktmäßig fühlte man nur, daß sein Name das Symbol einer umfassenden Tätigkeit sei. Der Zusammenhang seiner Schicksale mit denen seines Landes und dem Inhalte seiner Werke ist noch nicht in das allgemeine Bewußtsein übergegangen. In dieser Hinsicht glaubte ich, sei mit einer Beschreibung seines Lebens eine nützliche Arbeit zu versuchen.
Zwei ziemlich umfangreiche Biographien Michelangelos besitzen wir, beide von Künstlern verfaßt, welche sich seine Schüler nennen, beide zu seinen Lebzeiten gedruckt. Die eine von Ascanio Condivi, der in seinem Hause lebte, die andere von Giorgio Vasari, bekannt als Maler, Architekt und Kunstliterat am Hofe der florentinischen Herzöge. Von ihm erschien 1550 ein Buch, genannt Lebensbeschreibungen der ausgezeichnetsten Maler, Bildhauer und Baumeister. Michelangelos Leben bildet den Schluß des dritten und letzten Teiles.
Über Vasaris Charakter ist Meinungsverschiedenheit kaum möglich. Seine Tugenden und Fehler verstecken sich zu wenig. Er war Hofmaler, Hofagent in Kunstsachen, was er getan hat, tat er im Hinblick auf die Gunst seiner Herren und Gebieter, deren er mehrere erlebte. Von sich selbst redet er unbefangen wie von einem Meister, der mit dem allerersten in einer Linie steht. Michelangelos und anderer Künstler Fehler bespricht er in einem Tone, als wolle er andeuten, daß er aus der Erkenntnis dieser Irrtümer den nötigen Nutzen gezogen und sie vermieden habe. Er lobt seine eigenen Werke mit einer Bescheidenheit, für die er Anerkennung zu finden hofft, und redet von sich und seinem gesamten Wirken wie von einer höchst verehrungswürdigen dritten Person. Diejenigen, welche ihm opponieren oder ihm persönlich mißfallen, behandelt er ohne Umstände schlecht, etwa wie ein Theaterrezensent einen Schauspieler, dem er zeigen will, daß er eine Macht sei, die nicht mit sich spaßen lasse. In dieser Beziehung erlaubt sich Vasari das Ärgste. Er hat Künstler, die er nicht mochte, auf eine Weise verketzert, daß sie mit Mühe wieder zu Ehren gebracht werden mußten. Auf die Genauigkeit seiner Daten ist kein Verlaß. Er gibt falsche Jahreszahlen an und beschreibt Bilder zuweilen so, daß seine Worte nicht mit dem stimmen, was darauf zu sehen ist. Wo man seine Behauptungen mit sicheren Dokumenten vergleicht, findet man viele Irrtümer; wo man die Quellen, die er benutzte, noch besitzt und nachlesen kann, gewahrt man, daß er fortließ oder zusetzte, was ihm genehm war.
Dennoch ist sein Buch eine verdienstvolle, unentbehrliche Arbeit. Er kannte die Urkunden nicht, die uns heute zu Gebote stehen. Ihm und seinem Jahrhundert fehlte der Sinn für die kritische Schärfe, mit der heute gearbeitet wird. Sein Buch ist und bleibt für den Kunstfreund ein Schatz, dessen Reichtum unerschöpflich scheint. Sein Stil ist klar und gedrängt, seine Weltansicht eine heitere und vernünftige. Im ganzen sind die Verdienste Vasaris so groß, daß sie durch keinen Tadel aufzuwiegen wären.
Gerade seinen tadelnswerten Eigenschaften aber verdanken wir es, daß wir über Michelangelo so gut unterrichtet sind. Vasari sandte sein Buch, als es fertig gedruckt war, dem alten Meister zu, der ihm darauf mit einem Sonette antwortete, in welchem die verbindlichsten Dinge gesagt sind. Eine andere Antwort jedoch, entgegengesetzten Inhalts, lag in dem Erscheinen der Condivischen Arbeit. Condivi lebte in seines Meisters unmittelbarer Nähe. Vasari, obgleich er es anders darstellen möchte, stand Michelangelo fern, dessen schmeichelhafte Briefe mehr dem Hofagenten als dem Künstler gelten. Wie fern in Wahrheit Vasari dem großen Manne stand, zeigt nichts so sehr als sein Buch, denn man kann sich nichts Flüchtigeres, Falscheres und Liederliches denken als diese Biographie in ihrer ersten Gestalt. Wichtige Ereignisse übergeht er, stellt die Tatsachen falsch an sich und in falscher Ordnung dar, weiß besonders in Betreff der Jugendzeit gar nichts oder hilft sich in Ermangelung inhaltreicher Wahrheit oft mit leeren lobenden Redensarten.
Offenbar wollte Michelangelo die Welt eines Besseren belehren, ohne Vasari wehe zu tun. Deshalb durfte Condivi in seiner Vorrede diesen nicht einmal bei Namen nennen, wo Vasari indirekt bezeichnet wird, weil dies nicht zu umgehen war, bedient Condivi sich des Pluralismus und spricht von mehreren unbestimmten Leuten, denen er Vorwürfe macht.
»Von der Stunde an«, lautet Condivis Vorrede, »in der ich durch Gottes besondere Güte würdig erachtet worden bin, über alle meine Hoffnung hinaus den einzigen Maler und Bildhauer Michelangelo Buonarroti nicht nur von Angesicht zu Angesicht zu erblicken, sondern auch seiner Zuneigung, seines täglichen Gespräches und Zusammenlebens teilhaftig zu werden, begann ich, im Gefühl, wie groß dieses Glück sei, und in der Begeisterung für meine Kunst und für die Güte, mit der er mich behandelte, seine Regeln und Vorschriften genau zu beobachten und zu sammeln. Was er sagte, was er tat, wie er lebte, alles mit einem Worte, was mir der Bewunderung, der Nacheiferung oder des Lobes wert schien, zeichnete ich auf und beabsichtigte es zu gelegener Zeit in einem Buche zusammenzustellen. Ich wünschte ihm damit für das, was er an mir getan hat, zu danken, so viel es in meinen Kräften läge; auch hoffte ich anderen durch meine Aufzeichnungen, in denen das Leben eines solchen Mannes als leuchtendes Beispiel aufgestellt wurde, Freude zu machen und ihnen nützlich zu sein, denn jedermann weiß, wie sehr unser Zeitalter und das zukünftige ihm für den Ruhm verpflichtet sind, der durch seine Werke über sie ausgebreitet wurde. Um zu fühlen, was er getan hat, braucht man es nur mit dem vergleichen, was andere taten.
Während ich so in meine Vorratskammern still einsammelte, deren eine für die äußeren Lebensumstände, die andere für die Kunstwerke bestimmt war, und in beiden der Stoff anwuchs, wurde ich in unvorhergesehener Weise dazu gezwungen, meine Arbeit nicht nur zu beschleunigen, sondern was die Lebensbeschreibung anbetrifft, sie sogar zu überstürzen. Es haben nämlich einige andere über diesen seltenen Mann geschrieben und, weil sie ihm, wie ich glaube, nicht so nahe standen als ich, einmal Dinge behauptet, die rein aus der Luft gegriffen sind, zweitens aber wichtige Umstände ganz ausgelassen. Außerdem aber haben andere, denen ich meine Arbeiten im Vertrauen mitgeteilt hatte, sich dieselben auf eine Weise angeeignet, aus der leider die Absicht hervorzugehen scheint, mir nicht nur die Früchte meiner Mühe, sondern auch die Ehre davon vorwegzunehmen. Um deshalb der Mangelhaftigkeit jener erstgenannten Autoren zu Hilfe zu kommen, andererseits aber dem Unrecht vorzubeugen, das mir von den letzteren bevorsteht, entschloß ich mich, meine Schrift unfertig, wie sie war, herauszugeben.«
Hierauf folgen Entschuldigungen des mangelhaften Stils wegen, er sei ein Bildhauer und kein Schriftsteller von Profession. Endlich das Versprechen, daß ein genauer Katalog der Werke Michelangelos nachfolgen werde. Leider ist davon keine Spur zu finden. Nicht einmal die Nachricht, ob er in der Tat geschrieben oder gedruckt worden sei. Die »einigen« und die »anderen«, von denen er spricht, scheinen nur den einzigen Vasari zu bedeuten.
Condivis Buch wurde dem Papste gewidmet, der es huldvoll entgegennahm und dem Autor persönlich dafür dankte. Michelangelo hat das wohl vermittelt. Vasari ließ die Sache beruhen, aber nach Michelangelos Tode rächte er sich auf seine Weise.
Er gab eine neue Bearbeitung seiner Lebensbeschreibungen heraus und nahm in dieselbe Condivis Arbeit ihrem ganzen Umfange nach auf, oft wörtlich, oft mit absichtlich anders gestellten Worten. Dabei verfuhr er jedoch wieder so nachlässig, daß er sich nicht einmal die Mühe nimmt, die zu seiner ersten Ausgabe befindlichen falschen Angaben zu verbessern, sondern er verflicht diese grobweg in diejenigen Condivis, so daß er doppelte Nachrichten bringt, die falschen neben den richtigen, was in den Köpfen seiner späteren Herausgeber dann weitere Verwirrung zur Folge hatte. Condivis Namen nennt er nicht, deutet dagegen auf das erkenntlichste an, er sei ein Lügner und unzuverlässiger Mensch, während er selber niemals etwas anderes als die lauterste Wahrheit geschrieben habe. Niemand, sagt er, besäße so viel und so schmeichelhafte Briefe von Michelangelos eigener Hand und hätte ihm so nahe gestanden. Freilich, heißt es am Schluß seiner Lebensbeschreibung, Michelangelo hatte Unglück mit denen, die täglich um ihn gewesen sind. Und nachdem er noch einmal hier auf seine eigene Bescheidenheit zurückgekommen, erwähnt er jetzt Condivi als einen Schüler Michelangelos. Von seiner Schriftstellerei keine Silbe, nur daß er nichts vor sich gebracht habe, daß der Meister ihm zu Hilfe gekommen sei, aber auch das ohne Frucht, daß Michelangelo sich sogar gegen ihn selbst, gegen Vasari nämlich, mit Bedauern über die vergeblichen Anstrengungen des armen Teufels ausgesprochen hätte.
Damit jedoch begnügte er sich noch nicht. Er versucht Condivis einfache Nachrichten womöglich zu überbieten. Er weiß jetzt die Dinge, die vor Condivis Buch niemand kannte, viel besser als der selbst, von dem er sie abschreibt. Ob er bei seinem Wunsche, Condivi zu übertreffen, jedoch stets nur von der eigenen Phantasie belehrt wurde, ist eine Frage, die offen bleibt. Vasari liebt es allerdings, die Begebenheiten abzurunden und durch eigene kleine Zwischengedanken in lebendigere Verbindung zu bringen: Vieles mag so entstanden sein, in manchen Fällen gelang es ihm aber wohl in der Tat, Neues herbeizuschaffen und auf der von Condivi gegebenen Grundlage solide weiterzubauen.
Jedenfalls erreichte er seinen Zweck. Er hatte seines Nebenbuhlers Arbeit ganz und gar in die eigene aufgenommen und sie als ein besonderes Buch überflüssig gemacht. Er war der berühmte Vasari. Condivis Buch geriet in solche Vergessenheit, daß im Jahre 1746, in dem man es zuerst wieder abdruckte, kaum ein Exemplar aufzutreiben war.
Wie wenig ehrenvoll nun auch die Ursachen sind, aus denen wir Vasaris zweite Arbeit in so verbesserter, ausführlicher Gestalt besitzen, und wie traurig das Schicksal Condivis, dessen Ende zugleich ein tragisches war (er ist ertrunken ohne für die Unsterblichkeit seines Künstlernamens vorher Sorge tragen zu können): beide Arbeiten gewährten eine große Ausbeute. Zu ihnen kamen Briefe, die Michelangelo selbst geschrieben hat, zahlreiche Gedichte von seiner Hand, Tagebuchnotizen, Kontrakte und verschiedenartige Aktenstücke, welche auf ihn bezüglich sind. Johann Gaye, ein Schleswig-Holsteiner, der in Berlin studierte und dann nach Italien ging, hat sich hier die größten Verdienste erworben. Er durchforschte die überfüllten Archive von Florenz, und andere sind auf seiner Fährte weiter gegangen. Gaye vollendete sein Werk nicht, er starb 1840, Herr von Reumont hat den dritten Teil des Buches herausgegeben. Die genannte letzte Florentiner Ausgabe des Vasari bot eine vortreffliche Zusammenstellung des bis auf die letzte Zeit bekannt gewordenen Materials, während die ein Jahrhundert ältere Ausgabe Condivis gleichfalls mit guten Noten verschiedener Autoren versehen ist. Mr. Harfords Life of Michelangelo enthielt einiges, was nicht bekannt war.
Im höchsten Grade umfangreich sind die Quellen, aus welchen die Geschichte der Zeiten geschöpft wird, von denen wir Michelangelo getragen sehen. Über keine Epoche der neueren Geschichte haben Zeitgenossen so kraftvoll und so schön berichtet; ihre Darstellung allein läßt oftmals Begebenheiten groß und wichtig erscheinen, die, von geringerer Feder aufgezeichnet, kaum die Aufmerksamkeit zu locken vermochten.
Voran die Werke Machiavellis. Mit einer unparteiischen Klarheit, die so groß ist, daß man mitten in ihrer Anerkennung an ihr zweifeln möchte, eben weil sie beinahe zu weit getrieben wird, gibt er von den leisesten Zuckungen der Zeiten Rechenschaft, die er mit durchmachte. Seine Sprache schreibend wie die besten antiken Autoren die ihrige, vertraut mit den politischen Ideen des Jahrhunderts, gewährt er den Grundton aller Anschauung. Um wenige Jahre älter als Michelangelo (er wurde 1469 geboren, drei Jahrhunderte vor Napoleon und Humboldt), starb er, als Michelangelo noch nicht zwei Drittel seines Weges zurückgelegt hatte. Stände sein persönliches Leben im Einklang mit der Höhe seines Geistes, so würde er der größte Mann seiner Zeit heißen neben Michelangelo, aber es wird gesagt werden, warum ihm von diesem Ruhme ein geringerer Anteil zukommt.
Nach ihm Guicciardini, kräftiger und gewaltsamer als Charakter, aber geringer in der Darstellung, ein Mann, der nicht wie er in untergeordneter Stellung oder in unfreiwilliger Muße Nebenstunden zum Nachdenken und Studieren fand, sondern von früh auf bis zum Schlusse seines Lebens hohe Posten bekleidete. Er kannte vielleicht mehr Menschen und Verhältnisse als Machiavelli, griff sicherlich hundertmal selbst gestaltend ein, wo dieser nur betrachtend dabei stand; aber er beobachtete oberflächlicher und durchschaute die Charaktere nicht mit dessen Blicken, die sich wie Scheidewasser über die Dinge gossen. Während Machiavelli höhere Gesetze als die Treibräder des Geschehenden erkennt, leitet Guicciardini die Verwickelung der Begebenheiten aus den bösen Leidenschaften der Menschen her. Er kannte ihre Macht und hatte sie in sich selbst erprobt. Auch er starb vor Michelangelo. Sein gewaltsamer Tod war die Frucht seines eigenen falsch berechnenden Ehrgeizes.
Dagegen Giovio, römischer hoher Geistlicher, aufgewachsen als Schmeichler an den Höfen der Päpste und eingestehend, daß er für Geld den Dingen einen Mantel umhänge. Aber in schöne Falten weiß er ihn zu legen, und in alle Intrigen eingeweiht, enthüllt er die Situation der politischen Verhältnisse. Wir besitzen von ihm als geringe Nebenstücke seiner weitschichtigen historischen Schriften ein paar kurze Lebensbeschreibungen Raffaels und Michelangelos, lateinisch abgefaßt und wertvoll, obgleich Giovio kein Freund Michelangelos war.
Dann Bembo, im Alter Kardinal, in der Jugend geistlicher Aventurier und Geliebter der Lucrezia Borgia, einer der vielen, die sich ihrer Gunst erfreuten, höher stehend als Giovio, aber doch aus gleichem Holze geschnitzt. Seine Briefe, in vielen Bänden zusammengedruckt, ein Abbild der Denkungsart der höheren Kreise und ein Muster jener späteren eleganten Prosa, die schmeichlerisch, inhaltslos, dem Auge und Ohr behagliche Worte bietet und ihre Kälte durch Beteuerungen verdeckt. Wie Giovio schmiegte er sich durch die hohen Herren hindurch, bis aus ihrem Diener ihr Vertrauter, ihr Freund und endlich ihresgleichen wurde.
Nardi dagegen, ein Florentiner Demokrat, aus bester Familie, in der Verbannung die Geschichte seiner Vaterstadt schreibend. Mild, diskret, ohne voreiliges Urteil, aber leidenschaftlich gegen die Feinde der Freiheit, deren Verlust ihm so teuer zu stehen kam. Er berichtet für Florentiner, die, wie er, mitten in der Politik der Stadt lebend, von vornherein mit den Verhältnissen der Stadt bekannt sind.
Nerli dagegen ist darüber hinaus, daß die Freiheit vernichtet wurde. Der Vorwurf lastet auf ihm, als Spion über die Pläne der vertriebenen Verteidiger der alten Unabhängigkeit nach Florenz berichtet zu haben. Die geruhige Ordnung unter der neuen Herrschaft ist ihm der richtige und erwünschte Zustand, von dem er ausgeht. Aufruhr und Revolution sind an sich gebrandmarkt, doch erkennt er die Freiheit an für die Vergangenheit. Ihm und anderen seiner Zeit kam es zugute, daß die Herzöge einer Linie der Medici angehörten, die von dem anderen Zweige der Familie, aus dem die beiden Päpste und die Unterdrücker der Freiheit stammten, unterdrückt und mißhandelt worden waren. Somit erschien es weniger unerlaubt, von diesen Leuten ohne Rücksicht zu reden und sich dadurch auf die Seite der alten Freiheit zu stellen, die ja doch nie wiederkehrte.
Die letzten Kämpfe um diese Freiheit schildert Segni in einem Buche, dessen Existenz niemand ahnte in den Zeiten, wo es verfaßt wurde. Er schreibt frei, genau und gebildet, aber nicht so anschaulich und energisch als Nardi und Guicciardini.
Auch Varchis Buch blieb ungedruckt, obgleich im Auftrage des Großherzogs selber angefertigt. Die Erlaubnis zur Herausgabe wurde nicht erteilt. Varchi ist schon ein Genosse Vasaris, erster Literat der Residenz und obenaufschwimmend im Florentiner Leben, das sich an die neue Dynastie gewöhnt hatte. Varchi hielt Michelangelos Leichenrede. Er redet auch von der alten Unabhängigkeit mit Begeisterung und beweint ihren Untergang, aber es sind die Tränen eines Historikers, und so hochtönend er vom alten, freien Florenz spricht, bleibt doch das neue Florenz, in dem er sich selber so wohl befindet, aus dem Spiele. Über die Zeiten um 1530 hat er gesammelt, was nur zusammenzuscharren war, aber den Stoff in seinen Geist aufzunehmen und aus sich selbst heraus zu gestalten, verstand er nicht.
Wie wenig er sich erlauben durfte, das ihm zu Gebote stehende Material nach Belieben auszunutzen, zeigen die Briefe Businis an ihn, der, in der Verbannung in Rom lebend, durch Varchi veranlaßt, seinen Erinnerungen aus den Jahren 1527-31 in vertraulichen Briefen freien Lauf läßt. Sie sind der eigentümlichste, unbekümmertste Ausdruck des florentinischen Geistes. Mit beißender Heftigkeit schwatzt er über die Ereignisse und Menschen. Ein Demokrat, von guter Familie, stolz, aber mit der Ruhe endlich errungener Gleichgültigkeit, weil doch schon so viele Jahre darüber hingegangen sind, gab sich Busini in Rom jener ironischen Apathie gegen die politischen Ereignisse hin, der auch Michelangelo in den letzten Jahren seine Hoffnungen zum Opfer brachte. Die Zeiten schienen damals für immer vorüber zu sein, in denen sich freie Bürger an den Schicksalen des Vaterlandes eingreifend beteiligen durften.
Neben diesen, eine stets individuelle, oft parteiliche Ansieht vertretenden Schriften die Berichte der venezianischen Gesandten, geschäftsmäßig, leidenschaftslos und nur unter dem Gesichtspunkte der Nützlichkeit für die Republik von San Marco abgefaßt.
Dann zwei Äußerungen menschlichen Geistes, deren Gegensatz nicht größer gedacht werden kann, die Schriften und Predigten Savonarolas und die Tagebücher des Burcardo und des Paris bei Grassi, beides päpstliche Zeremonienmeister. Dort die Blüte religiöser Begeisterung, hier die Fragen des Zeremoniells und die geheimsten Erlebnisse des Vatikan. Dort hinreißende, heroische Beredsamkeit einer Natur, die in Sprüngen einer gewaltsamen Katastrophe entgegeneilt, hier nur ein Auge auf starre Äußerlichkeiten, in deren eifersüchtige Beobachtung die Seele langsam hineinversteinert.
Dazu endlich eine Reihe trocken aufzeichnender Chroniken und Urkunden und die Massen von Büchern aller Art, die überhaupt damals gedruckt worden sind. Alle enthalten etwas. Unmöglich, diese Quelle zu erschöpfen. Man muß sich begnügen, das genau zu kennen, was von denjenigen Augenzeugen herrührt, deren Geist sich als ein hervorragender erkennbar macht.
Dies waren die Hilfsmittel, mit denen ich Michelangelos Leben zu schreiben begann. Man wußte, daß das Archiv der Familie Buonarroti zahlreiche Briefe und Dokumente jeder Art enthielt, aber zugleich war bekannt, daß es unmöglich sei, diese Papiere zur Einsicht zu erhalten. Da, im Jahre 1800, starb der letzte Buonarroti. Er vermachte sein Archiv der Stadt Florenz. Eine Kommission veröffentlichte ein Verzeichnis der vorhandenen Papiere. Es war eine natürliche Voraussetzung, daß sie nun der Benutzung offen ständen; jetzt aber eine neue Unmöglichkeit: der Graf Buonarroti hatte die Annahme seines Vermächtnisses von der Verpflichtung abhängig gemacht, das Geheimnis nach wie vor zu wahren und niemand das Geringste mitzuteilen, und so schien es, daß bei bewandten Umständen überhaupt unmöglich sei, die Arbeit fortzusetzen.
Durch einen glücklichen Zufall jedoch war nicht der gesamte Inhalt des Buonarrotischen Nachlasses zu dieser Abgeschlossenheit verurteilt worden. Ein Teil der Erbschaft kam durch Ankauf in den Besitz des britischen Museums. Hier natürlich stand der Benutzung kein Hindernis entgegen, und ich gelangte zur Kenntnis dreier umfangreicher Briefwechsel sowie einer Anzahl anderer Dokumente, alles in der sorgfältigen, malenden Handschrift Michelangelos so deutlich vorliegend, daß sich die Seiten wie die eines gedruckten Buches glatt herunterlasen.
Hundertundfünfzig Briefe wurden mir so zugänglich. Mit ihnen habe ich mich von der zweiten bis zur vierten Auflage meines Buches begnügen müssen. Endlich sind zur vierhundertjährigen Geburtstagsfeier Michelangelos auch die größere Anzahl der Florentiner Briefe gedruckt worden. Mit denen, welche das Britische Museum besitzt, zu einem stattlichen Bande vereinigt, lagen sie nun sämtlich vor. Was diese Briefe jedoch im allgemeinen anlangt, darf ich eine Beobachtung nicht verschweigen, die sich in dem Maße mehr bestätigt hat, als die anfangs so große Enthüllungen versprechenden Papiere schrittweise ans Tageslicht gebracht wurden.
Je mehr ich in meinen Studien für die Lebensbeschreibung Michelangelos fortgeschritten war, um so zahlreichere Fäden hatte ich entdeckt, die von diesem Manne nach allen Seiten hin ausliefen oder die, von den Erscheinungen seiner Zeit ausgehend, sich in ihm vereinigten. Nicht daß sein unmittelbarer Einfluß hervorgetreten wäre, aber der Zusammenhang seiner Fortentwicklung mit dem, was um ihn her geschah, zeigte sich. Immer deutlicher empfand ich die Nötigung, alles, was während seines Lebens sich ereignete, kennenzulernen, um ihm selbst näher zu kommen. Es ist mir vorgeworfen worden, daß ich mein Buch das »Leben Michelangelos« genannt, während ich es »Michelangelo und seine Zeit« hätte nennen sollen. Aber diese beiden sind eins mit ihm: er und die Ereignisse, die er erlebte. Je erhabener der Geist eines Mannes ist, je mehr erweitert sich der Umkreis, den seine Blicke berühren, und was sie berühren, wird ein Teil seines Daseins. Und so, je weiter ich vorwärts kam, um so unvollkommener erschien mir meine Bekanntschaft mit den Dingen, die ich betrachtete. Denn wo ich sie von einer Seite endlich erfassen lernte, ward mir zugleich klar, von wie viel andern ich sie weiter zu erfassen hätte, um ein in Wahrheit unbefangenes Urteil zu bilden.
Man sollte nun denken, es habe durch die Fülle der aus Michelangelos Briefen uns zufließenden Kenntnis seiner intimsten Gedanken und innersten Privatverhältnisse diesem Gefühle, im Grunde nur wenig von ihm zu wissen, ein Ende gemacht werden müssen. Allein im Gegenteil, die Aufklärungen, welche wir so empfangen, beirren uns oft viel mehr, als sie uns belehren. Wir wissen jetzt Dinge, von denen bei Michelangelos Lebzeiten niemand wußte, ja die er selber, als er Condivi von sich erzählte, vergessen hatte. Und doch kannten ihn die besser, die mit ihm lebten, ohne jemals in diese Besonderheiten eingeweiht zu sein. Es geht uns ähnlich mit Goethe. Wir können heute bei vielen seiner Arbeiten fast Tag und Stunde angeben, wann er sie zuerst niederschrieb, liegen ließ, wieder aufnahm und vollendete. Wir sind darüber, wenn wir den Inhalt vieler Briefe mit der von ihm selbst verfaßten eigenen Lebensbeschreibung vergleichen, besser unterrichtet als er selbst. Was aber nützt es? Würden alle Notizen über die Entstehung der Iphigenie ein Dutzend Verse aufwiegen, die wir dafür in dem Gedichte entbehren sollten? Ein Künstler führt als Schöpfer seiner Werke ein höheres Dasein als seine niederen irdischen Schicksale uns zeigen; in einer geheimnisvollen Atmosphäre entstehen diese Erzeugnisse des Geistes, zu der wir nicht emporsteigen. Jene Resultate unseres Nachspürens zu Sprossen einer Leiter dahin verarbeiten zu wollen, wäre ein vergebliches Unternehmen. Und so, wenn es bei einem Manne wie Goethe, der kaum gegangen ist, der die Luft beinahe noch atmete, in der wir leben, und von dem wir zehn Briefe aufzuweisen imstande wären, wo von Michelangelo einer vorhanden ist, wenn es bei Goethe doch am Ende nicht auf die Briefe, sondern auf die Erkenntnis der Zeit und die Tiefe des Verständnisses für seine Dichtungen ankommt, um zu fühlen, was er gewesen, so ist dies in noch höherem Grade bei Michelangelo der Fall, dessen Handwerk das Schreiben nicht war, der meistens in seinen Briefen die Person berechnet, an die er sie richtet, und selten sein Herz zeigt wie in seinen Werken, seinen Taten oder auch seinen Gedichten. Von der Strömung der Zeit, von der Trauer um das, was ihm mißlungen, der Hoffnung auf die Zukunft, enthalten die Briefe wenig. Einzelne Seiten seines Charakters zeigen sie in ihrer ganzen Schärfe, wo man früher nur ahnte, daß es so wäre, aber auch hier meistens nicht bei Ereignissen, die bedeutend sind. Seine Briefe geben viel, sie sind, sobald man sie einmal kennt, ein Teil von ihm, der sich von nun an nicht entbehren ließe, aber besäßen wir nichts als seine Arbeiten, die Biographie Condivis und die Geschichte von Florenz und Rom: aus dem Marmor, den diese liefern, ließe sich die Gestalt des Mannes heraushauen, wie er war, und was dazu kommt, hilft das Bildnis nur glätten und feiner ausarbeiten, ohne daß der ersten Anlage nach eine Falte anders gelegt zu werden brauchte.
Unter diesen Umständen erwecken auch die Papiere, welche immer noch unpubliziert in Florenz liegen, die Neugierde nicht mehr, mit welcher früher Michelangelos Briefe erwartet wurden. Über tausend Nummern an ihn gerichteter Schreiben sollen noch vorhanden sein. Was sie ohne Zweifel gewähren werden, ist genauere Datierung der Werke und der laufenden Arbeit daran sowie Aufschlüsse über allerlei Verhältnisse Michelangelos, von denen wir heute wenig oder nichts wissen. Allein vielleicht dürfte auch hier eintreten, daß man einmal mit noch größerer Beflissenheit, als man zuerst nach diesen Mitteilungen verlangte, sie in der Folge wieder zu beseitigen suchen wird, weil sie die einfachen Linien der Persönlichkeit wie wucherische Schlinggewächse eher verhüllten als klarer werden lassen.
Für die eigenen Arbeiten war den Florentiner Gelehrten die Benutzung dieses Materials natürlicherweise gestattet worden, und daraufhin muß Aurelio Gottis 1876 erschienenem Leben Michelangelos bedeutender Wert zugeschrieben werden. Vieles fand ich hier gedruckt, was meinen Blicken sonst entzogen geblieben wäre. Gottis Buch sticht durch diese wertvollen Eigenschaften unter der Masse anderer Publikationen hervor, welche zur Feier des vierhundertjährigen Geburtsfestes Michelangelos in Italien, in Frankreich und bei uns erschienen sind.
III
Im Jahre 1250 soll Simone Canossa, der Stammvater der Buonarroti, als Fremder nach Florenz gekommen sein und sich durch ausgezeichnete, der Stadt geleistete Dienste das Bürgerrecht erworben haben. Aus einem Ghibellinen sei er ein Guelfe geworden und habe deshalb sein Wappen, einen weißen Hund mit einem Knochen im Maule in rotem Felde, in einen goldenen Hund in himmelblauem Felde verändert. Dazu seien ihm von der Signorie noch fünf rote Lilien und ein Helm mit zwei Stierhörnern, eins golden, eins himmelblau, verliehen worden. So Condivi.
In den Adern der Simoni aber, die von den Grafen Canossa abstammten, flösse kaiserliches Blut, schreibt er weiter. Beatrice, die Schwester Kaiser Heinrich des Zweiten, sei die Stammutter der Familie, das eben beschriebene Wappen im Palaste des Podesta von Florenz noch zu sehen, wo Simone Canossa es gleich dem anderer Podestas habe in Marmor aushauen lassen. Der Familienname Buonarroti stamme daher, daß er als Vorname in der Familie herkömmlich gewesen sei; einer müsse ihn immer als einzigen Taufnamen führen. So sei er ein Kennzeichen des Geschlechtes geworden und habe sich endlich statt des Namens Canossa in die Bürgerrolle eingeschlichen.
Wir können annehmen, daß Condivi diese Mitteilungen von seinem alten Meister erhielt und daß dieser somit an das kaiserliche Blut in seinen Adern glaubte. Die Buonarroti hielten fest an dieser Tradition. Florentinische Geschichtsforscher haben indessen keinen Simone Canossa, der 1250 Podesta der Stadt gewesen wäre, zu entdecken vermocht. Auch in den Familiennachrichten des Grafen von Canossa wird dieser Persönlichkeit nicht erwähnt. Noch weniger stimmt das Wappen der Canossa mit dem, das Condivi beschreibt, oder das der Buonarroti selber damit. Dieses bestand aus zwei goldenen Querbalken im himmelblauen Felde, keine Spur von dem goldenen Hunde mit einem Knochen im Maul.
Der Hund führt vielleicht auf die Fährte einer Erklärung, wie die Fabel entstand. Das Mittelalter hatte seine eigene Art, die Worte symbolisch zu erklären. Der Hund canis, mit dein Knochen os im Maule, os wird auf demselben Wege zu »Canossa« wie die Dominikaner zu den »Hunden des Herrn«, domini canes, wurden. wichtiger indessen als die genaue Erklärung des Märchens ist der Umstand, daß der alte bürgerliche Michelangelo, dieser Erzguelfe, seine Biographie trotz alledem mit einer Erklärung beginnen läßt, durch die er sich seiner Abstammung von dem alten ghibellinischen höchsten Adel rühmt, und daß, wie ein noch vorhandener Brief eines Canossa aus dem Jahre 1520 beweist, die gräfliche Familie die Verwandtschaft anerkannte. Graf Alexander von Canossa tituliert Michelangelo in Anrede wie Adresse als seinen geehrten Vetter, Parente onorato, lädt ihn zu sich ein, bittet ihn, das Haus seiner Familie als sein Eigentum zu betrachten und geht so weit, ihn Michelangelo Buonarroti da Canossa zu titulieren.
Die Buonarroti, oder, wie sie sich schrieben, die Buonarroti Simoni, waren eines der angesehensten florentinischen Geschlechter. Ihr Name findet sich oft mit Staatsämtern verbunden. 1456 saß Michelangelos Großvater in der Signorie, 1473 sein Vater im Collegium der Buonuomini, einer aus zwölf Bürgern bestehenden Kommission, welche der Signorie beratend beigestellt war. 1474 wurde er zum Podesta von Chiusi und Caprese ernannt, zweier Städtchen mit Kastellen im Tale der Singarna gelegen, eines kleinen Gewässers, das sich in die Tiber ergießt.
Die Tiber entspringt in dieser Gegen und ist selber noch ein unbedeutender Fluß, wenn sie sich mit der Singarna vereinigt. Das Land ist gebirgig.
Michelangelos Vater, Lodovico mit Namen, begab sich von Florenz auf seinen Posten. Seine Frau, Francesca, gleichfalls aus guter Familie, war gerade hochschwanger, was sie nicht hinderte, ihren Mann zu Pferde zu begleiten. Dieser Ritt hätte ihr und dem Kinde gefährlich werden können, sie stürzte mit dem Tiere und wurde ein Stück fortgeschleift. Dennoch schadete es ihr nicht, am 6. März 1475 um 2 Uhr nach Mitternacht brachte sie zu Caprese einen Knaben zur Welt, der den Namen Michelangelo erzielt. Er war das zweite Kind seiner Mutter, welche bei seiner Geburt neunzehn Jahre zählte, während Lodovico im einunddreißigsten stand. Lodovicos Vater lebte nicht mehr, wohl aber seine Mutter, Mona Lesandra (soviel als Madonna Allessandra), eine Frau von sechsundsechzig Jahren.
1476, nach Ablauf seiner Amtsführung, kehrte Lodovico nach Hause zurück. Der kleine Michelangelo wurde drei Miglien von Florenz in Settignano zurückgelassen, wo die Buonarroti eine Besitzung hatten. Man tat das Kind zu einer Amme, der Frau eines Steinmetzen. Settignano liegt mitten im Gebirge; Michelangelo pflegte später scherzend zu sagen, es sei kein Wunder, daß er solche Liebe zu seinem Handwerk hege, er habe es mit der Milch eingesogen. In dem Orte zeigte man im vorigen Jahrhundert noch die ersten Malereien des Knaben an den Wänden des Hauses, in dem er aufwuchs, wie im Erdgeschoß des elterlichen Hauses zu Florenz die Fortsetzung dieser Bestrebungen zu erblicken war. Er fing an zu zeichnen, sobald er seine Hände gebrauchen konnte.
Die Familie vermehrte sich. Die Geschwister Michelangelos sollten Kaufleute werden, die gewöhnliche und natürliche Laufbahn in Florenz, er selbst aber wurde zum Gelehrten bestimmt und von Meister Franceso aus Urbino, der die florentinische Jugend in der Grammatik unterrichtete, in die Schule genommen. Hier aber profitierte er nicht viel. Er verwandte alle seine Zeit auf das Zeichnen und trieb sich in den Werkstätten der Maler umher.
Auf diesen Wegen lernte er Francesco Granacci kennen, einen schönen talentvollen Knaben, der, fünf Jahre älter als er, sein innigster Freund wurde. Granacci war bei Domenico Ghirlandaio oder, florentinisch gesagt, Grillandaio in der Lehre. Michelangelo ließ sich nicht mehr bei seinen Studien halten, er hatte nur die Malerei im Kopfe. Sein Vater und dessen Brüder, stolze Männer, die den Unterschied der Kaufmannschaft und der Malerei, die als ein in ihren Augen wenig angesehenes Handwerk geringe Aussichten bot, wohl zu würdigen wußten, machten Vorstellungen, aus denen allmählich Schläge wurden. Michelangelo blieb standhaft. Am 1. April 1488 unterzeichnete Lodovico den Kontrakt, kraft dessen sein Sohn zu den Meistern Domenico und David Grillandaii auf drei Jahre in die Lehre gegeben ward. Während dieser Zeit sollte er Zeichnen und Malen lernen und übrigens tun, was ihm geheißen würde. Von Lehrgeld war keine Rede, im Gegenteil verpflichteten sich die Meister, ihm im ersten Jahre sechs, im zweiten acht, im dritten zehn Goldgulden zu bezahlen. Michelangelo war vierzehn Jahre alt, als er so zum ersten Male seinen Willen durchgesetzt hatte.
Seltsam ist zu bemerken, daß, wenn Michelangelo in früher Jugend so darauf bestand, als Malerlehrling einzutreten, der Hochmut, mit dem seine Familie die Sache aufnahm, in hohem Alter auch bei ihm zum Durchbruche kam. In seinen Briefen unterzeichnete er sich so lange er jung war mit »Michelangelo der Bildhauer«, später jedoch, als alter Mann, nahm er übel, wenn so auf seinen Briefen stand. Bei seinem Neffen beklagte er sich dann, daß von einem Florentiner so an ihn adressiert worden sei: nicht Michelagnolo der Bildhauer, sondern Michelangelo Buonarroti laute der Name, unter dem er in Rom bekannt sei. Niemals habe er als Maler oder Bildhauer offene Werkstatt gehalten, sondern immer die Ehre seines Vaters und seiner Brüder im Auge gehabt, und sogar wenn er Päpsten gegenüber sich zu Diensten verpflichtet, sei das nur deshalb geschehen, weil es zu vermeiden unmöglich gewesen.
Domenico Grillandaio stand als der Herr der Werkstatt obenan, in welche Michelangelo jetzt eintrat, und gehörte zu den besten Meistern der Stadt. Er hatte damals eine umfangreiche Arbeit übernommen. Der Chor der Kirche Santa Maria Novella sollte neu gemalt werden. Orcagna, der Erbauer der offenen Halle neben dem Palaste der Regierung, der sogenannten Loggia dei Lanzi, hatte diesen Chor in Giottos Manier ausgemalt. Das Dach war schadhaft geworden, der Regen an den Wänden herabgelaufen und die Malerei allmählich zugrunde gegangen. Die Familie Ricci, welcher als Inhaberin dieses Chores auch seine Instandhaltung zukam, zögerte mit der Restauration der großen Kosten wegen. Jede bedeutende Familie besaß auf diese Weise eine Kapelle in einer der städtischen Kirchen, in der sie die Ihrigen begrub und deren Ausschmückung eine Ehrensache war. Da nun die Ricci ihre Ansprüche nicht aufgaben und anderen die Reparatur der beschädigten Wände nicht zugestehen wollten, blieb die Sache eine Zeitlang beim alten; Orcagnas Gemälde gerieten in immer bedenklicheren Zustand. Endlich machten die Tornabuoni, eine der reichsten Familien der Stadt, den Vorschlag, wenn man ihnen die Erneuerung der Kapelle überließe, wollten sie nicht nur alle Kosten tragen, sondern sogar das Wappen der Ricci prachtvoll wiederherstellen. Hierauf gingen diese ein. Grillandaio ward die Arbeit in Akkord gegeben. Der Meister stellte seine Forderung auf 1200 schwere Goldgulden mit einer Extravergütung von 200, wenn die fertige Arbeit zur besonderen Zufriedenheit der Besteller ausgefallen wäre. Im Jahre 1485 war sie in Angriff genommen worden.
Die Kapelle ist ein viereckiger, gewölbter, nach dem Schiff der Kirche hin offener Raum, durch den zu ziemlicher Erhebung aufgebauten Hochaltar jedoch, hinter dem sie liegt, von ihr abgeschlossen. Die Rückwand ist von Fenstern durchbrochen, es handelte sich also bei der Malerei nur um die beiden Wände zur Rechten und Linken, wenn man eintritt. Diese, in übereinander liegende lange, streifenartige Teile abgeteilt, mußten von unten bis oben mit Kompositionen ausgefüllt werden. Es sind Darstellungen biblischer Begebenheiten. Das heißt, die Namen der einzelnen Gemälde lauten so, in Wirklichkeit aber erblicken wir Gruppierungen bekannter und unbekannter florentinischer Schönheiten, Berühmtheiten, Männer, Frauen und deren Kinder, wie es die Umstände erforderten, im Kostüme der Zeit und in einer Weise zusammengestellt, als sei das, was das Bild bedeutet, vor wenigen Tagen in Florenz auf der Straße oder in einem der bekanntesten Häuser vorgefallen. Diese Art, die heilige Schrift unhistorisch aufzufassen, finden wir überall, wo sich die Kunst naiv und kräftig entwickelt. Rembrandt läßt Maria in einem Stalle sitzen, der einen holländischen Kuhstall seiner Zeit darstellt, während Raffael ihr in altem römischem Gemäuer ein Unterkommen gibt, wie er täglich daran vorüberging.
Für Florenz ist bei solchen Gemälden Vasaris Werk nicht hoch genug anzuschlagen. Als er schrieb, wußte man noch in der Stadt, wer diese Personen wären. Wir sehen da die gesamten Tornabuoni vom ältesten Mitgliede der Familie bis zum jüngsten herab, wir finden die Medici und in ihrem Gefolge die gelehrten Freunde der Familie: Marsilio Ficino, den platonischen Philosophen, den der alte Cosimo erzogen hatte, Angelo Poliziano, der Dichter, Philolog und Erzieher von Lorenzo dei Medicis Kindern war, und andere berühmte Namen. Unter den Frauen, welche bei der Begegnung der Maria und Elisabeth das Gefolge bilden, die reizende Ginevra dei Benci, damals die schönste Frau in Florenz, dann am Wochenbette der heiligen Anna andere Florentinerinnen, welche der Wöchnerin ihren Besuch abstatten, alle im vollen Staate, eine darunter mit Früchten und Wein, den sie, wie es damals Sitte war, zum Geschenk bringt. Wieder auf einer anderen Darstellung hat Domenico sich selbst und seine Brüder abgemalt.
Der Familie Medici begegnet man so an vielen Orten. Auf einem Gemälde im Camposanto zu Pisa stellt der alte Cosmo (oder Chosimo, wie die Florentiner sprachen und schrieben) mit seiner Familie und wiederum dem gelehrten Gefolge den König Nimrod dar, welcher den Turm von Babel bauen läßt. Babylon sehen wir im Hintergrunde; es ist bis in die genauesten architektonischen Einzelheiten ausgeführt und aus Gebäuden Roms und der Stadt Florenz sehr künstlich zusammengesetzt.
So kam Michelangelo gleich mitten in eine große Arbeit hinein. Eines Tages, als der Meister fortgegangen war, zeichnete er das Gerüst mit alle dem, was dazu gehörte, und mit denen, welche darauf arbeiteten, so durchaus richtig ab, daß Domenico, als er das Blatt ansah, voller Verwunderung ausrief, der versteht mehr davon als ich selber. Bald zeigten sich seine Fortschritte als so bedeutend, daß die Verwunderung in Neid umschlug. Grillandaio wurde besorgt. Es ergriff ihn jene Eifersucht, die bei zu vielen ähnlichen Gelegenheiten herausgetreten ist, um nicht auch hier verständlich zu sein.
Michelangelo malte sein erstes Bild. Bei dem lebhaften Verkehr der Florentiner mit Deutschland war es natürlich, daß deutsche Bilder und Kupferstiche nach Italien kamen. Ein Blatt Martin Schongauers, die Versuchung des heiligen Antonius darstellend, wurde von Michelangelo in vergrößertem Maßstab kopiert und ausgemalt. Dieses Gemälde soll noch in der Galerie der Familie Bianconi zu Bologna vorhanden sein. Anderen Nachrichten zufolge befindet es sich im Besitz des Bildhauers Mr. de Triqueti zu Paris, ohne daß gesagt wird, wie es in dessen Hände gelangte. Das Blatt Schongauers ist bekannt. Als Komposition betrachtet jedenfalls seine bedeutendste Arbeit und mit einer Phantasie erfunden, welche die tollsten niederländischen Arbeiten ähnlicher Art erreicht. Eine Gesellschaft fratzenhafter Ungeheuer hat den heiligen Antonius in die Lüfte geführt. Man sieht nichts von der Erde als unten in der Ecke des Bildes ein Stückchen Felsgestein. Acht Teufel sind es, die den armen Einsiedler in die Mitte genommen haben und peinigen. Der eine reißt ihn am Haar, der zweite am Gewande vorn, der dritte packt das Buch, das in eine Tasche eingeknöpft an seinem Gürtel hängt, der vierte reißt ihm den Stock aus der Hand, der fünfte hilft dem vierten, die anderen kneifen und zerren, wo nur Platz ist, um sich anzukrallen, und dabei kugelt und dreht sich das wunderliche Gesindel in den unmöglichsten Windungen über ihm, an ihm und unter ihm. Das ganze Tierreich ist bestohlen, um die Gestalten zusammenzusetzen. Krallen, Schuppen, Hörner, Schwänze, Klauen – was irgend Tiere an sich haben können, haben diese acht Teufel an sich. Das Fischhafte aber herrscht vor, und um hier ja nicht die Natur zu verfehlen, studierte Michelangelo auf dem Fischmarkt die ausgelegte Ware eifrig. So brachte er ein ausgezeichnetes Bild zustande. Grillandaio nannte es jedoch ein aus seiner Werkstatt hervorgegangenes oder gab sich sogar selbst als den Verfertiger an, wozu er der damaligen Sitte nach berechtigt war. Grillandaio, überhaupt, fing an die Fortschritte Michelangelos bedenklich zu finden. Er verweigerte ihm sein Skizzenbuch, aus dem dies und jenes abzuzeichnen den Schülern sonst freistand. Nun aber wurde ihm von Michelangelo sogar ein Streich gespielt. Dieser hatte als Vorlegeblatt einen Kopf zum Kopieren erhalten, ein schon älteres, etwas vergilbtes Blatt, das er nach einiger Zeit dem Meister wieder zurückgab, der es ruhig in Empfang nahm, worauf dann unter Gelächter die Entdeckung nachfolgte, er habe sich anführen lassen. Michelangelo hatte den Kopf so täuschend kopiert und das Blatt etwas angeräuchert, daß Grillandaio die eigene Arbeit von der des Schülers nicht mehr unterscheiden konnte. Es war Zeit, daß dem Verhältnis ein Ende gemacht würde, und dies geschah noch vor Ablauf der drei Jahre des Kontraktes auf eine Weise, die für Michelangelo kaum günstiger gedacht werden konnte. Er wurde mit Lorenzo dei Medici, Cosmos Enkel, bekannt, der um diese Zeit in Florenz die Regierung in Händen hatte.
IV
Florenz bestand, als Staat betrachtet, aus einer Vereinigung von Handelshäusern, deren erstes das der Medici war. Die Stellung der übrigen ergibt sich danach von selbst. Die Regierung der Stadt lag in den Händen Cosmos, der stets den Anschein des interesselosen, zurückgezogenen Bürgers festhielt, sicherer, als wäre er ein Fürst mit dein Titel eines Herrschers von Florenz gewesen. Piero, sein Sohn, regierte nach ihm. Daß er es tat, war ebenso natürlich, als sich von selbst verstand, daß er das ererbte Geschäft fortsetzte. Körperlich und geistig eine schwächere Natur, mit dem Beinamen »der Gichtbrüchige«, blieb er trotzdem sein Leben lang an der Spitze des Staates, und nach seinem Abscheiden traten Lorenzo und Giuliano, seine Söhne, in dieselbe Stellung ein: der Wechsel des Hauptinhabers unterbrach die Geschäfte des Hauses nicht.
Nach innen blieben die Medici schlichte Kaufleute, nach außen nahmen sie einen anderen Ton an. Cosmo war einmal in die Verbannung geschickt worden. Er trat wie ein Fürst auf in Venedig, wohin er sich gewandt hatte; die Florentiner merkten bald, daß er Florenz mit fortgenommen hätte, und holten ihn zurück. Nun war er Diktator; aber nur in Dingen, die keine Staatsangelegenheit waren, griff er öffentlich ein. Er berief Gelehrte, erbaute Kirchen und Klöster, stiftete kostbare Bibliotheken, verpflichtete sich jedermann durch willige Darlehen. In politischen Dingen mußten seine Freunde auftreten. Man braucht nur sein Gesicht anzusehen, das in den zahlreichsten Abbildungen aus allen Lebensaltern auf uns gekommen ist. Hohe, in die feingerunzelte Stirn hinaufgezogene Augenbrauen, eine lange, mit der etwas volleren Spitze hinuntergedrückte Nase, ein Mund, dessen feine Lippen nachdenklich zusammengepreßt und beide scharf nach vorn vorgedrängt sind, ein energisches, festes Kinn, im ganzen ein Anblick, daß man die verkörperte Klugheit zu erblicken glaubt.
Piero, sein Nachfolger, beging Fehler, behauptete sich aber allen Angriffen entgegen, ein Beweis, daß die Partei der Medici stark genug war, um sich selbst unter einer minder ausgezeichneten Führung in der Herrschaft zu erhalten. Lorenzo dagegen trat in die Fußstapfen des Großvaters und erhöhte seine persönliche Stellung um ein beträchtliches. Die Kämpfe, in denen er sich emporschwang, waren heftig und gefahrvoll. Seinem Bruder Giuliano kosteten sie das Leben. Sie zeigen, welch ein Mut dazu gehörte, an der Spitze eines Staates wie Florenz zu stehen.
Der Tod Giulianos fällt ins Jahr 1478. Michelangelo war damals zwei Jahre alt und noch in Settignano; die Verschwörung der Pazzi, die mit diesem Morde zum Ausbruch kam, gehört also kaum zu dem, was er erlebte. Ihre Entstehung aber, die Katastrophe und der Verlauf sind echt florentinisch, und die Erzählung des Ereignisses ist notwendig, um ein Gefühl von der Stellung Lorenzos zu der Zeit zu geben, in der Michelangelo mit ihm in Berührung kam.
Schon Cosimo hatte den Einfluß der mächtigen Familie auf seine Weise abzuschwächen gesucht, indem er seine Enkeltochter Bianca, Lorenzos und Giulianos Schwester, mit Guglielmo, dem einzigen Haupterben der Pazzischen Reichtümer, vermählte. Auf diesem Wege hoffte er eine Verschmelzung der beiderseitigen Familieninteressen herbeizuführen. Allein die Pazzi hielten sich zurück und bewahrten ihre Selbständigkeit, so daß Lorenzo und Giuliano, nachdem sie Regenten von Florenz geworden waren, ernstlicher darauf bedacht sein mußten, der drohenden Rivalität ein Ende zu machen. Es gab einen Punkt, wo sie keine Rücksicht kannten: mit eifersüchtiger Wachsamkeit suchten sie zu verhüten, daß kein anderes Haus durch seine Reichtümer ebenbürtig neben ihnen emporkäme. Drohte die Macht einer Familie die Grenze zu überschreiten, so griffen sie ein und ließen es darauf ankommen, was daraus werden würde.
Lorenzo bewirkte, daß von der Regierung der Stadt eine Reihe die Pazzi demütigender Maßregeln ausging. Man pflegte die großen, sogenannten adligen Häuser gemeinhin mit Rücksichten zu behandeln, die zwar nicht verfassungsmäßiger Natur, dennoch hergebracht waren; diese versäumte man jetzt den Pazzi gegenüber. Es fielen böse Worte von seiten der Familie, die Medici erwarteten das nicht anders, standen auf ihrer Hut und beobachteten sie.
Nun aber geschah schreiendes Unrecht. Die Frau eines Pazzi will ihren verstorbenen Vater beerben. Ein Vetter hält einen Teil der Erbschaft widerrechtlich an sich. Es kam zum Prozeß, die Frau mußte gewinnen; da erscheint ein neues Gesetz, durch welches dem Vetter der Besitz bestätigt wird. Lorenzo hatte es dahin gebracht; er wollte, daß das Geld geteilt bliebe. Giuliano selbst machte ihm Vorstellungen wegen dieser Ungerechtigkeit, allein das höhere Interesse überwog; Lorenzo war jung, hitzig und mutvoll, er glaubte dem Sturme die Spitze bieten zu können.
Dieser blieb nicht aus. In Florenz hielten sich die Pazzi still, aber in Rom begannen sie Waffen zu schmieden. Sie hatten dort wie die Medici und andere florentinische Häuser eine Bank, und Francesco Pazzi, welcher das Geschäft leitete, stand mit den Riarii, der Familie des regierenden Papstes, im besten Vernehmen. Die Medici waren Sixtus dem Vierten verhaßt und mußten es entgelten, soweit es in seiner Macht stand. Er hatte eben anstelle des verstorbenen Erzbischofs von Pisa einen anderen ernannt, der den Medici feindlich gesinnt war und den sie jetzt in seine Stellung einzutreten verhinderten. Man kam in Rom überein, wenn der Papst Ruhe haben wollte, so müßten die Medici in Florenz vernichtet werden. Die Riarii und Francesco entwarfen den ersten Plan. Der Erzbischof von Pisa ward hinzugezogen, hierauf der alte Jacopo Pazzi, das Haupt der Familie in Florenz, dessen Bedenklichkeiten der Papst selber erst heben mußte. Der Oberbefehlshaber der päpstlichen Truppen, Giovanbatista da Montesecco, kam nach Florenz, um näher zu verabreden, wie, wo und wann die Brüder zu ermorden wären, ob einzeln oder zugleich an einer Stelle; hierauf disponierte er seine Armee in kleinen Abteilungen derart, daß die Stadt rings eingeschlossen war und die Truppen, auf ein Zeichen von allen Seiten einbrechend, sich rasch in Florenz zusammenfinden konnten. Der Cardinal Riario brachte die Verschworenen in die Mauern der Stadt, indem er sie, unter seine zahlreiche Dienerschaft gemischt, selber durch die Tore führte.
Der Besuch dieses mächtigen Mannes war ein Ereignis. Ein Fest wurde veranstaltet, zu dem man die beiden Medici einlud. Hier sollten sie abgetan werden. Allein kurz vorher läßt Giuliano absagen. Jetzt mußte auf der Stelle ein Entschluß gefaßt werden, denn der kürzeste Aufschub konnte bei der großen Zahl der Mitwisser und der pünktlichen Verabredung aller übrigen Maßregeln der guten Sache verderblich werden. Es wurde ausgemacht, der Kardinal solle am Morgen des nächsten Tages im Dome die Messe lesen, die Brüder würden aus Höflichkeit erscheinen müssen, es sei das die beste Gelegenheit, sie niederzustoßen. Giovanbatista Pazzi wollte Lorenzo, Francesco Pazzi Giuliano auf sein Teil nehmen.
Alles abgemacht, erklärt Giovanbatista plötzlich, er könne an heiliger Stätte den Mord nicht ausführen. Es werden statt seiner nun zwei andere angestellt, der eine davon ein Priester, der eine natürliche Tochter Jacopo Pazzis im Lateinischen unterrichtete. Dieses Zurücktreten Giovanbatistas war der Anfang des Mißlingens, sagt Machiavelli, denn wenn bei irgend etwas, bedarf es bei solchen Gelegenheiten mutiger Festigkeit. Die Erfahrung lehrt, sagt er weiter, daß selbst denen, die an Waffen und Blut gewöhnt sind, der Mut dennoch versagt, wenn es in dieser Weise auf Leben und Tod geht.
Zu dem Momente, in welchem die Verschworenen zustoßen sollten, war das Zeichen mit der Glocke gewählt, während die Messe gelesen wurde; in demselben Augenblicke sollte der Erzbischof von Pisa mit seinen Leuten den Palast der Signorie stürmen. So hätte man mit einem Schlage den Umsturz der Dinge bewirkt und die Gewalt in Händen.
Die Brüder ahnten dunkel, daß etwas gegen sie beabsichtigt würde, allein in diese Falle gingen sie arglos hinein. Lorenzo kam zuerst, Giuliano blieb aus; einer von den Pazzi lief, ihn zu holen, und Arm in Arm traten sie in Santa Maria del Fiore ein. Mitten im Gedränge des Volkes stehen die Verschwörer und erwarten das Geläute, während die Worte der Messe aus dem Munde des Kardinals durch das weite, dämmernde Gewölbe und über die schweigende Menge fliegen.
Da schlägt die Glocke an, und Giuliano empfängt den ersten Stich in die Brust. Er springt auf, taumelt einige Schritte vor und stürzt zu Boden. Wütend fällt Francesco Pazzi über ihn her und zerfleischt ihn mit dem Dolche so wahnsinnig Stich auf Stich, daß er seine eigenen Glieder von denen des Todfeindes nicht mehr unterscheidet und sich selbst eine gefährliche Wunde beibringt.
Währenddem aber hat Lorenzo besser Stand gehalten. Ihm fuhr der Dolchstich in den Hals, er wirft sich zurück und verteidigt sich. Die Verschwörer stutzen, seine Freunde kommen zu sich, umgeben ihn und retten ihn in die Sakristei, gegen deren Türe Francesco, der Giuliano endlich in seinem Blute liegen läßt, mit seinen Genossen anstürmt. Ein furchtbares Getümmel erfüllt die Kirche. Der Kardinal steht am Altare, seine Geistlichen umringen und beschützen ihn, weil sich die Wut des Volkes, das die Dinge nun zu begreifen begann, nun gegen ihn wandte.
Unterdessen war der Erzbischof von Pisa auf den Palast losmarschiert. Die Signoren, welche, so lange ihr Amt dauert, dort wohnen und ihn unter keiner Bedingung verlassen dürfen, saßen eben beim Frühstück. Die Überraschung war vollständig, aber ebenso augenblicklich die Fassung. Mit den bewaffneten Dienern des Palastes vereint, drängen sie die feindliche Mannschaft, die dem Erzbischof schon die Treppe hinauf folgte, wieder hinab, während die, welche schon oben waren, zu Boden geschlagen oder aus den Fenstern auf den Platz niedergestürzt werden. Einen von den Pazzis aber und den Erzbischof selber exekutierte man auf der Stelle. Man warf jedem eine Schlinge um den Hals, und im Nu hingen sie draußen hoch am Fenster zwischen Himmel und Erde, während die anderen mit zerbrochenen Gliedern unten auf dem Pflaster lagen. Noch aber steckten die Verschworenen im Erdgeschoß des Palastes, wo sie sich verrammelt hatten. Oben läuteten die Signoren Sturm, aus allen Straßenmündungen strömten bewaffnete Bürger auf den Platz.
Im Dome war die Sakristei nicht zu erzwingen. Die Türen von Metall, mit denen sie versehen waren, leisteten guten Widerstand. Die Anhänger der Medici strömten von außen zu, Francesco Pazzi ließ den Mut nicht sinken. Der Stich, den er sich selbst ins Bein gegeben hatte, war so tief, daß ihn seine Kräfte verließen. Noch versuchte er zu Pferde zu steigen, um, wie verabredet war, durch die Straße reitend, das Volk in Aufruhr zu bringen, aber er vermochte es nicht mehr. Elend schleppte er sich nach Hause und bat den alten Jacopo, für ihn den Ritt zu übernehmen. Noch ahnte er nicht, wie es im Palast der Regierung stände, auch mußte von außen der Zuzug bald erscheinen. Jacopo, alt und gebrechlich, erschien mit hundert bewaffneten Berittenen auf dem Platze; der aber war von bewaffneten Bürgern besetzt, von denen keiner ihn anhören wollte. Die beiden Leichen sah er oben am Fenster hängen. So zog er mit seinen Leuten aus der Stadt und wandte sich in die Romagna. Auch anderen gelang es, sich davonzumachen. Francesco lag auf seinem Lager und erwartete sein Schicksal.
Das ereilte ihn bald. Lorenzo war, von bewaffneten Bürgern geleitet, zu Hause angelangt, der Palast der Regierung gereinigt von den Verrätern, überall wurde der Name Medici gerufen, und die zerrissenen Glieder der Feinde trug das Volk auf Piken aufgespießt durch die Straßen. Der Palast der Pazzi war das Ziel der allgemeinen Wut. Sie schleppten Francesco zum Palaste der Regierung und hingen ihn neben die beiden anderen. Kein Laut entschlüpfte ihm unterwegs, auf keine Frage gab er Antwort, nur zu Zeiten seufzte er schwer auf. So wurde dieser abgetan und der Palast der Pazzi geplündert. Und dann, als die Rache vollbracht war, kein florentinischer Bürger, der nicht in Waffen oder in seinem besten Staate bei Lorenzo erschienen wäre, um sich ihm mit Gut und Blut zur Verfügung zu stellen. Nun kam auch der alte Jacopo in die Stadt zurück, den man verfolgt und im Gebirge aufgebracht hatte. Er sowohl als ein anderer Pazzi, der ruhig auf seiner Villa gesessen hatte, wurden innerhalb von vier Tagen verurteilt und gerichtet. Aber alles genügte der Wut des Volkes nicht. Sie rissen Jacopo aus der Familiengruft wieder heraus, legten ihm einen Strick um den Hals und schleiften den Leichnam zum Arno, in den er hineingeworfen wurde, wo der Fluß am tiefsten war.
Lorenzo war jetzt allein, aber er stand in anderer Weise als früher dem Volke gegenüber, man empfand in Florenz, wie völlig das Geschick der Stadt mit dem der Medici verwachsen sei. Die nun folgenden Kriege mit dem Papste und mit Neapel trugen dazu bei, Lorenzos neuer Stellung Dauer zu geben. Wenig fehlte an seinem Untergange. Was ihn rettete, war eins der genialsten Wagnisse. Ohne Garantie persönlicher Sicherheit begab er sich zu Schiff nach Neapel in die Hände seines Feindes. Sein Auftreten hier, seine Klugheit, besonders aber sein Geld ließen ihn Wunder wirken. Er ging wie ein verlorener Mann, der unbesonnen dem Verderben entgegenschreitet, er kam zurück im Triumph als ein Freund des Königs, der ihn bald auch mit dem Papst versöhnte. Dieser war der rasendste seiner Gegner. Daß der Mordversuch von ihm selbst unterstützt worden sei, bedachte er nicht. Er hatte nur den Schimpf, der ihm durch die Erhängung des Erzbischofs und durch die Vereitlung seiner Pläne zugefügt worden war, vor Augen. Bezeichnend aber für die Zeit ist auch die Erklärung der florentinischen Geistlichkeit, die in den schroffsten Worten öffentlich aussprach, sie verachte den Bannfluch, und der Papst sei ein Verschwörer wie alle anderen. Trotzdem löst sich auch das in Wohlwollen und verzeihende Freundschaft auf, und der Medici geht aus den Anschlägen, deren Opfer er sein sollte, als der angesehenste Fürst Italiens hervor.
Was Lorenzo vortrefflich verstand, war die Kunst sich populär zu machen. Zwar hatte er nun seit 78 eine Art Leibgarde im Palaste, dazu war seine Frau eine Orsini, die zu den stolzesten Adelsgeschlechtern Italiens gehörten und sich nicht geringer als Kaiser und Könige dünkten, dennoch ging er in der Stadt nicht anders als seine Mitbürger. Wo es eine öffentliche Festlichkeit gab, da hatte er sie entweder angerichtet oder den größten Teil daran. Er mischte sich ins Gedränge und war jedem zugänglich. Er dichtete den Mädchen die Lieder, die sie zu ihren Tänzen sangen auf öffentlichen Plätzen zur Feier des Frühlings im Monat Mai. Alle Kinder kannten ihn, wer es begehrte, dem kam er mit Rat und Tat zur Hilfe. Am hellsten aber glänzte er in den Augen der Jugend, wenn er seine prächtigen Karnevalsumzüge veranstaltete, zu denen er dann auch selbst wieder Gesänge schrieb. Er scheute keine Kosten bei solchen Gelegenheiten, und nur wenige, die es verschwiegen, wußten darum, daß er die Staatsgelder dabei in Anspruch nahm. Bis dahin hatten die Medici ihren Aufwand aus eigenem Vermögen bestritten, Lorenzo fing an, die Geschäfte der Firma zu beschränken und sich anderweitig Mittel zu verschaffen.
Bei Gelegenheit eines solchen Karnevalaufzuges hatte sich Francesco Granacci, der ein schöner, gewandter Jüngling war und bedeutendes Talent für dergleichen besaß, in Lorenzos Gunst eingeschmeichelt. Es wurde der Triumphzug des Paulus Aemilius dargestellt. Nachahmungen römischer Triumphe waren eine beliebte Form öffentlicher Umzüge. Granacci sollte bald Gelegenheit finden, dieses Wohlwollen für sich und Michelangelo zu benutzen. Er erhielt Zutritt in den Garten von San Marco, wo die Kunstschätze der Medici aufgestellt waren.
Lorenzo ließ hier eine Anzahl junger Leute, besonders solcher, die aus guter Familie stammten, in der Kunst unterrichten. Der alte Bildhauer Bertoldo, Donatellos Schüler, leitete die Übungen. Im Garten waren Skulpturwerke aufgestellt, in den dazu gehörigen Gebäuden hingen Bilder und Kartons der ersten florentinischen Meister. Was von außen her auf die Bildung angehenden Künstler einwirken konnte, war vorhanden, und auch die Talente zeigten sich bald, denen diese Gunst des Schicksals zugute kam. Durch Granacci wurde jetzt Michelangelo in den Garten von San Marco eingeführt.
V
Der Anblick der Statuen, die er hier aufgestellt fand, gab seinen Gedanken eine andere Richtung. Wie er früher um Ghirlandaios willen die Schule vernachlässigt hatte, so versäumte er jetzt um der Statuen willen die Werkstätte des Ghirlandaio. Lorenzo ließ damals in seinem Garten Marmorarbeiten zum Bau einer Bibliothek anfertigen, in welcher die von Cosmo begonnene Büchersammlung untergebracht werden sollte und deren Vollendung später Michelangelo selbst geleitet hat. Mit den Steinmetzen schloß dieser jetzt Freundschaft. Er erlangte ein Stück Marmor und die nötigen Werkzeuge von ihnen und begann die antike Maske eines Fauns, die sich als Zierat im Garten vorfand, aus freier Hand zu kopieren. Doch hielt er sich dabei nicht ganz an das Original und gab seinem Werk einen weit geöffneten Mund, daß man die Zähne darin erblickte.
Diese Arbeit kam Lorenzo zu Gesichte, der selber auf die Dinge ein Auge zu haben pflegte und die Arbeiter im Garten besuchte. Er lobte Michelangelo, bemerkte aber scherzend: »Du hast deinen Faun so alt gemacht und ihm dennoch alle Zähne im Munde gelassen; du solltest doch wissen, daß man die bei so hohen Jahren nicht mehr sämtlich beieinander hat.«
Als der Fürst das nächste Mal wiederkam, fand er eine Zahnlücke im Munde des Alten vor, die so geschickt hineingearbeitet war, daß es kein vollendeter Meister besser verstanden hätte. Jetzt nahm er die Sache ernsthafter und ließ durch Michelangelo seinem Vater sagen, er möge zu ihm kommen.
Lodovico Buonarroti wollte nicht erscheinen auf diese Bestellung. Schon die Sache mit der Malerei war ihm hart angekommen, daß sein Sohn jetzt aber sogar noch Steinmetz werden sollte, deuchte ihm zu viel. Francesco Granacci, der bereits das erste Mal geholfen hatte, trat auch diesmal beruhigend ein und brachte ihn dahin, sich wenigstens zu Lorenzo auf den Weg zu machen. Michelangelos Vater war eine gerade, ehrliche Natur, ein Mann, der am Althergebrachten festhielt, uomo religioso e buono e piuttosto d'antichi costumi che no, sagt Condivi. Das Außergewöhnliche mußte ihm erst mit Mühe plausibel gemacht werden, ehe er sein Mißtrauen dagegen aufgab; so lamentierte er nun, daß sie ihm seinen Sohn auf allerlei Irrwege brächten, und ging mit der Absicht in den Palast, sich auf nichts einzulassen.
Lorenzos Liebenswürdigkeit stimmte ihn jedoch bald anders und vermochte ihn zu Erklärungen, an die er zu Hause sicherlich nicht gedacht hatte. Nicht allein sein Sohn Michelangelo, sondern er selbst und alle die Seinigen ständen mit ihrem Leben und Vermögen Seiner Magnifizenz zu Diensten. Medici fragte nach seinen Umständen und was er betriebe. »Ich habe niemals ein Geschäft gehabt«, berichtete er, »sondern lebe von den geringen Einkünften der Besitzungen, die mir von meinen Vorfahren hinterlassen sind. Die suche ich im Stande zu halten und, soviel ich kann, zu verbessern.« »Gut«, antwortete Lorenzo, »sieh dich um, kann ich etwas für dich tun, so wende dich nur an mich; es soll geschehen, was immer in meinen Kräften steht.«
Die Sache war abgemacht. Lodovico meldete sich nach einiger Zeit mit der Bitte um einen erledigten Posten beim Zollwesen, der monatlich acht Scudi einbrachte. Lorenzo, der ganz andere Ansprüche erwartet hatte, soll ihm da lachend auf die Schulter geschlagen haben mit den Worten: »Du wirst dein Lebtag kein reicher Mann werden, Lodovico.« Er gab ihm die Stelle, Michelangelo hatte er zugleich zu sich in den Palast genommen, ließ ihm ein Zimmer anweisen und setzte ihm monatlich fünf Dukaten Taschengeld aus. Alle Tage wurde öffentlich gespeist bei den Medicis; Lorenzo saß oben an, wer zuerst da war, setzte sich neben ihn, ohne Rücksicht auf Rang und Reichtum. So kam es, daß Michelangelo öfter den Ehrenplatz vor den eigenen Söhnen des Hauses voraus hatte, die ihn aber alle liebten und freundlich ansahen.
Hierbei blieb Lorenzo nicht stehen. Er ließ Michelangelo öfter zu sich rufen, sah mit ihm die Steine, Münzen und andere Kostbarkeiten durch, von denen der Palast erfüllt war, und hörte sein Urteil. Oder Polizian unterredete sich mit ihm und führte ihn in die Kenntnis des Altertums ein. Auf seinen Rat arbeitete Michelangelo den Kampf des Zentauren und Lapithen, ein Werk, das jedermann in Staunen setzte. Es ist ein Basrelief und unvollendet. Offenbar ist eine der Szenen, welche antike Sarkophage bieten, zum Muster genommen worden. Michelangelo wollte es nie fortgeben und hatte noch im späten Alter seine Freude daran. Heute befindet es sich im Palaste der Familie Buonarroti, der Faunskopf in dem National-Museum zu Florenz.
Bertoldo dagegen lenkte Michelangelo auf Donatello hin und unterwies ihn im Erzguß. Michelangelo arbeitete eine Madonna in der Weise dieses Meisters, dessen Natur ihn ebenso anzog als seine Werke: ein Basrelief, welches gleichfalls heute noch im Hause Buonarroti steht. Er zeichnete ferner mit den anderen Zöglingen Bertoldos nach Masaccio in der Kapelle Brancacci, wo Filippino Lippi eben noch die letzten fehlenden Gemälde beendete. Granacci ist hier als ein nackter Knabe angebracht, Filippinos Porträt, das Botticellis, der sein Meister war, das Pollaiuolos und anderer berühmter oder stadtbekannter Männer Bildnisse finden sich da. Durch diese Art, sich selbst und seine Freunde auf den Bildern anzubringen, wurde die Persönlichkeit der Künstler ein Teil der Kunst, und das Gefühl, daß hier eine große sich immer erneuernde Gemeinde mit vollen Kräften fortarbeitete, befestigte sich in den Gemütern der Nachstrebenden.
Nichts wurde damals verschmäht, was die Sache selbst förderte. Jede Richtung entwickelte sich unbekümmert neben der anderen. Das Altertum und die neueste Zeit waren gleichmäßig geschätzte Vorbilder. Das sorgfältigste Studium der Natur lief neben her und ließ das Gefühl für das lebendige immer über den Trieb toter Nachahmung triumphieren, der in späteren Zeiten leider so völlig den Sieg davontrug. In diesen Studien, wie sie damals unter Lorenzos persönlichem Einfluß in Florenz betrieben wurden, haben wir das schönste Beispiel einer Kunstakademie vor uns, und vielleicht das einzige, das uns zu der Wahrnehmung berechtigt, es habe gute und reichliche Früchte getragen. Eine andere Art gedeihlicher Einwirkung von seiten eines Fürsten auf die Kunst gibt es überhaupt nicht, denn die Kunst wird immer erniedrigt werden, wenn Fürsten aus äußerlichen Rücksichten und nicht aus dem edelsten Bedürfnis ihrer eigenen Seele sie zu erheben versuchen. Lorenzos Beispiel zeigt, daß die aufgewandten Geldmittel die geringste der treibenden Kräfte waren, welche sich hier vereinigten. Es bedurfte dazu, daß Medici selbst so tief in die klassischen Studien eingeweiht war, daß er die Jünglinge mit eigenem Blicke auswählte, daß er an den Sammlungen, die er ihnen zu Gebote stellte, selber die größte Freude hatte. Er ernennt den Lehrer, er verfolgt die Fortschritte, er erkennt aus den ersten Versuchen des Anfängers die glänzende Zukunft. Er bot den jungen Leuten in seinem Palaste den Verkehr mit den ersten Geistern Italiens. Denn alles strömte nach Florenz, und das Haus der Medici war nicht nur der Platz, von dem aus die feinsten Fäden der Politik nach allen Seiten gesponnen wurden, sondern die religiöse Bewegung, die philosophischen Studien, die Poesie, die Philologie wandten sich dahin, um teilweise eine entscheidende Richtung zu erhalten. Was Großes in der Welt geschah, wurde dort gekannt, besprochen und gewürdigt. Das Mittelmäßige erstickte unter der Fülle des Vortrefflichen. Das Vortreffliche selbst wurde nicht nach äußeren Merkmalen blind in den Kauf genommen, sondern mit Verständnis geprüft, ehe man es bewunderte. Bewegtes, geselliges Leben mischte sich ununterbrochen mit den ernsten Arbeiten, und als heilsamer Gegensatz zu den Süßigkeiten dieses Daseins wirkte der scharfe kritische Verstand des florentinischen Publikums, das sich in Sachen höherer Kultur weder bestechen noch betrügen ließ.
Das war es, was man nur in Florenz antraf und was die Florentiner an ihre Stadt fesselte: daß sie einzig dort die wahrhaft fördernde Anerkennung ihres eigenen feinen Geistes fanden. Nirgends sagte man so böse Dinge, nirgends aber sprach man so schön. Mißhandelt sahen sich die Künstler oft, mit erbärmlicher Knauserei in ihrem Lohne verkürzt, mit beißenden Worten und Beinamen verfolgt, stets aber dennoch mit jener wahrhaftigen Gerechtigkeit bis in ihre außerordentlichsten Leistungen erkannt und abgeschätzt, um derentwillen man gern alles übrige darangibt. Was ist ein Künstler ohne ein Publikum, das er seiner würdig fühlt? Donatello sehnte sich aus Padua, wo man ihn mit Schmeicheleien überschüttete, in seine Vaterstadt zurück. In Florenz fände man freilich immer an seinen Werken zu tadeln, sagte er, aber man reize ihn auch zu erneuten Anstrengungen und zur Erwerbung höherer, ruhmvoller Vollkommenheit. Wer sich Ruhe gönnte in Florenz, trat in den Hintergrund. Diejenigen Künstler, denen der Gewinn des täglichen Brotes nicht der nächste Grund zur Arbeit war, wurden durch den Ehrgeiz weiter gespornt, die aber, denen es auf die Bezahlung ankam, mußten alle Kräfte anspannen, weil die Konkurrenz so groß war. In der Luft von Florenz, sagt Vasari, liegt ein ungeheurer Antrieb, nach Ruhm und Ehre zu streben. Keiner will mit den übrigen gleichstehen, jeder möchte höher hinaus. Man sagt sich, bist du nicht so gut wie jeder andere? Kannst du es nicht ebenso weit und weiter bringen? Wer in behaglicher Ausbeutung der Kunst, die er gelernt hat, fortexistieren will, darf nicht in Florenz bleiben. Florenz ist wie die Zeit, die die Dinge schafft und sie wieder zerstört, wenn sie sie zur Vollendung gebracht hat.
Ich glaube, wenn es irgendwo erlaubt ist, sich eine romantische Vorstellung von den Dingen zu machen, so dürfen wir es bei Betrachtung der florentinischen Geselligkeit jener Jahre. Die Künste, die bei uns doch immer ein feineres Gewürz des Lebens sind, ohne das man sich allenfalls behelfen könnte, bildeten dort ein so notwendiges Ingredienz, daß sie wie das unentbehrliche Salz zum Brote waren. Man dichtete nicht nur, man sang auch die Lieder, die man gedichtet, Tanzen, Reiten, Ballspiel waren alltägliche Genüsse, und ein Gespräch, bei dem man die Blüte der Sprache anzuwenden trachtete, erschien ebenso willkommen wie ein frisches Bad oder eine Mahlzeit. Was dieses Leben aber gerade für Michelangelo erhöht haben muß, ist eine Eigenheit der romanischen Völker, die den germanischen abgeht. Das unbeholfene Wesen, das die Jugend bei uns schweigsam oder unlustig macht, wenn sie mit dem Alter zusammentrifft, kennen die Italiener nicht. Junge Leute von fünfzehn, sechzehn oder siebzehn Jahren, die in Deutschland die Unbehaglichkeit nicht überwinden können, mit der sie sich zwischen Älteren und Jüngeren ohne eigentliche Stellung sehen, gehen in Italien frei von beengenden Gedanken umher und wissen sich Frauen, Männern und Kindern gegenüber zu benehmen.
So empfing Michelangelo in dem Alter, in dem der fügsame Geist des Menschen der tiefsten und fruchtbarsten Eindrücke fähig ist, eine Erziehung, die kaum in glücklichere Zeiten fallen konnte. Bald aber traten nun auch die Stürme ein, deren Spuren ebenso erkenntlich in seinem Charakter sind, als es jene ersten sonnigen Tage waren. Denn Lorenzos Ende stand näher bevor, als irgend jemand ahnte, und die Änderung der Dinge, die schon in den letzten Jahren seiner Regierung begonnen hatte, bildete sich in immer rascherem Verlaufe zu totalem Umsturze des Bestehenden aus.