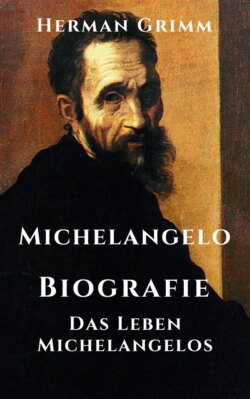Читать книгу Michelangelo - Biografie - Herman Grimm - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Drittes Kapitel
Оглавление1494-1496
I
Seit der Ermordung Giulianos war die alte frohe Stimmung, welche sonst am mediceischen Hofe herrschte, nicht zurückgekehrt. Die Feste von Carreggi waren vorüber, wo gedichtet, musiziert und im Schatten der Lorbeern Philosophie getrieben wurde, wo man sich der Gedanken an die Zukunft mit all der Sorglosigkeit entschlug, die zum jugendlich genialen Genusse des Lebens so notwendig ist. Und wie in den Medici eine Wandlung vorging, so in den Gemütern der Florentiner selbst. Einstweilen verdunkelten die Wolken die Sonne noch nicht, aber die Wolken zogen auf, das fühlte man.
Zwei Dinge verstanden sich von selbst, wenn die Lage des Staates in Betrachtung kam: erstens, je mehr Lorenzo in eine fürstliche Stellung durch die bloße Gestalt der Umstände hineingedrängt wurde, um so mehr mußte der ihm ebenbürtige Adel fürchten, in Abhängigkeit zu geraten, die Strozzi, Soderini, Capponi und eine ganze Reihe der mächtigsten Familien; zweitens: Lorenzo selbst, je mehr ihm Widerstand von dieser Seite als etwas Natürliches erschien, das sicher zu erwarten war, um so geschickter mußte er den Anschein zu wahren suchen, als habe er dergleichen ganz und gar nicht im Sinne, um so fester mußte er das gemeine Volk auf seiner Seite halten. Daher diese fortwährenden öffentlichen Lustbarkeiten, diese Leutseligkeit dabei. Es könnte fast darüber gestritten werden, ob es in seiner Absicht gelegen habe, sich zum absoluten Herrn der Stadt zu machen. Man weiß, wie er seinem Sohne eindringlich empfahl, niemals zu vergessen, daß er nichts als der erste Bürger der Stadt sei. Aber angenommen wirklich, Lorenzo habe die Gefahren erkannt, die eine äußerliche Erhöhung seiner Familie in den Fürstenstand mit sich brachte, und den Moment hinausschieben wollen, in dem es so weit kam, – daß es einmal so weit kommen mußte, war ihm und jedermann, der die Verhältnisse näher kannte, offenbar: die finanziellen Angelegenheiten zwangen die Medici, die Gelder des Staates zum Vorteil ihrer eigenen Pläne in Anspruch zu nehmen. Dies Bedürfnis machte sich in steigendem Maße geltend. Es mußte das zur Tyrannei führen.
Hier also drohte ein Zusammenstoß. Die Florentiner waren zu gute Kaufleute, um das Exempel nicht selbst zu stellen und zu Ende zu rechnen in Gedanken. Allein es waren doch nur erst Wege, die zur Gefahr führen konnten, es hätte erst der Männer bedurft, die den Kampf herbeizwangen und leiteten. Die tägliche Stimmung des Publikums litt unter diesen Möglichkeiten noch nicht. Dagegen erhob sich eine andere Macht in der Stadt, die gefährlicher und erschütternder wirken sollte, und hier war auch ein Mann vorhanden, der eine mächtige Natur mit sich brachte, um das ins Werk zu setzen, was in seinem Geiste als Gedanken zuerst entstanden war. Dieser Mann ist Girolamo Savonarola, sein Gedanke: totale Reform in politischer und sittlicher Beziehung zum Besten der Freiheit von Florenz, und diesen Mann begünstigten die Ereignisse.
Savonarola war aus Ferrara gebürtig. Er kam in demselben Jahre nach Florenz, in dem Michelangelo von Lorenzo in den Palast der Medici aufgenommen wurde. Er war siebenunddreißig Jahre alt und schon früher einmal kurze Zeit in der Stadt gewesen, allein seine Predigten hatten damals wenig Erfolg gehabt. Jetzt erschien er als gereifter Mann und begann auf der Stelle in dem Geiste aufzutreten, den er bis zu seinen letzten Schritten fest bewahrt hat. Seine Überzeugungen hat er als Kind gehegt und bis zu seinem Tode nicht ein einziges Mal verleugnet und aus dem Herzen verloren.
Man könnte diesen zartgebauten, einsamen, nur auf sich selbst beruhenden, wie aus eisernen Fäden gewebten Charakter eine fleischgewordene Idee nennen, denn der Wille, der ihn beseelte, vorwärts trieb und aufrecht hielt, ist so rein aus jeder seiner Handlungen zu erkennen, daß die Erscheinung der wunderbaren, aber einseitigen Kraft etwas Schauerliches an sich hat. Wir Menschen leben in einer gewissen Unklarheit, deren wir bedürftig sind, Dumpfheit nennt es Goethe bei sich selber; die vergehende Zeit beraubt uns um Gedanken, die kommende führt uns neue zu: wir vermögen jene weder zu halten, noch dieser uns zu erwehren. Wir gehen von einem zum anderen über; bald rechts, bald links getrieben in unserem Wege, glauben wir viel getan zu haben, wenn wir wenigstens zeitweise des Steuers uns bedienen durften, wenn wir im Ganzen gewahren, daß es nicht rückwärts geht; dieser Mann aber durchschneidet das neblige Meer des Lebens wie ein Schiff, das der Segel und der geistigen Winde entraten kann, das die Stürme nicht irren, in sich selbst die Kraft besitzend, die es vorwärts treibt, geradeaus und keinen Zoll von der Linie weichend, die es innehalten wollte von Anfang an. Dreiundzwanzig Jahre alt, flieht er nachts aus dem väterlichen Hause, um in ein Kloster einzutreten. Er läßt einen Brief zurück, aus dem die ruhige Überlegung eines Geistes redet, der völlig mit sich selber im reinen ist. Er belehrt seinen Vater mehr, als daß er sich entschuldigt. Er fordert ihn auf, seine Mutter zu trösten und für die Erziehung der Brüder zu sorgen.
Savonarolas leitende Idee war die Lehre vom Strafgerichte, das unverzüglich über das verderbte Italien hereinbrechen werde, um dann aber um so höhere Blüte des Vaterlandes eintreten zu lassen. Die Welt schien ihm der Katastrophe mit großen Schritten entgegenzueilen. Savonarola sah die heidnische Wirtschaft allüberall, den Papst und die Kardinäle tonangebend an der Spitze. Die Strafe dieser Greuel konnte nicht länger auf sich warten lassen, das Maß war voll. So dachte er. Und wohin er blickte, bestätigte das was geschah dies Gefühl, das in seinem Herzen nach Worten suchte.
Es ist wahr, der moralische Zustand des Landes erscheint unerträglich für unser Urteil. Die Verschwörung der Pazzi steht nicht etwa als ein besonderer Fall hervorragend da, sondern nach diesem Muster waren alle die Dinge geformt, die vorfielen. Kein bedeutender Mann damals, dessen Tod nicht zu dem Gerüchte einer Vergiftung Anlaß gab. Man lese die Geschichtsschreiber darauf hin, unwillkürlich wird immer diese Ursache als die erste und natürlichste vorausgesetzt, an die man denkt. Unehelichen Kindern, mochte die Mutter ein Mädchen oder eine Frau sein, klebte kein Makel an, kaum daß ein Unterschied zwischen ihnen und legitimen Abkommen gemacht wurde. Das ist eine der Beobachtungen, die Commines der Aufzeichnung wert hielt, als er sich über Italien aussprach. Betrug erwartete man überall, und nur der Betrüger ward verachtet, der sich selber überlisten ließ. Feigheit war nur dann ein Verbrechen, wenn sie, mit zu wenig Hinterlist gepaart, das Ziel verfehlte. Klug wurde der genannt, der auch der treuherzigsten Versicherung keinen Glauben schenkte.
Was wir in unserem Sinne Scham vor dem Urteil der öffentlichen Meinung nennen, gab es noch nicht. Ein Beispiel möge zeigen, wie man lebte und dachte. Filippo Lippi, der beste Schüler Masaccios, war ein Karmelitermönch, der wie viele andere Mönche die Malerei betrieb und selten Geld im Hause hatte. Seines unordentlichen Wandels wegen allgemein bekannt, erhält er nichtsdestoweniger den Auftrag, in einem Nonnenkloster die heilige Margherita an die Wand zu malen. Er bittet um ein Modell, die Nonnen geben dazu eine reizende Novize, Lucretia Buti mit Namen. Eines schönen Tages ist er fort mit ihr. Die Eltern des Mädchens schlagen Lärm; Lucretia wird aufgefunden, erklärt aber, daß sie unter keiner Bedingung Filippo verlassen werde. Nun macht der Papst Eugen selbst dem Künstler den Vorschlag, er wolle ihn seines Mönchsgelübdes entbinden, damit er Lucretia wenigstens heiraten könne. Davon aber will Filippo nichts hören, und dabei blieb es. Und dieser Filippo, der später von den Verwandten einer andern Frau, welcher er nachstellte, vergiftet wurde, ist ein Meister, der Madonnen mit dem Ausdrucke der zartesten Unschuld gemalt hat. Während er jedoch in seinen Werken die innerste, bessere Natur herauskehrte, nahmen andere Geistliche noch nicht einmal diese Rücksicht. Geweihte Priester, Bischöfe und Kardinäle dichten Verse und bekennen sich öffentlich als ihre Autoren, gegen deren Inhalt Ovids Amoren Kinderlieder sind. Und im Schoße der Familien pfropfen sich Verbrechen auf Verbrechen, die ebensowenig das Licht des Tages scheuen; die Lehren der Religion sind verspottet und erniedrigt, Astrologie und Wahrsagerei hergebrachte offizielle Einrichtungen, ohne deren Zustimmung die Päpste selber nicht zu handeln wagen, – man begreift wohl, wie da das Gefühl sich finden konnte, daß das Ende aller Dinge gekommen sei.
Savonarola aber wurde durch dies Gefühl, das mit ruheloser Macht in ihm arbeitete, nicht zur Verzweiflung an der Möglichkeit des Heils getrieben, sondern er wollte verkünden, was er drohend erblickte, um zu retten, was zu retten war. Mit diesem Vorsatze ging er fort aus dem Hause seines Vaters und suchte die Stelle zu gewinnen, von der aus seine Stimme gehört wurde in Italien. Er machte eine lange Lehrzeit durch, mit Entbehrungen und Entmutigungen angefüllt. Er bereitete sich durch strenge Studien zu seinem Amte vor. Zuerst predigte er so rauhtönend und ungeschickt, daß er oft dachte, er werde niemals predigen lernen. Endlich schlug die Stunde, in der er zu wirken begann. Lorenzo Medici selber betrieb seine Versetzung nach Florenz. Der Graf Pico von Mirandola, ein Mann, der von seinen Zeitgenossen als der Inbegriff männlicher Vollkommenheiten dargestellt wird, durch Schönheit, Ritterlichkeit, Adel, Reichtum und weit umfassende Gelehrsamkeit hervorragend, hatte Savonarola in Reggio kennen gelernt, wo ein Generalkonvent seines Ordens abgehalten wurde. Er machte Lorenzo auf ihn aufmerksam, und dieser, der alles Bedeutende nach Florenz zu ziehen suchte, bewirkte seine Berufung nach San Marco, das Lieblingskloster der Medici, das sie selber neu gebaut und mit einer kostbaren Bibliothek ausgestattet hatten.
Hier begann Savonarola jetzt zu predigen. Bald war die Kirche zu klein, und man zog in den Hof des Klosters; unter einem persischen Rosenbaume stehend, umdrängt von Zuhörern, die Wort für Wort von seinen Lippen fingen, sprach er mit erschütternder Gewißheit von den Dingen, die sein Herz erfüllten. Er prophezeite die Zukunft, aber es lag nichts Dunkles, Orakelmäßiges in seinem Wesen. Seine Phantasie war weder umfangreich, noch bot sie ihm farbige Bilder; er war eher eine nüchterne Natur, deren logisches Denken sich bis zur Verzückung steigerte. Einige Sätze drängte er der Welt gewaltig auf, alles andere leitete er mit schneidender Wissenschaftlichkeit von ihnen ab. Die Politik war sein eigentliches Feld, und mit seinen Ideen ging er stets auf sofortige praktische Anwendung los.
Zu Anfang enthielten seine Predigten nichts, das Lorenzo hätte bedenklich machen können. Die Reform der Kirche war eine anerkannte Notwendigkeit. Die Medici hatten sich bei all ihrer platonischen Philosophie nie dem öffentlichen Christentum abhold gezeigt, am wenigsten der Geistlichkeit, die zudem ebenso heidnisch wie sie selber dachte. Die Zeremonien der Kirche blieben stets ein Bedürfnis. Lorenzo hat neben den weltlichsten Poesien ein geistliches Drama und dergleichen Gesänge gedichtet. Mit echt philosophischer Gesinnung begünstigte er alles, was der Gunst bedürftig war. Daß diese Gegensätze sich so friedlich nebeneinander fanden, daran ist die Eigentümlichkeit der romanischen Natur schuld, die ohne Heuchelei sich den verschiedensten Strömungen zugleich hingeben kann, deren Vereinigung germanischer Anschauung weniger natürlich erscheint. Heidnische Schriftsteller wurden auf der Kanzel zitiert, als wenn sie fromme Kirchenväter gewesen wären. Selbst Savonarola, der in diesem Punkte die strengsten Ansichten hatte, war weit entfernt, die antiken Autoren zu verdammen und zu verbieten, sondern nannte nur einige der ärgsten Schriften, von denen er nicht wollte, daß man sie den Kindern in die Hände gebe.
Lorenzo begünstigte das Kloster, zu dessen Prior Savonarola bald gewählt wurde, so auffallend, daß Dankbarkeit und Hingebung natürlich gewesen wären. Allein Savonarola dachte nicht daran, die Dinge so zu fassen. Nicht Lorenzo, sondern die Vorsehung habe ihn nach Florenz geführt, ob er sich ihrem blinden Werkzeuge jetzt unterwürfig zeigen solle? Es fiel ihm nicht ein, als neu gewählter Prior im Palaste Medici den herkömmlichen Besuch zu machen. Gott habe ihm dies Amt gegeben, und keinem sterblichen Menschen brauche er dafür Dank zu sagen. Lorenzo ließ das hingehen, besuchte nach wie vor das Kloster und beschenkte es. Savonarola verwandte diese Spenden alsbald in auffallender Art zu wohltätigen Zwecken. Er wollte die alte Ordensregel, welche jeden Besitz verbot, in voller Strenge wieder einführen. In seinen Predigten spielte er auf diese Geschenke an. Wenn einem wachsamen Hunde ein Stück Fleisch zugeworfen werde, so beiße er wohl hinein und verstumme auf kurze Zeit, alsbald aber lasse er es dennoch wieder fallen und belle nur um so kräftiger gegen die Räuber und die Unterdrücker der Freiheit.
Lorenzo stand zu hoch, um gereizt zu werden. Es wäre gegen alles mediceische Herkommen gewesen, offen einzugreifen. Er veranlaßte einige der vornehmsten Männer in Florenz, dem Prior von San Marco ganz wie aus eigenem Antriebe ein anderes Auftreten anzuempfehlen. Warum er ohne Grund das Volk beunruhige? Er tue nichts, war Savonarolas Antwort, als im Namen Gottes Laster und Ungerechtigkeit anzugreifen. So sei es in den ersten Zeiten der Kirche Sitte gewesen. Er wisse wohl, woher die Herren kämen und wer sie gesandt hätte. »Aber sagt dem Herren Lorenzo dei Medici«, schloß er, »er möge in sich gehen, denn Gott werde ihn seiner Sünden wegen ins Gericht nehmen. Sagt ihm ferner, ich sei hier fremd und er ein Bürger der Stadt, ich aber würde bleiben und er davon gehen.«
Lorenzo nahm die Dinge wie ein Weltmann. Er ließ sich weder beleidigen, noch zu auffallenden Schritten hinreißen. Er versuchte es auf anderem Wege. Savonarola sollte mit seinen Prophezeiungen ad absurdum geführt werden. Unter den der Familie Medici anhänglichen Persönlichkeiten befand sich ein gelehrter Augustinermönch, Mariano, Platoniker und ausgezeichneter Kanzelredner. Dieser wurde ins Feuer geschickt. Er kündigte eine Predigt an über den Text: »Es gebührt euch nicht, zu wissen Zeit und Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat.« Was an Männern von geistiger Bedeutung in der Stadt war, fand sich bei ihm ein und billigte, nachdem er geendet, den vortrefflichen Vortrag.
Savonarola nahm den Kampf an. Er predigte über dasselbe Thema. Aber während Mariano den Akzent darauf gelegt, daß uns nicht zu wissen gebühre Zeit und Stunde, faßte Savonarola die Worte anders: zu wissen gebühre uns, aber die Zeit und Stunde zu wissen, gebühre uns nicht. Er begeisterte zu Tränen, die ihn hörten. Lorenzos eigene Partei zog er zu sich hinüber, den Grafen von Mirandola, Marsilio Ficino, der vor Platos Büste eine Lampe brennen hatte wie vor einem Heiligen, Polizian, den eingefleischten klassischen Gelehrten, alle fühlten sich mit fortgerissen. Wie vom Himmel stürzten die Ströme seiner Beredsamkeit. Es war kein Widerstand, wenn er sprach. Seine Worte wurden zu Befehlen. Sie wucherten unvertilgbar fort in den Gemütern. Es schien als sei es möglich, die Natur der Menschen umzuwandeln. Frauen erhoben sich plötzlich, legten ihre prachtvollen Gewänder ab und erschienen wieder in bescheidener Kleidung; Feinde versöhnten sich; unrechtmäßiger Gewinn wurde freiwillig zurückgegeben. In jenen Zeiten ereignete es sich, daß ein junges glückliches Ehepaar sich trennt und beide Teile ins Kloster gehen. Vivoli, der Savonarolas Predigten in der Kirche nachschrieb und sie drucken ließ, erzählt, wie er oft vor Weinen nicht habe weiterschreiben können. Und endlich sollte Lorenzo selbst sich der Macht dieses Geistes beugen oder wenigstens seines Trostes bedürftig sein.
Es war während der Fasten des Jahres 1492, daß dieser Sturm geistiger Aufregung Florenz erfaßte. Mit dem Osterfeste hatten die Predigten ihr Ende gefunden. Plötzlich erkrankte Lorenzo. Er war erst vierundvierzig Jahre alt. Auch hier ward von Gift gemunkelt. Die Krankheit war kurz. Er lag in Carreggi, seinem Landhause unweit der Stadt, er fühlte das Herannahen des Todes, nahm von seinen Freunden Abschied und kommunizierte voll demütiger Ergebung in die Verheißungen der Kirche.
Da zuletzt verlangte er nach Savonarola. Wir wissen nicht, was zwischen beiden vorging. Polizian, in dessen Briefen sich eine genaue Darstellung der letzten Momente findet, erzählt, daß sie versöhnt voneinander geschieden seien und daß Savonarola Lorenzo gesegnet habe. Andere aber behaupten, er hätte diesen Segen verweigert. Nachdem Lorenzo zweien seiner Forderungen zugestimmt: an die Barmherzigkeit Gottes zu glauben und alles ungerecht genommene Gut zurückzuerstatten, habe Savonarola zuletzt verlangt, er solle der Stadt ihre Freiheit wiedergeben. Da wandte er schweigend sein Gesicht von ihm ab der Wand zu, und Savonarola verließ ihn.
II
Michelangelo befand sich unter den Dienern und Hausgenossen vielleicht, von denen erzählt wird, daß sie weinend um Lorenzos Lager standen in den letzten Augenblicken. So vernichtet war er von dem Verluste, daß es lange Zeit bedurfte, ehe er sich zur Arbeit sammeln konnte. Er verließ den Palast und richtete sich im Hause seines Vaters eine Werkstätte ein.
Piero, Lorenzos ältester Sohn, übernahm die Regierung. In ganz Italien aber wurde die Nachricht von dem Tode des großen Medici wie die Kunde eines Unglücks aufgenommen, das jeden einzelnen beträfe, und das Vorgefühl böser Zeiten wuchs an, mit dem man in die Zukunft schaute.
Lorenzo soll von sich gesagt haben, er habe drei Söhne, der erste sei gut, der zweite gescheit; der dritte ein Narr. Der Gute war Giuliano, dreizehnjährig, als sein Vater starb, der Gescheite Giovanni, siebzehn Jahre alt, aber schon Kardinal durch die Gunst des Papstes, dessen Sohn mit einer Tochter Lorenzos verheiratet war, der Narr war Piero. Über ihn sprach Lorenzo mit Besorgnis, wenn er gegen vertraute Freunde seine Meinung äußerte. Sein Auge blickte zu scharf, um die Eigenschaften des Sohnes nicht zu übersehen, dessen geringste Gabe die der Verstellung war.
Piero war jung, hochmütig und ritterlich, kein Medici seinem Geiste nach, sondern ein Orsini, wie Clarice, seine Mutter, und Alfonsina, seine Gemahlin. Es wäre dem Stolze dieser Frauen und ihrer herrschsüchtigen Natur unmöglich gewesen, Piero dei Medici für etwas anderes als den legitimen Fürsten von Florenz anzusehen, und er widerstrebte dem Einflusse nicht, den sie beide auf ihn ausübten. Die Theorie der indirekten Taten und des sich Drängenlassens war seinem ungeübten Geiste nicht geläufig. Voll kühner Wünsche, aufgewachsen im Überflusse wie ein Fürstenkind, dachte er nicht einmal daran, die Gedanken zu verheimlichen, die er hegte. Seine Hochzeit war in Neapel vom Könige gefeiert worden, als gelte es den reichsten Königssohn zu ehren. Auf der Hochzeit des jungen Sforza in Mailand, wohin sein Vater ihn gesandt, war er nicht anders aufgetreten; jetzt, da er die Macht in Händen und die drängenden Umstände und die gewaltigen Orsini hinter sich hatte, blieb nichts übrig, als sich zum Herzoge von Florenz aufzuwerfen.
Gelegenheit dazu zeigte sich alsbald. Mit Lorenzos Verscheiden verschwand die Gewalt, welche bis dahin Neapel und Mailand beruhigend auseinander gehalten und, nach allen Seiten hin in feinster Weise diplomatisch wirkend, den Bruch des Friedens in Italien hinausgeschoben hatte. Wir finden das Gleichnis gebraucht, Florenz mit Lorenzo habe wie ein Felsendamm zwischen zwei stürmischen Meeren gestanden.
Italien war zu jener Zeit ein freies Land und von fremder Politik unabhängig. Venedig mit seinem festgeschlossenen Adel an der Spitze, Neapel unter den Aragonesen, einer Nebenlinie der in Spanien herrschenden Familie, Mailand und Genua unter den Sforza, alles drei tüchtige Gewalten zu Wasser und zu Lande, hielten einander die Waage. Lorenzo beherrschte Mittelitalien; die kleinen Herren der Romagna standen sämtlich in seinem Solde und der Papst mit ihm im besten verwandtschaftlichen Einvernehmen. Aber in Mailand steckte das Unheil. Ludovico Sforza, der Vormund seines Neffen Gian Galeazzo, hatte die Gewalt völlig an sich gerissen. Sein Mündel ließ er geistig und körperlich verkommen, er ruinierte den jungen Fürsten langsam zu Tode. Aber dessen Gemahlin, eine neapolitanische Prinzessin, durchschaute den Verrat und drang in ihren Vater, die unerträgliche Lage mit Gewalt zu ändern. Sforza allein hätte Neapel nicht widerstehen können. Auf Venedigs Freundschaft war kein Verlaß für ihn, Lorenzo vermittelte, solange er lebte, jetzt, nach seinem Tode, war Neapel nicht mehr zurückzuhalten. Das erste was geschah, war die Verbindung Pieros mit dieser Macht und zugleich der Hilferuf Ludovico Sforzas nach Frankreich, wo ein junger, ruhmbegieriger König den Thron bestiegen hatte. Der Tod Innozenz des Achten und die Wahl Alexander Borgias zum Papste vollendeten die Verwirrung, die hereinbrach.
Lange diplomatische Feldzüge gingen voraus, ehe es wirklich zum Kriege kam. Es handelte sich nicht um die Interessen der Nationen, daran kein Gedanke, aber doch auch nicht um die Launen der Fürsten allein. Der hohe Adel Italiens war leidenschaftlich bei diesen Kämpfen beteiligt. Am französischen Hofe wurden die Schlachten der sich begegnenden Intrigen ausgefochten. Frankreich war von den Aragonesen um Neapel beraubt worden. Die vertriebenen französisch gesinnten neapolitanischen Barone, deren Besitzungen die Aragonesen ihren eigenen Anhängern gegeben hatten, ergriffen mit Feuer den Gedanken, siegreich in ihr Vaterland zurückzukehren; die den Borgias feindlichen Kardinäle, voran der Kardinal von San Piero in Vincula, ein Neffe des alten Sixtus, und der Kardinal Ascanio Sforza, Ludovicos Bruder, drängten zum Kriege gegen Alexander den Sechsten; die florentinischen Großen, die den Gewaltstreich Pieros voraussehen, hofften auf Befreiung durch die Franzosen und redeten zu in Lyon, wo das Hoflager sich befand und eine ganze Kolonie florentinischer Häuser sich mit der Zeit gebildet hatte. Sforza lockte mit dem Ruhme und den gerechten Ansprüchen auf das alte legitime Besitztum.
Die Aragonesen dagegen boten einen Vergleich an, Spanien, das seine Verwandten nicht im Stiche lassen wollte, stand ihnen zur Seite; der Papst und Piero dei Medici hielten zu Neapel, und der französische Adel war dem Zuge nach Italien nicht günstig. Venedig stand neutral, allein es konnte gewinnen beim Kriege und redete nicht ab, und diese Meinung, daß etwas zu gewinnen sei, bemächtigte sich allmählich aller Parteien, selbst derer, welche anfangs den Frieden zu erhalten wünschten.
Spanien gewann zuerst und unmittelbar: Frankreich trat dem Könige Ferdinand eine streitige Provinz ab unter der Bedingung, daß er seinen neapolitanischen Vetter ohne Unterstützung ließe. Sforza als Herr von Genua wollte Lucca und Pisa wieder haben nebst dem Übrigen, was dazu gehörte: die Visconti hatten es ehedem besessen, und er nahm es von neuem in Anspruch. Was Piero dei Medici hoffte, ist gesagt. Pisa hoffte frei zu werden. Der Papst hoffte durch seine Allianz mit Neapel den ersten Schritt zur Erreichung der großen Pläne zu tun, die er für sich und seine Söhne hegte; er dachte einmal ganz Italien unter sie zu verteilen. Die Franzosen hofften Neapel zu erobern und dann weiter in einem gewaltigen Kreuzzuge die Türken anzugreifen. Als für einen Kreuzzug machte der König im eigenen Lande die Anleihen, deren er für den Feldzug bedurfte. Die Venezianer hofften von den Küstenstädten des adriatischen Meeres soviel als möglich in ihre Gewalt zu bringen. Im Herbste 1494 stellte sich Karl von Frankreich an die Spitze seiner Ritter und Mietstruppen, mit denen er die Alpen überschritt, während die Flotte mit der Artillerie, der furchtbarsten Waffe der Franzosen, nach Genua unter Segel ging.
III
Während der zwei Jahre, in denen diese Dinge sich gestalteten, trieb Michelangelo, der noch nicht zwanzig Jahre alt, seine Kunst auf eigene Hand weiter. Er kaufte ein Stück Marmor und arbeitete daraus einen Herkules von vier Fuß Höhe. Diese Statue stand lange im Palaste Strozzi, wurde dann nach Frankreich verkauft und ist heute vielleicht in England.
Es wird ferner ein Kruzifix genannt, das er beinahe lebensgroß für die Kirche des Klosters San Spirito ausführte, eine Arbeit, die ihm von großem Nutzen war, denn der Prior des Klosters, dessen Zuneigung er gewann, verschaffte ihm Leichname zu anatomischen Studien. Es wird heute ein Kruzifix in San Spirito gezeigt und für Michelangelos Werk ausgegeben, aber mit Unrecht.
Sein Fortziehen aus dem Palaste der Medici hatte darum sein Verhältnis zu der Familie nicht aufgelöst. Eine Art abhängiger Stellung dauerte fort, Piero zählte ihn zu den Seinigen und zog ihn zu Rate, wenn Kunstsachen angekauft wurden. Ein Verkehr jedoch wie mit Lorenzo war nicht möglich. Schon die Jugend Pieros verhinderte das. Zwar hatte dieser eine gründliche wissenschaftliche Bildung erhalten, Latein und Griechisch waren ihm geläufig, mit natürlicher Beredsamkeit ausgestattet, liebenswürdig, gutmütig und herablassend wußte er, wenn er wollte, die Menschen für sich einzunehmen, am liebsten aber trieb er ritterliche Übungen und überließ es anderen, sich mit dem Detail der Regierung und der Politik statt seiner abzugeben. Er war ein schöner Mann, sein Wuchs überschritt das gewöhnliche Maß, er wollte der erste Reiter, der beste Ballschläger, der Sieger in den Turnieren sein. Er rühmte sich, einen Künstler wie Michelangelo zu besitzen, nicht weniger aber tat er sich zu gleicher Zeit auf einen Spanier zugute, der in seinem Marstall diente und als Läufer ein Pferd in gestrecktem Carrière überholte.
In der Nacht des 22. Januar 1494 schneite es so heftig in Florenz, daß der Schnee zwei bis drei Ellen hoch in den Straßen lag. Piero ließ Michelangelo holen und eine Statue von Schnee im Hofe des Palastes von ihm errichten. Man hat diesen Auftrag für eine Verspottung des Genies ansehen wollen; Michelangelo jedoch, darf nicht vergessen werden, war damals ein junger Anfänger, der noch nichts geleistet hatte. Sowenig die ersten Künstler der Stadt Bedenken trugen, an den vorübergehenden Einrichtungen für öffentliche Festlichkeiten mitzuarbeiten und Malereien und Skulpturen herzustellen, die nicht viel länger am Leben blieben als jene Schneestatue Michelangelos, sowenig konnte dieser daran denken, den Auftrag des ersten Mannes in Florenz als eine Kränkung seiner Ehre aufzufassen. Später hat Bandinelli durch eine liegende Schneestatue, die er als ein junger Mensch in Florenz aufführte, das erste Zeichen seines Talents für Bildhauerei gegeben. Michelangelos Arbeit in Schnee war es, welche Pieros Aufmerksamkeit in erhöhtem Maße auf ihn hinlenkte. Er sollte wieder im Palaste wohnen, wo ihm sein altes Zimmer zurückgegeben wurde und wo er nun wieder, wie einst zu Lorenzos Zeiten, an der Tafel der Medici speiste. Der alte Lodovico Buonarroti, der seinen Sohn mit Stolz in der Gesellschaft großer Herren sah, ließ es an vornehmen Kleidern für Michelangelo jetzt nicht fehlen. Wer weiß, ob dieser nicht selbst teilgenommen damals an dem Feste, zu dessen Verherrlichung vielleicht seine Schneestatue dienen sollte. Denn Piero liebte ein rauschendes Leben, wie sein Vater getan; die gedrückte Stimmung, die sich langsam über die Stadt hinlagerte, konnte doch nur erst stoßweise Macht gewinnen in den Gemütern, und das alte Leben ging äußerlich die gewohnten Wege weiter. Nirgends aber war man zuversichtlicher als im Palaste der Medici. Dort wurden mit kindlicher Ruhe die Ereignisse erwartet, und selbst dann zweifelte man noch nicht am Gehorsame des guten Glückes, als die Stadt durch eine Nachricht erschüttert wurde, die dem Gefühl vom Hereinbrechen eines ungeheuren Wechsels der Dinge völlig die Oberhand verlieh: es gelangte die Kunde nach Florenz von der ersten Niederlage der Neapolitaner.
Neapel hatte die größten Anstrengungen gemacht, das Ausbrechen des Krieges zu verhindern. Nachdem es jedoch die Vergeblichkeit seiner Schritte erkannt, wollte es den Vorteil haben, angreifender Teil zu sein. Der Herzog von Kalabrien, Sohn des regierenden Königs, rückte mit der Armee durch die päpstlichen Staaten in die Romagna vor, Don Federigo, der Bruder des Königs, segelte mit der Flotte auf Genua los. Neapel stand im Rufe einer streitbaren, für den Krieg vortrefflich geschulten Macht. Federigo hoffte Genua zu nehmen und den französischen Schiffen die Spitze zu bieten. In Livorno, dem befestigten Hafen der Florentiner, war er angelaufen, von Piero festlich empfangen und mit Lebensmitteln versehen worden. Die Erwartung Toskanas folgte dem Laufe seiner Galeeren.
Bei Rapallo unweit Genua landete er dreitausend Mann. Gegen diese zieht die Besatzung der Stadt nebst tausend Schweizern, und die Neapolitaner werden aufs Haupt geschlagen. Federigo wagt keinen zweiten Angriff, sondern eilt mit der Flotte nach Livorno zurück. Ganz Italien durchzitterte nach diesem ersten Verluste das Gefühl, daß Widerstand vergeblich sei.
Dieser panische Schrecken war möglich in einem Lande, in dem der Frieden Generationen hindurch nicht gestört worden war. Not und Gefahr sind die Regulatoren der höheren Sittlichkeit. Der Mensch muß sich einmal im Leben auf seine eigensten Kräfte angewiesen fühlen, ein Volk von Zeit zu Zeit den Besitz der Freiheit neu verdienen, und der Wert des einfachen, edlen Mutes, auf dem der allgemeine Zustand der Dinge beruht, muß, wenn sich nicht alles verwirren und auflösen soll, öffentlich zutage treten. Vielleicht war nichts so sehr an den traurigen Verhältnissen schuld, gegen welche Savonarola sich auflehnte, als der jeder kriegerischen Zucht entwöhnte Geist des italienischen Volkes.
Freilich lesen wir innerhalb des fünfzehnten Jahrhunderts von Kriegen in Italien. Sie wurden von gemieteten Soldaten geführt. Und wie schlug man sich in den Schlachten? Hundert Mann von dreitausend waren bei Rapallo auf dem Platze geblieben, das brachte das Land zum Zittern. Diese Zahl erschien enorm, sagt Guicciardini. Heute würde es kaum der Rede wert erscheinen. Aber man lese, was Guicciardini oder Machiavell von der italienischen Kriegführung des fünfzehnten Jahrhunderts erzählen, wie lange Feldzüge gemacht werden, ohne daß sich ein ernstlicher Zusammenstoß ereignet, und wie man furchtbare Schlachten schlägt, in denen kein Tropfen Blut vergossen wird. Wir hören von den alten Mexikanern, daß sie mit hölzernen Waffen in die Schlacht gingen, um ihre Feinde ja nicht zu töten, weil ihnen hinterher die eingebrachten Gefangenen gut bezahlt wurden. Ähnliche Erwägungen waren damals in Italien maßgebend.
Nationale Truppen kamen nur in den seltensten Fällen ins Gefecht. Die Regel war, daß ein Fürst oder eine Stadt ihren Bedarf auf dem Wege der Miete zusammenschaffte. Man befaßte sich nicht selber unmittelbar damit, sondern überließ das Geschäft, die Bewaffnung und Auszahlung des Soldes miteinbegriffen, einem oder mehreren Unternehmern, mit welchen ein Kontrakt abgeschlossen wurde. Dies war das Handwerk des hohen und niederen italienischen Adels. Sie machten Geschäfte in Soldaten. Die größeren Herren verhandelten mit den kleineren, diese mit noch geringeren, und so bis zum einzelnen Manne herunter. Venedig, Florenz, Neapel, Mailand und der Papst hatten ihre Armeelieferanten, welche bestimmte Kriege übernahmen und in der akkordierten Zeit die Besiegung der Feinde auszuführen versprachen. Diese Armeen durften meistens weder die Städte betreten, für die sie kämpften, noch sogar diejenigen berühren, welche sie erobert hatten. Sie waren gemeine und verachtete Werkzeuge und die Soldaten der Mehrzahl nach Gesindel, das sich aus allen Ländern zusammenzog.
Unter diesen Umständen konnte nicht gut von Begeisterung für eine gute Sache die Rede sein, nicht einmal von Feindschaft gegen die, denen man gegenüberstand. Man schlug sich mit der äußersten Bequemlichkeit. Meistens war es schwerbewaffnete Reiterei, die zu Felde zog. Diese konnte der Pferde wegen nur dann ausrücken, wenn Futter im Lande vorhanden war. Winters also kein Krieg. Wenn es aber dann im Frühling so weit kam, daß man sich nah genug stand und ein passendes Schlachtfeld vorhanden war, zu welchem Zwecke sich dann töten? Dies hätte niemanden Nutzen gebracht, während sich die Entrepreneure der Feldzüge gegenseitig nur das Geschäft verdarben. Um sich deshalb keinen Schaden zu tun, dennoch aber tapfer drauf loszuschlagen, wozu man sich ja eidlich verpflichtet hatte, gestaltete man die Schlachten zu großen Turnieren um, machte soviel als möglich Gefangene, nahm ihnen Roß und Rüstung ab und ließ sie wieder laufen. Fanden sie zu Hause neue Equipierung, so war wenig verloren. Armeen, die völlig geschlagen und vernichtet waren, konnten auf diese Weise ein solch hartes Schicksal erdulden, ohne einen Toten zu haben, und nach kurzer Zeit vollzählig und unversehrt wieder auf dem Kampfplatz erscheinen, als sei nichts vorgefallen. Aber es gab ein noch einfacheres Mittel, dem Feinde Niederlagen zu bereiten. Man kaufte ihm seine ganze Armee vor der Nase weg und vereinte sie entweder mit der eigenen oder bewegte sie wenigstens zum Abzuge. Kam es zum Kampfe, so war von Taktik keine Rede, noch weniger von Artillerie; man drang von beiden Seiten auf einander ein und suchte das Feld zu behaupten. Und diese Methode Krieg zu führen war so hergebracht in Italien und erschien zugleich so einfach und logisch, daß eine andere kaum möglich war. Schon zu den Zeiten Dantes schlug man sich so. »Herren«, redet vor der Schlacht von Campaldino der Feldherr die Florentiner an, »in unsern Schlachten pflegt ein guter Angriff den Sieg zu entscheiden; der Kampf ist kurz, wenige verlieren das Leben; es ist nicht gebräuchlich, sich totzuschlagen. Heute wollen wir es anders anfangen!« Aber die alte Sitte blieb. Welcher Schrecken, als man jetzt bei Rapallo einer Nation begegnete, die wirklich totschlug, was ihr nicht weichen wollte. Die Franzosen föchten wie die lebendigen Teufel, hieß es. Ebenso neu und erschreckend erschien die Art der Schweizer, die als französische Mietstruppen in geschlossenen Bataillonen standen wie bewegliche Mauern. Das furchtbarste aber war die französische Artillerie. Zum ersten Male sah man in Italien Kanonen anders als zum Festungskriege oder zum bloßen Staate angewandt. Statt der Steinkugeln, die früher aus ungeheuren eisernen Röhren geschleudert wurden, flogen jetzt eiserne Bälle aus bronzenen Geschützen, welche nicht auf von Ochsen gezogenen Fuhrwerken mühselig nachgeschleppt wurden, sondern mit Pferden bespannt und von einer wohleingeübten Mannschaft bedient, dem Heere gleichen Schrittes folgten. Mit verderblicher Genauigkeit schossen sie, ein Schuß folgte dem andern fast ohne Zwischenraum, und was sonst an langen Tagen geschah, war für sie in wenig Stunden zu erreichen.
Kaum war in Florenz die Niederlage bei Rapallo ruchbar geworden, als die Nachricht eintraf, daß Karl in der Lombardei stehe, daß ein Teil des französischen Heeres gegen die Romagna vorgegangen sei und sich der Herzog von Kalabrien zurückziehe. Piero hatte keine Armee in Toskana. Die Franzosen rückten darauf los. Karl hätte durch die Romagna gehen können, doch er erklärte, jede Abweichung vom geraden Wege nach Rom und Neapel widerspreche seiner königlichen Würde. Eine unheilerwartende Stimmung ergriff die Gemüter. Für Michelangelo aber trat zu den allgemeinen Ursachen der Besorgnis ein seltsames persönliches Erlebnis hinzu, dessen Einfluß ihn völlig überwältigte.
Piero hatte einen gewissen Cardiere bei sich, einen ausgezeichneten Lautenschläger und Improvisator. Piero selbst galt für einen Meister in dieser Kunst und pflegte sich jeden Abend nach beendigter Tafel darin zu üben. Dieser Cardiere kommt eines Morgens im Hofe des Palastes auf Michelangelo zu, bleich und verstört, zieht ihn beiseite und eröffnet ihm, Lorenzo sei ihm in vergangener Nacht erschienen, in schwarzen zerrissenen Kleidern, daß das nackte Fleisch durchgesehen hätte, und habe ihm befohlen, seinem Sohne Piero zu sagen, er werde in kurzer Zeit aus seinem Hause vertrieben werden, um niemals wieder zurückzukehren! Was Michelangelo meine, daß er tun solle?
Dieser gab ihm den Rat, dem Befehle zu gehorchen. Einige Tage darauf kommt Cardiere zu ihm, außer sich vor Erregung. Er habe nicht gewagt, den Herrn anzusprechen, nun aber sei ihm Lorenzo zum zweiten Male erschienen, habe das Gesagte wiederholt und ihm zu dessen Bekräftigung und zur Strafe des Ungehorsams einen Schlag ins Gesicht gegeben.
Jetzt redet ihm Michelangelo so dringend ins Gewissen, daß Cardiere auf der Stelle alles zu sagen beschließt. Piero war gar nicht in der Stadt, sondern in Carreggi. Cardiere macht sich dahin auf. Nachdem er eine Strecke gelaufen, kommt Medici mit seinem Gefolge entgegengeritten. Der unglückliche Dichter und Lautenschläger fällt ihm in die Zügel und bittet um Gotteswillen Halt zu machen und ihn anzuhören. Hierauf trägt er seine Sache vor. Piero lacht ihn aus und die übrige Gesellschaft desgleichen. Sein Kanzler Bibbiena, dessen Regierung ihn besonders verhaßt gemacht hatte (der spätere Kardinal, den Raffael gemalt hat, und dessen Nichte Maria er heiraten sollte), ruft Cardiere die höhnischen Worte zu: »Narr, glaubst du, Lorenzo gebe dir so viel Ehre vor seinem eigenen Sohne voraus und werde nicht ihm selber erscheinen statt dir, um so wichtige Dinge mitzuteilen, wenn sie wahr wären?« Damit lassen sie ihn stehen und reiten weiter, Cardiere kommt dann auch wieder im Palaste an, und indem er sich bei Michelangelo über sein Schicksal beklagt, erzählt er ihm noch einmal seine Vision in der lebendigsten Beschreibung.
Michelangelo erregte die Verblendung der Medici ebensosehr als der Inhalt der Erscheinung. Der Untergang der Familie erschien ihm unvermeidlich, eine plötzliche Furcht befiel ihn. Der Glaube an übernatürliche Winke der Vorsehung, der den Florentinern von Natur im Blute lag, steigerte sich im höchsten Maße durch die letzten Ereignisse. Was man jetzt erlebte, war die Erfüllung der Dinge, die Savonarola gepredigt hatte. Und dies erst der Anfang! Schrecklicheres hatte er vorausgesagt, dessen Eintreffen erwartet wurde. Und der Himmel deutete nicht allein durch seinen Mund die verhängnisvolle Zukunft an. Zeichen unzweifelhaften Inhalts kamen dazu, heilige Bilder und Statuen schwitzten Blut aus, in Apulien erblickte man nachts drei Sonnen zugleich am Himmel, in Arezzo sah man Tag für Tag Bewaffnete auf ungeheuren Rossen in der Luft sich bekämpfen und unter furchtbarem Getöse dahinziehen. Das Volk glaubte an diese Erscheinungen mit derselben Zuversicht, wie es tausend Jahre früher getan. Wie wir bei Sueton die Blitzschläge finden, die Cäsars Tod voraus verkündeten, so lesen wir in den florentinischen Autoren, wie dicht vor Lorenzo Medicis Tode aus heiterem Himmel ein betäubender Schlag herabfuhr und die Spitze von Santa Maria del Fiore zerschmetterte, wie die Löwen, welche öffentlich von der Stadt gehalten wurden, sich anfielen untereinander und zerfleischten, wie ein helleuchtender Stern über Carreggi stand, dessen Licht schwächer und schwächer ward, bis es im Momente verlöschte, in dem Lorenzos Seele entfloh.
Rechnet man dazu den Tod Polizians, der um diese Zeit in halbem Wahnsinn endete, während Marsilio Ficino Savonarolas Lehre ergeben war, sehen wir alle Welt unter dem Einflusse der übernatürlichen Furcht, welche die Gemüter bedrängte, und nur Piero mit wenigen Anhängern im Gegensatz zur allgemeinen Stimmung, so begreift sich, wie ein junger Mensch, der unabhängig genug ist, um als freier Florentiner keinen Herrn über sich anzuerkennen, sich von der Familie abwendet, die ihrem Geschick verfallen schien, und, um nicht in den großen Untergang mit hineingerissen zu werden oder für eine Sache kämpfen zu müssen, die er nicht als die gerechte anerkennt, endlich durch dies Zeichen besonderer Art zum Entschluß getrieben wird, in der Flucht sein Heil zu suchen. Zwei Tage schwankt er, ob er bleiben solle, am dritten verläßt er mit zwei Freunden die Stadt und flüchtet nach Venedig.
IV
Wären sie auf guten Pferden gerade durchgeritten, so hätte die Reise eine Woche in Anspruch genommen. Allein die Franzosen standen in der Romagna. Es mag also längere Zeit darauf hingegangen sein. Desto kürzer mußten sie sich in Venedig selbst fassen, nachdem sie es endlich erreicht. Michelangelo war der einzige, der Geld hatte, sehr bald ging seine Barschaft auf die Neige, und die Gesellschaft faßte den Entschluß, nach Florenz zurückzukehren.
So gelangten sie wieder bis Bologna, wo die Bentivogli die herrschende Familie waren. Diese hatten sich erst seit kurzer Zeit zu entscheidender Übermacht emporgeschwungen und wußten sich oben zu halten. Die ihnen feindlich gesinnten Häuser wurden durch Verbannungen oder auch Morde unschädlich gemacht, die Bürger durch strenge Gesetze und Abgaben im Zaume gehalten. Unter diesen Gesetzen befand sich eines, das in seltsamer Manier zur Ausführung kam: jeder Fremde mußte sich bei seinem Eintritte am Tore melden und erhielt als Legitimation ein Siegel von rotem Wachs auf den Daumen geklebt; wer es unterließ, verfiel in eine bedeutende Geldstrafe. Michelangelo und seine Freunde kamen wohlgemut, aber ohne Siegel auf den Daumen, in die Stadt, wurden gefaßt, vor Gericht geführt, zu fünfzig Lire Strafe verurteilt, und, da sie soviel nicht aufzubringen vermochten, einstweilen festgehalten.
Zufällig kamen sie in dieser bedrängten Lage einem der ersten Männer in Bologna zu Gesichte, einem Messer Gianfrancesco Aldovrandi, Mitgliede des großen Rates und Haupte einer angesehenen Familie. Dieser ließ sich den Fall vortragen, machte Michelangelo frei und lud ihn, als er gehört, daß er ein Bildhauer sei, zu sich in sein Haus ein. Michelangelo jedoch lehnte die Ehre ab. Er stehe nicht allein und könne seine Freunde nicht verlassen, welche auf ihn angewiesen seien; mit ihnen zusammen, zu dreien aber, wollten sie dem Herrn nicht beschwerlich fallen. »Oh«, rief Aldovrandi, »wenn die Dinge so stehen, da möcht' ich bitten, mich doch gleichfalls mitzunehmen und auf deine Kosten in der Welt herum spazierenzufahren.« Dieser Scherz ließ Michelangelo zu praktischeren Ansichten kommen. Er gab seinen Reisegenossen den Rest seines Geldes, nahm Abschied von ihnen und folgte seinem neuen Beschützer. Und dies war das Vernünftigste, was er hatte tun können, denn kaum waren einige Tage vergangen, so kamen die Medici, Piero und seine Brüder und was von Anhängern ihnen sonst gefolgt war, auf der Flucht in Bologna an, denn in Florenz war die Prophezeiung Lorenzos in Erfüllung gegangen.
Um dieselbe Zeit, wo Michelangelo sich nach Venedig fortgemacht, hatten die Franzosen die Toskana betreten. Der König, welcher wohl wußte, wie französisch gesinnt die Bürgerschaft war, wollte das Äußerste versuchen, ehe er als Feind aufträte. Er hatte noch einmal Durchzug verlangt, Piero ihn wiederum verweigert. Dies war eine Herausforderung. Ein Teil der Armee kam von Genua her das Meeresufer entlang, die Hauptmacht mit dem Könige marschierte von Pavia südlich auf die Apenninen los und überschritt sie da, wo auf dem schmalen Küstenlande genuesisches und florentinisches Gebiet aneinanderstießen.
Hier lagen eine Anzahl befestigter Plätze, die Lorenzo noch erworben hatte, und die jetzt, von Pieros Leuten besetzt, wenn sie Widerstand leisteten, ganz Toskana verschlossen halten konnten. Die Gegend war sumpfig, kalt und ungesund. Lebensmittel mußten von weitweg auf Schiffen herbeigeführt werden. Die Truppen des Königs bestanden größtenteils aus gemietetem, zu Meuterei geneigtem Volke, unter dem es bereits zu gewaltsamen Unruhen gekommen war; ein Aufenthalt an dieser Stelle wäre den Franzosen verderblicher als eine verlorene Schlacht gewesen.
Pieros Lage war also nicht allzu verzweifelt. Er hatte die Orsini mit einigen Leuten im Lande, um den bedrohten Festungen Entsatz zuzuführen. Gegen Obigni, der aus der Romangna heranzog, schützten ihn wohl zu verteidigende Gebirgspässe. Er hätte den Mut nicht zu verlieren brauchen.
Aber er war nicht Herr seiner Stadt. Florenz merkte immer mehr, daß der König nur gegen die Medici und nicht gegen die Bürger Krieg führe. Karl hatte von Anfang an, als Piero sich gegen ihn erklärte, die Florentiner Kaufleute in Lyon unbelästigt gelassen, nur die Medici zwang er, ihre Bank zu schließen. Es ist gesagt, wie die vornehmen Florentiner in Frankreich selbst zum Kriege drängten. Man erwartete Karl wie einen Befreier. Schon im Jahre 93 hatte Savonarola, aufgefordert von der Regierung, ein Gutachten über die beste Form einer Regierung für die Stadt abgegeben und darin mit schneidender Schärfe die Gelüste Pieros dargestellt, wenn er auch, statt den Namen zu nennen, nur im allgemeinen einen Fürsten beschrieb, wie er etwa herrschen würde und herrschen müßte, wenn er sich zum Tyrannen einer freien Stadt aufwürfe. Es ist eine brillante Schrift, die, mit kaltem, staatsmännischen Blicke, aber auch mit der leidenschaftlichen Energie der Partei abgefaßt, ebensosehr die augenblickliche Lage charakterisiert, wie zwanzig Jahre später Machiavellis Buch vom Fürsten ein Bild der so völlig veränderten Zustände gewährt.
Savonarolas Macht wuchs zusehends in jenen Tagen. Politik und Theologie waren eins für ihn. Er drängte sich nicht mehr auf, als man ihn suchte. Der Haß gegen die Medici ging immer unverhüllter einher. Piero mußte einen äußersten Entschluß fassen, wenn er sich halten wollte.
Der Herzog von Montpensier mit dem Vortrabe der königlichen Armee war zuerst diesseits der Apenninen angekommen und vereinigte sich mit den von Genua heranziehenden Truppen. Er bombardierte Fivizzano, den ersten jener kleinen florentinischen Plätze, schoß Bresche, stürmte und ließ die Besatzung und die Einwohner bis auf den letzten Mann zusammenhauen.
Immer war noch nichts verloren und Toskana unter dem Schurze der übrigen Festungen so sicher wie früher, allein die Nachricht von den Greueltaten der Franzosen versetzte Florenz in Gärung. Piero faßte zum ersten Male seine Lage ins Auge, wie sie war. Er sah sich verlassen und verraten. Es fehlte ihm an Geld; er wollte borgen, aber seine besten Freunde machten Schwierigkeiten und zeigten sich unerbittlich. Von Neapel war keine Hilfe zu erwarten, auf Alexander Borgia kein Verlaß, in Pisa regten mailändische Agenten das Volk zur Empörung auf, denn Sforza wollte die ganze Küste Toscanas, Lucca, Livorno und Pisa in seine Gewalt bringen; er war es, der den König am meisten auf Toskana losgehetzt hatte. In Pisa befand man sich auf nichts vorbereitet, Piero ließ in aller Eile die Zitadelle wenigstens mit Munition versehen; aber was in Florenz selber beginnen, das keine andere Besatzung hatte als seine eigenen bewaffneten Bürger, und wo die Empörung ihr Haupt erhob? Piero tat in dieser Lage einen Schritt, der, wenn er besseren Erfolg gehabt hätte, als die Tat eines entschlossenen Mannes gelten müßte, welcher im Gefühl seiner Lage das letzte Rettungsmittel anzuwenden wagt, der aber, da er leider zum Unheil ausschlug, anders beurteilt worden ist: er gab sich unbesiegt dem König in die Hände.
Wäre er nach Neapel oder Venedig geflüchtet, den einzigen Orten, die ihm offen standen, so hätten die Florentiner alsbald mit Karl dem Achten Frieden gemacht, ihm die alte Würde des Beschützers der florentinischen Freiheit neu übertragen und ein Bündnis geschlossen, das die Medici für immer der Herrschaft beraubte. Viel besser, dem Könige zu Füßen zu legen, was man noch besaß, und vielleicht als Preis von ihm zu verlangen, was Neapel nun nicht mehr verschaffen konnte.
Piero wollte als Herzog von Florenz in die Stadt zurückkehren, als er die Führung einer Gesandtschaft übernahm, die im Namen der Regierung mit dem Könige unterhandeln sollte. Unterwegs hörten sie, wie Paolo Orsini vergebens den Versuch gemacht, sich mit dreihundert Mann nach Sarzana zu werfen. In Pietrasanta ließ Piero seine Begleiter zurück und verfügte sich unter französischer Bedeckung allein ins Hauptquartier nach Pontremoli.
Das Erscheinen des großen Lombarden, unter welchem Namen Piero nach seines Vaters Vorgang in Frankreich bekannt war, wo alle Italiener für Lombarden galten, erregte Erstaunen im Lager. Noch größeres die schmählichen Anerbietungen, die er machte. Das von seinem Vater erst erworbene und mit ungeheuren Kosten befestigte Sarzana, das Montpensier vergeblich berannte, die anderen Festungen, Livorno und Pisa dazu, wollte er freiwillig überliefern. Florenz sollte sich mit Karl verbünden, unter seine Obhut treten und 200 000 Dukaten zur Fortführung des Krieges leihen.
Auf diese Bedingungen hin wurde Piero zu Gnaden angenommen; was er für sich selbst verlangte und wohl zugestanden erhielt, zeigte sein Auftreten in Florenz, wohin er sich jetzt zurückzukehren anschickte, und zwar in Begleitung seiner Truppen, deren er gegen die Franzosen nicht mehr bedurfte. Allein vor ihm war die Gesandtschaft dort wieder eingetroffen, an deren Spitze er ausgezogen war, und hatte berichtet, was geschehen war. Pieros eigenmächtiges Verfahren, das in seinem völligen Umfange nicht einmal bekannt sein konnte, erregte eine Indignation, von der jetzt auch die treuesten Anhänger der Medici mit fortgerissen wurden. Dennoch hielt man sich ihm gegenüber in den Grenzen. Eine zweite Gesandtschaft wurde sogleich ernannt und Piero abwesend zu ihrem Mitgliede gewählt. Fünf Männer, darunter Savonarola. Er war es, der in Lucca, wo sie den König bereits antrafen, das Wort führte. Er sprach von der Freiheit und Schuldlosigkeit des florentinischen Volkes und verlangte bestimmte Zusicherungen. Karl gab ausweichende Antwort. Savonarolas Ruf war längst nach Frankreich gedrungen, und der König scheute den Mann, verehrte ihn vielleicht, aber er hatte sich mit Piero zu tief eingelassen. Dieser, der sich noch bei ihm befand, sobald er die Fünfe erscheinen sah, wußte, wie die Dinge in Florenz standen. Unter dem Vorwande, vorauszueilen und den Empfang des Königs in Pisa vorzubereiten, beurlaubte er sich und eilte nach Florenz. Paolo Orsini trieb zusammen, was von Soldaten im Moment aufzubringen war, und folgte ihm.
Am 8. November abends war Piero zurück in der Stadt, am 9. morgens erschien er vor dem Palast der Regierung. Er wollte eintreten, die große Glocke läuten, das Parlament berufen und die Verfassung stürzen. Einer der angesehensten Bürger, Luca Corsini, trat ihm entgegen und riß ihn zurück. Was er hier zu tun habe? Piero sah sich und seine Gefolge auf den Platz hinausgedrängt, das Volk stand in dichten Gruppen umher und sah mit an, was daraus würde. Einzelne Stimmen riefen ihm zu, er möge mit Gott gehen, wohin er Lust habe. Plötzlich erhob sich daraus ein Rufen, ein Geschrei, Libertà, libertà, popolo, popolo, die Kinder riefen zuerst und warfen mit Steinen auf den Medici und die ihn begleiteten. Niemand hatte Waffen, aber die Haltung des Volkes und das Geschrei erschütterten Piero, daß er zurückwich. Nun kam der Polizeimeister mit seinen Leuten und versuchte den Platz zu säubern. Das war das Zeichen des Ausbruchs. Die Wut wandte sich gegen ihn, der Palast der Polizei wurde gestürmt und die Gefangenen in Freiheit gesetzt.
Piero war im Palaste Medici wieder angelangt und sandte Boten an Paolo Orsini, der in der Nähe der Stadt lagerte. Aber auch die Herren von der Regierung fühlten, daß sie handeln müßten. Die Sturmglocke wurde gerührt, und aus allen Teilen der Stadt strömten die Bürger in Waffen auf den Platz zusammen. Dahin versuchten jetzt die Medici noch einmal vorzudringen.
Giovanni, der Kardinal, nachmals Leo der Zehnte, dessen freundliches Benehmen von jeher gegen das stolze Auftreten Pieros angenehm abstach und der den Bürgern der liebste der drei Brüder war, sollte zuerst erscheinen und das Volk anreden, Piero mit Giuliano und Orsini wollten mit den Truppen nachfolgen. Aber Giovanni ward zurückgestoßen, ehe er den Platz erreichte, auf die anderen, als sie mit den Truppen erschienen, wurde aus den Fenstern mit Steinen geworfen, und sie wagten sich nicht weiter vorwärts. Das Volk greift an. Giovanni flüchtet nach San Marco, dort abgewiesen, rettete er sich als Mönch verkleidet aus den Toren der Stadt. Piero mit den Seinigen folgt ihm. Noch einmal versuchen sie in den Vorstädten Geld auszuwerfen und das niedrige Volk, das da vorzugsweise wohnte, zur Empörung aufzureizen, aber als man ihnen auch hier mit Steinwürfen erwidert, eilen sie rascher vorwärts, bis eine förmliche Flucht daraus wird. Und so ging es fort nach Bologna.
V
So begegnete Michelangelo seinen Beschützern wieder, die von Bentivoglio mit Vorwürfen empfangen wurden. Persönlich hätten sie durch ihre Flucht ohne tätlichen Widerstand sich selbst geschadet, durch ihre Niederlage zugleich allen anderen Familien, die sich in ähnlicher Stellung befanden, das schlechteste Beispiel gegeben. Bentivoglio dachte dabei an sein eigenes Haus. In späteren Zeiten hätten es ihm die Medici Wort für Wort zurückgeben können, denn sein Schicksal gestaltete sich nicht besser als das ihrige. Die Brüder, die sich in Bologna nicht sicher fühlten, gingen nach kurzem Aufenthalte weiter nach Venedig, Michelangelo blieb im Palaste Aldovrandi, denn jetzt nach Florenz zurückzugehen, war nicht ratsam. Messer Gianfrancesco behandelte ihn auf ehrenvolle Art. Michelangelos ganzes Wesen, die Vielseitigkeit seiner Natur, gefielen ihm. Abends mußte er an seinem Bette sitzen und ihm ein Stück Dante oder Petrarca, auch wohl etwas aus den Novellen des Boccaccio vorlesen, bis er einschlief.
Auch künstlerische Beschäftigung fand sich. Bologna ist berühmt unter den italienischen Städten durch den Leichnam des heiligen Dominikus, den es besitzt. Der Sarg, welcher in der Kirche von San Domenico die Gebeine umschließt, stammte aus der Werkstätte Niccolo Pisanos, der als der Gründer der neueren Skulptur in Italien betrachtet wird. Er zuerst ahmte die Antike wieder nach und wußte, während die gleichzeitige Malerei noch in den festen Formen der Byzantiner gefangen lag, sich zu eigner Anschauung der Natur freizumachen.
Niccolos Arbeit ist aus einem einfachen Marmorkasten durch spätere Unter- und Aufbauten heute zu einem hohen Monumente geworden. Ununterbrochen seit dem dreizehnten Jahrhunderte, in welchem es entstand, wurde neuer Marmorschmuck zum alten hinzugefügt. Als Michelangelo nach Bologna kam, war kurz zuvor der Bildhauer gestorben, dessen Hauptarbeit sich auf dieses Denkmal so sehr konzentriert hatte, daß er davon den Beinamen erhielt: Niccolo dell'Arca. Nun bedurfte es eines Nachfolgers für Vollendung der begonnenen Skulpturen. Messer Aldovrandi führte Michelangelo nach San Domenico und fragte ihn, ob er sich die Arbeit zu unternehmen getraue. Herzustellen waren zunächst zwei Figuren, von denen die eine, der heilige Petronius in Bischofstracht, halb vollendet war, während die andere, ein kniender Engel, welcher einen Kandelaber hält, als Pendant eines bereits vorhandenen, noch ganz fehlte. Michelangelo sagte, er getraue es sich wohl. Man gab ihm dreißig Dukaten dafür.
Lange Zeit ist seltsamerweise Niccolos Engel für Michelangelos Arbeit gehalten worden: ein reizendes Figürchen, ganz im Stile des fünfzehnten Jahrhunderts, von zarter Natürlichkeit, während Michelangelos Werk, das auf den ersten Blick wenig Anziehendes hat, noch heute in Bologna Niccolo zugeschrieben wird. Es ist die Arbeit eines Anfängers, scheint trotzdem aber gleich solche Beachtung gefunden zu haben, daß es die Ursache wurde, warum Michelangelo Bologna wieder verlassen mußte.
Die Eifersucht einheimischer Handwerker gegen fremde ist eine gewohnte Erscheinung, in Sachen der Kunst aber kann sie sich leicht zum Haß steigern. Vasari spricht oft von dergleichen. Die Bologneser Künstler waren berüchtigt wegen ihrer feindseligen Gesinnung gegen fremde, ein Tadel, der auch denen von Perugia anklebte. Der ehrenvolle Auftrag, welcher Michelangelo, diesem hergelaufenen Florentiner von zwanzig Jahren, zuteil ward, erregte solche Empörung, daß es zu Drohungen kam. Ein Bolognesischer Bildhauer erklärte, ihm hätte diese Arbeit gebührt, ihm sei sie zuerst versprochen und durch Michelangelo nun entwandt worden; er möge sich in acht nehmen. Sicherlich war es nicht dieser Einzige allein, mit dem er zu tun gehabt hätte, und er zog es vor, in seine Vaterstadt zurückzukehren.
Was Michelangelo in diesem Entschlusse bestärken mußte, waren die festeren Zustände, die sich während seiner Abwesenheit in Florenz wieder gebildet hatten. Wie aber fand er alles verändert! Er hatte die Stadt verlassen, ehe von der Macht der Medici auch nur ein dünner Zweig abgeknickt war, und jetzt sah er den vollen Baum, der so weit hin seine Schatten streckte, bis auf die Wurzeln vertilgt. Der Palast der Familie stand leer und seiner Kunstschätze beraubt. Eine Partei hatte die Herrschaft in Händen, in deren Ohren es schon wie Verrat klang, wenn der Name der Medici anders als mit feindlichem Akzent, ausgesprochen ward. Der Garten von San Marco war verwüstet, seine Statuen und Bilder meistbietend verkauft und in alle Welt zerstreut. Von den Künstlern hatten viele die Stadt verlassen, andere verdammten als Anhänger Savonarolas, was sie früher so frei und fröhlich geschaffen hatten. Lorenzo di Credi, Verrocchios Schüler und Leonardos Freund, Baccio della Porta, bekannter als Fra Bartolommeo, Cronaca, der Architekt, und Botticelli, Filippo Lippis Schüler, kämpften mit ihrem Gewissen, ob die Arbeiten, die sie so schön hervorgebracht hatten, nicht Werke des Teufels wären. Und dementsprechend wurde die öffentliche Sittlichkeit mit unnachsichtlich scharfem Blicke bis ins Innere der Familien hinein von Staats wegen aufrecht erhalten.
Dies war die Frucht der Ereignisse, welche während des Jahres sich zugetragen hatten, das Michelangelo in Bologna verlebte.
In derselben Stunde, in der Florenz sich empört hatte und Piero geflüchtet war, kam der Aufstand in Pisa zum Ausbruch. Hier aber wurde nicht gegen die Medici, sondern gegen das Joch der Florentiner rebelliert, das auf der unglücklichen Stadt unerträglich gelastet hatte. Es war die ausgesprochene Politik von Florenz, Pisa langsam zugrunde zu richten. Mit flehentlichen Worten wandten sich jetzt seine Bürger an den König von Frankreich und baten um Schutz, den er zusagte. Karl übersah nirgends die Situation, überblickte nirgends die Verpflichtungen, welche das, was er im Feuer des Augenblickes aussprach, ihm selber auflegte. Er war jung, gutmütig und im Rausche des Glückes befangen, das mit unermüdlicher Treue seine Schritte begleitete. Klein und zwergenhaft nennt ihn Guicciardini, mit sechs Zehen an jedem Fuße – ein Monstrum; aber der kühne Blick verriet den König, setzt er hinzu. Allen Einflüssen zugänglich, fortwährend von mächtigen, ränkevollen Männern umgeben, die sich untereinander haßten und zu vernichten strebten, und denen allen er abwechselnd günstiges Gehör lieh, widersprach er sich frischweg in Entschlüssen und feierlichen Zusagen, und trotzdem, so lange das gute Glück bei ihm aushielt, gelang ihm das Unmögliche: allen gerecht zu werden. Jetzt garantiert er den Pisanern ihre Freiheit, und in demselben Atem besteht er darauf, daß die florentinischen Gerichtsbeamten dort in ihren Stellen blieben und man ihnen Gehorsam leiste. Dies nämlich hatte er Piero dei Medici zugesagt.
In Pisa teilte sich die französische Armee. Der Kardinal Vincula ging mit der Flotte nach Ostia, seiner Stadt, die er besetzt hielt, um die Borgia im Gebiet der Kirche von dort aus anzugreifen. Von der Landarmee marschierte der größere Teil des Heeres südlich nach Siena ab, die andere Hälfte begleitete den König nach Florenz, um mit ihm feierlich dort einzuziehen. Dafür kam nun auch Obigni aus der Romagna über die Berge hinüber.
Noch während Karl in Pisa verweilte, waren in Florenz die Medici zu Rebellen und Feinden des Vaterlandes erklärt worden. Ihre Paläste und die ihrer Ratgeber hatte das Volk gestürmt und geplündert, nur mit Mühe gelang es, den Hauptpalast der Familie zu retten, in dem Lorenzos Witwe und Pieros Gemahlin zurückgeblieben waren. Diesen beiden Frauen geriet nun der König in die Hände, der im Palaste Medici abstieg und dort mit seinem Gefolge, nebenbei bemerkt, all die Kostbarkeiten sich aneignete, die von dem ersten Sturm noch gerettet worden waren; er machte der Form wegen alte Forderungen geltend, welche Frankreich an die Medici hätte. Zugleich aber wirkten dennoch die Tränen und Bitten zugunsten Pieros und die Anklage gegen das unzuverlässige florentinische Volk. Karl hatte den Bürgern, bevor er in prachtvoll feierlichem Zuge die Stadt betrat, fest zugesagt, daß er alles billige, was geschehen sei, hatte sich von der neuen Regierung der Stadt empfangen und in den Dom führen lassen, umdrängt vom Volke, das Francia! Francia! jauchzte, und endlich, im Palaste der Medici abgestiegen und allein mit Clarice und Alfonsina, ließ er sich soweit bringen, daß Eilboten nach Bologna gesandt wurden, Piero möge zurückkehren, der König werde ihn in seine Stelle wieder einsetzen. Aber die Medici waren längst nach Venedig weiter. Nun verlangte er von der Stadt ihre förmliche Rückberufung und die Aufnahme einer stehenden, französischen Besatzung. Die Lage war eine kritische. Florenz angefüllt von den Rittern und den Mietstruppen des Königs, deren Übermut zu Reibungen führte. Italienische Gefangene, welche die Franzosen wie gebundenes Vieh durch die Straßen zerrten, wurden von florentinischen Bürgern gewaltsam befreit. Im Palaste wollten die Verhandlungen zu keinem Ende führen. In betreff der Medici gab Karl zuletzt nach, aber die Summe, die er als Zuschuß in seine Kriegskasse forderte, war übermäßig. Er bestand auf seiner Forderung. »Gebt ihr nicht nach«, rief er abbrechend aus, »so lasse ich meine Trompeten blasen!« »Und wir läuten unsere Glocken!« rief Pier Capponi in einem Tone dagegen, der nicht weniger drohend klang, zerriß den eben aufgesetzten Kontrakt und wandte sich mit den anderen Bürgern, von denen keiner seine Kühnheit verleugnete, zum Fortgehen.
Bis an die große Treppe des Palastes ließ sie der König gelangen, da rief er Capponi zurück, der von Lyon her sein Bekannter war, machte einen Scherz aus der Sache und tat, als ließe er ihm auf die alte Freundschaft die Worte hingehen, die späterhin in Florenz solche Berühmtheit erlangten, daß heute kein Florentiner ist, der von jener Begegnung nicht zu erzählen wüßte. Man vereinigte sich zu einem billigeren Vertrage, welcher feierlich beschworen ward. Karl nahm den Titel »Wiederhersteller und Schutzherr der florentinischen Freiheit« an, die Stadt führte seine Fahne, er zog ab, nur die von Piero übergebenen Städte behielt er bis zur Eroberung Neapels. 120 000 Goldgulden wurden beigesteuert, ein neuer Handelsvertrag mit Frankreich vereinbart. Die Medici sollten das Recht haben, ihre Angelegenheiten in der Stadt zu ordnen, natürlich aber nicht in eigner Person. Am 28. November 1494 zog Karl nach Siena ab. Ein gärendes Chaos von Begeisterung, Ehrgeiz, Eigennutz, Fanatismus und gutem Willen blieb zurück und strebte aus sich selbst nach fester Gestaltung.
Diese zu gewinnen, war keine leichte Sache. Man hatte die Medici verjagt und dennoch die Regierung, die von ihnen selbst aus ihren eigenen Anhängern gebildet worden war, im Amte gelassen. Diese Herren hatten sich ja im Sturme der allgemeinen Empörung an die Spitze des Aufruhrs gestellt, ihr Benehmen erschien bei so uneigennütziger Handlungsweise nur um so leuchtender. Nach dem Abzuge Karls beriefen sie ein Parlament, das dem Herkommen nach eine Zahl Männer mit diktatorischer Macht behufs Neubesetzung der Staatsämter ausrüstete. Die Mitglieder der alten Regierung wurden gewählt und ihnen dadurch abermals das höchste Vertrauen bewiesen. Unterdessen waren diese aber und überhaupt die Freunde der Medici zur Besinnung gekommen. Sie fühlten, daß sie übereilt gehandelt hätten, und sahen sich im Besitze der Gewalt. Notorische Persönlichkeiten, die als Gegner der Medici bekannt waren, wurden nun bei Verteilung der Stellen übergangen. Eine Anzahl der größten Familien mit mächtigen Männern an der Spitze fühlten sich gekränkt. Die Bürgerschaft fing an unruhig zu werden. Savonarola hatte auch seine Pläne. Die anderen dachten nur an sich selber, er aber an die Sache, der er sich geweiht hatte.
Seine Predigten begannen wieder in den Fasten des Jahres 95. Er drängte auf eine totale Änderung der Dinge. Geistig und politisch wollte er die Stadt umschmieden. Er deutete unablässig auf die wunden Stellen. Er hatte das Größte, eine Umgestaltung Italiens, im Auge und fing beim Kleinsten, beim Herzen jedes einzelnen seiner Zuhörer mit der Reform an. Er predigte Güte und Versöhnlichkeit, aber wehe denen, die seinen Worten nicht Folge leisteten! Seiner Idee nach sollte an der Spitze des Staates der Wille einer Versammlung aller stimmfähigen Vollbürger als höchste Gewalt stehen. Es mochten auf ganz Florenz gegen 2000 Männer kommen, die im Genuß des Bürgerrechts in diesem Sinne waren. Diese sollten sich als großer Rat, consiglio grande, im Palaste der Regierung versammeln und der Beschluß der Majorität der Souverän von Florenz sein.
Noch vor der Mitte des Jahres war die Partei der Medici aus der Regierung und aus ihren Stellen verdrängt, und das Consiglio grande konstituierte sich. Alles tat Savonarola. Er lenkte die Majorität, der er im Namen Gottes seine entscheidenden Befehle zukommen ließ. Francesco Valori und Paolantonio Soderini, Anhänger seiner Lehre und erbitterte Gegner der Medici, beide zuerst bei der Stellenausteilung übergangen, standen als die Führer der herrschenden Partei mit ihm als die mächtigsten Männer im Staate da. Zwei Zielpunkte hatten sie im Auge. Nach innen, Durchführung der Reform; nach außen, Wiedererlangung Pisas und der übrigen Städte, die sich in der Gewalt der Franzosen befanden; denn obgleich Florenz keine französische Besatzung in seinen Mauern hatte: solange Pisa und Livorno Frankreich gehörten, war auch Florenz von ihm abhängig.
Karls Vordringen nach Neapel war ein Triumphzug. Fast alle französischen Kriege in Italien haben mit blendendem Siegesglanze begonnen und mit Unterliegen geendet. Machiavelli sagt von den Franzosen seiner Zeit, was Cäsar schon von den alten Galliern geurteilt: beim ersten Angriffe wären sie mehr als Männer, beim endlichen Rückzuge weniger als Weiber
In Rom schloß der König mit dem Papste zärtliche Freundschaft. Von da ging er weiter nach Neapel. Ende Februar hielt er seinen Einzug, das Volk hatte zu seinen Gunsten rebelliert und die Aragonesen davongetrieben. Die Neapolitaner haben ein Bedürfnis nach frischen Königen, urteilt Guicciardini. Karl wurde mit überschwenglichen Freudenbezeugungen aufgenommen.
Bis zu diesem Tage hatte es noch keiner Schlacht bedurft. Die Tore taten sich auf, wo er sich zeigte. Allein nun kam der Rückschlag. Vor ihm war alles gewichen, hinter ihm schloß es sich wieder zusammen. Lodovico Sforza war der erste, der abfiel. Statt Livorno und Pisa ihm zu geben, hatten die Franzosen die Städte selbst behalten. Venedig, der Römische König, Spanien und der Papst machten gemeinschaftliche Sache mit Mailand. Eben noch hatte ganz Italien glatt und sanft zu des Königs von Frankreich Füßen gelegen, und jetzt galt es, sich mit Gewalt den Rückweg durch ein feindliches Land zu bahnen. Karl nahm den Kampf an. Einen Teil der Armee ließ er in Neapel zurück, der durch die Flotte mit Frankreich in Verbindung blieb, mit der anderen Hälfte kehrte er um, auf Rom wieder los. Eben noch hatte er Kuß und Umarmung mit dem Papste getauscht, davon war diesmal keine Rede mehr. In ganz Italien hatte der König nur einen Bundesgenossen, und das waren die von Savonarola geleiteten Bürger von Florenz, bei denen alle Anstrengungen der übrigen Mächte, sie zum Anschluß an das große Bündnis herüberzuziehen, vergeblich blieben.
Der Mut Karls aber und sein Stolz litten nicht unter diesem Wechsel der Umstände. In Siena erwartete ihn eine Gesandtschaft der Florentiner. Sie boten ihm Geld und Mannschaften an. Er antwortete, seine eigenen Leute genügten ihm, Herr über seine Feinde zu werden. Noch einmal trat ihm Savonarola entgegen. Das Evangelium in der Hand haltend, beschwor er ihn, die Strafe des Himmels zu fürchten und Pisa herauszugeben. Der König wich aus. Er konnte sein Wort nicht beiden Parteien zugleich halten. Sogar mit den Medici stand er aufs neue in Verkehr. Piero befand sich damals in seinem Gefolge und hoffte durch ihn in die Stadt zu gelangen, in der seine Freunde als geordnete Partei der Savonarolas entgegenstanden und die Rückkehr ihres ehemaligen Herrn vorbereiteten.
Ohne Florenz zu berühren, ging Karl nach Norden weiter. Endlich kam es zur ersten Schlacht in diesem Kriege. Bei Fornuovo am Taro stellte sich ihm das Heer der Verbündeten entgegen und suchte ihn aufzuhalten. Beide Teile schrieben sich den Sieg zu, die Franzosen mit größerem Rechte, denn sie schoben den Feind zur Seite und machten sich den Weg nach Piemont frei. Am 6. Juli geschah dies im Norden Italiens, am 7. Juli kam im Süden Neapel schon wieder in die Gewalt der Aragonesen. Es stand bedenklich mit der französischen Sache. Erst jetzt erlangten die Florentiner, daß den Besatzungen der toskanischen Städte Befehl zum Abzuge gegeben ward.
Der Kommandant von Pisa aber weigerte den Gehorsam. Die Bitten der Pisaner, ihr Gold, die Tränen eines schönen Mädchens, das die Erhaltung der Freiheit zum Preis ihrer Liebe machte, endlich: entgegengesetzte Verhaltungsbefehle aus der Nähe des Königs selber brachten es dahin, daß den Florentinern die Tore geschlossen blieben. Nur Livorno wurde ihnen eingeräumt; die übrigen Festungen verkauften die Franzosen an Lucca oder Genua. Florenz mußte sich mit Gewalt sein Recht verschaffen. An der Allianz mit Frankreich hielt man fest, aber Pisa mußte erobert werden. Savonarola feuerte dazu an, er verhieß die Wiedereinnahme der Stadt im Namen Gottes, der auf seiten des Volkes stände.
Die Pisaner, gefaßt auf den Abzug der Franzosen, der kurz oder lang dennoch erfolgen mußte, wandten sich an Venedig und an Lodovico Sforza. Beide unterstützten die flehende Stadt, weil beide sie für sich selbst zu gewinnen hofften. Dieser Kampf der Pisaner um ihre Freiheit, diese verzweifelte Anstrengung, sich aus der Schwäche emporzuraffen, in die sie durch die Florentiner immer tiefer versenkt worden waren, muß jedem das Herz ergreifen, der die Ereignisse näher betrachtet. Wenige Städte haben so bis auf das Äußerste ihre Mauern verteidigt. Aber Savonarola rührte das nicht. Pisa war sein Karthago, das vernichtet werden müßte. Keine Spur von Mitleid in seinen Worten, wenn er von der Unterjochung der Stadt als der Belohnung des Himmels redet und die Bürger anfeuert, auszuhalten und der französischen Politik treu zu bleiben. Er hatte den Staat wie weichen Teig in den Händen, was er wollte, wurde angenommen. Er besaß eine wunderbare Gewalt, die natürlichsten, nüchternsten Reden zu unwiderstehlichem Fluß aneinanderzuketten. Sprichwörter, Fragen mit Antworten darauf, dazwischen pathetische Begeisterung, Bibelstellen, Nutzanwendungen überraschender Art, aber immer für das handgreifliche Verständnis ausgearbeitet, stehen ihm in drängender Fülle zu Gebote. Er war die Seele der Stadt. Wie eine gut geschriebene Zeitung heute ihrer Partei die Gedanken zufließen läßt, die sie bedarf und verlangt, so übernahm Savonarola, die tägliche Gedankenzehrung der Florentiner zu befriedigen, und seine Vorräte schienen unerschöpflich. Er sprach in kurzen Sätzen. Ohne schmückende Beiwörter, rasch und praktisch, wie man auf der Straße redet, aber zu hinreißendem Zuge verbindet er die Gedanken. Und da es nur einige wenige Punkte sind, auf die er stets zurückkommt, wie er sie von Anfang an gepredigt hat, so sagt er den Leuten nichts Neues, was sie erst frisch aufzufassen und zu bedenken hätten, sondern wiederholt nur mit immer neuer Kraft ihre eigenen alten Überzeugungen. Mitten unter den Prophezeiungen und den Erklärungen der höchsten Dinge erteilt er Befehle über Kleidung, Sitte und Betragen und gibt politische Verhaltungsregeln für die nächsten Tage, wie sie gerade von der Lage der Dinge erfordert werden. Savonarola besaß den alten Takt der Männer des Volkes, die mit den Massen umzugehen wissen und mitten in der Begeisterung nie die gemeine Deutlichkeit verlieren. Nur daß bei ihm endlich die Begeisterung zum Fanatismus wurde.
In solche Zustände trat Michelangelo ein, als er von Bologna zurückkam. Sie waren trüb und drückend, aber es wurde noch von Künstlern gearbeitet und von reichen Leuten gekauft. Er richtete sich sogleich eine Werkstätte ein. Auch fand sich ein Beschützer für seinen Genius, und sogar ein Medici war es, der sich seiner annahm.
Der alte Cosimo hatte einen Bruder gehabt, der früh starb und ein großer Freund der Gelehrsamkeit gewesen war. Seine Nachkommen lebten in Florenz und wurden von der regierenden Linie stets mit Mißtrauen beobachtet. Piero ging so weit, seine beiden Vettern Lorenzo und Giovanni, die allerdings in Florenz sowohl als an auswärtigen Höfen gegen ihn intrigierten, gefangen setzen zu lassen, und war nur mit Mühe dahin zu bringen gewesen, das Gefängnis in die Verbannung auf eine Villa zu verwandeln, deren Grenzen sie nicht überschreiten durften. Nach Frankreich entflohen, kehrten sie im Gefolge Karls zurück. Nach dem Sturze Pieros traten sie wieder in die Stadt ein, legten, um dem Volke zu schmeicheln, den Namen Medici ab und nannten sich Popolani, ganz wie Orleans unter ähnlichen Umständen sich einst Egalité genannt. Reich und durch ihre Frauen mit dem höchsten Adel Italiens verwandt, lebten sie seitdem in Florenz und suchten sich durch Eifer für seine Freiheit hervorzutun.
Lorenzo nahm sich Michelangelos an und gab ihm Arbeit. Er ließ einen heiligen Johannes in kindlichem Alter, einen San Giovannino wie Condivi sagt, von ihm ausführen, und es hat sich neuerdings auch eine Statue gefunden, welche Anspruch erheben durfte, als dieser Giovannino anerkannt zu werden. In einem vornehmen Hause in Pisa auftauchend, ist sie in das Berliner Museum gelangt und hat sowohl durch ihre Schönheit als durch offenbare Zeichen, welche ihre Herkunft zu bestätigen scheinen, Aufsehen erregt. Johannes, eine zarte Knabengestalt, steht so unschuldig da, die Ähnlichkeit mit anderen Werken Michelangelos ist so offenbar, daß man sich fast genötigt sieht, auch dieses ihm zuzusprechen. Dennoch kann ich mich nicht für völlig überzeugt erklären, da etwas im Ausdrucke des Antlitzes wie in der Flächenbehandlung des Marmors gegen die Urheberschaft Michelangelos redet. Müßte sie, wenn sie sein Werk ist, nicht später in Rom erst entstanden sein?
Neben diesem Auftrage begann Michelangelo auf eigene Rechnung einen Cupido in Marmor zu hauen, den er im Schlafe liegend als sechs- bis siebenjähriges Kind darstellte. Man hat das Werk wieder entdecken wollen, aber es bleibt verschollen.
Während des Winters 1495 auf 96, in dem er an diesen beiden Stücken tätig war, traten jetzt aber Ereignisse in der Stadt ein, zu denen die bisherigen nur ein sanfteres Vorspiel waren. Nach allen Seiten hin hatten die Dinge noch in der Schwebe gelegen. Das Verfahren der Verbündeten, Florenz zu gewinnen, hielt stets an der sichern Aussicht fest, daß die Bemühungen, die Stadt zum Abfall von Frankreich zu bringen, Erfolg haben würden. Die Parteien flossen noch immer einigermaßen durcheinander; Savonarola hielt, so heftig er sprach, doch ein gewisses Maß inne, und wenn man von Rom aus hätte einlenken wollen, es wäre möglich gewesen.
In das Ende des Jahres 95 aber fällt die erste bewaffnete Expedition der Medici, sich mit Gewalt der Stadt wieder zu bemächtigen. Piero, der von den Franzosen nichts erlangen konnte, hatte sich an die Verbündeten gewandt und Gehör gefunden. Die Florentiner sollten gezwungen werden, sich ihnen anzuschließen und die Angriffe gegen Pisa einzustellen. Mit Sforza, den Bentivogli, den Orsini und mit Siena im Bunde, hofften die Brüder Florenz wie in einer Schlinge zu fangen und zum Gehorsam zu bringen. Aber die Uneinigkeit der Verbündeten vereitelte die Unternehmung, deren einziger Erfolg die Stärkung der Partei Savonarolas in der Stadt und die seines eigenen Ansehens war.
Nun kam der Karneval zu Anfang des Jahres 96. Sonst pflegte er mit ausgelassenem Spektakel begangen zu werden. Tag und Nacht wütete Tollkühnheit in den Straßen, vom graziösen Scherze bis zum Unfug, der mit Blutvergießen endete. Jeder mußte seine Haut zu Markte tragen. Die Krone des Festes waren immer die prachtvollen Umzüge mit Gesang und am letzten Tage das Verbrennen der Bäume, die, mit erbetenem oder erpreßtem Flitter behangen, auf den öffentlichen Plätzen aufgestellt und unter Tänzen umher vom Volke in Flammen gesetzt wurden.
Wie einst das Christentum sich der alten heidnischen Feste bemächtigte und sie, statt sie auszurotten, an sich riß, so verfuhr jetzt Savonarola. Es sollten Umzüge gehalten, Lieder gesungen, Gaben erbettelt und Bäume verbrannt werden, das Volk sollte tanzen um sie her, aber alles in höherem Sinne, wie er es erdachte und anordnete. Kinder gingen durch die Straßen, klopften an die Türen und baten mit sanften Worten um »Gegenstände der Verdammnis«, die zur Ehre Gottes verbrannt werden sollten. Statt der lustigen Aufzüge erfolgten Prozessionen mit frommen Liedern. Am letzten Tage dann der Aufbau einer Pyramide, errichtet aus den Ergebnissen der Sammlung. Musikinstrumente, Bücher mit Liebesgedichten (toskanische sowohl als heidnische), Bilder, Putz, Parfüms, kurz was von unheiligen Überflüssigkeiten des täglichen Lebens erdacht werden kann, türmte sich hier in den wertvollsten Exemplaren zu einem Baue auf, der angesteckt und unter Absingung seltsamer Lieder zum Lobe Christi, des »Königs von Florenz«, vom begeisterten Volke umtanzt wurde. Alt und jung beteiligte sich. Hier war es, wo Fra Bartolommeo und Lorenzo di Credi ihre eigenen Arbeiten den Flammen überlieferten, wo kostbare Ausgaben des Petrarca und Virgil zerstört wurden.
Die Fasten folgten. Diesmal eine wirkliche Zeit der Buße und Zerknirschung. Tag für Tag sausten die Predigten Savonarolas durch das Volk und fachten die glühende Schwärmerei zu frischen Flammen an. Zweimal bereits hatte der Papst ihm das Predigen untersagt, die Regierung der Stadt aber und seine römischen Freunde eine Aufhebung des Verbotes erlangt. Man hatte gehofft, daß er sich mäßigen werde, aber das war wenig gewesen, was er bis dahin gesagt, rückhaltlos gab er sich jetzt dem Drange hin, kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen, und bezeichnete deutlicher die letzten Konsequenzen seiner Lehre. »Ich frage dich, Rom«, ruft er, »wie es möglich sein kann, daß du noch auf dem Boden der Erde dastehst?« Elftausend Kurtisanen in Rom, sei noch zu tief gegriffen. Nachts wären die Priester bei diesen Frauen, morgens darauf läsen sie die Messe und teilten die Sakramente aus. Alles sei in Rom käuflich, alle Stellen und Christi Blut selber für Geld zu haben. Er stehe da und fürchte sich nicht. Seine Feinde und Angeber möchten nur berichten, was er gesprochen habe; er sei ein Feuer, das sich nicht löschen ließe.
Vieles sei eingetroffen von dem, was er vorausgesagt habe, aber das sei das wenigste. Rom und Italien würden bis auf die Wurzeln vernichtet werden, furchtbare Rächerbanden würden sich über das Land ergießen und den Hochmut der Fürsten bestrafen; die Kirchen, die von ihren Priestern zu öffentlichen Häusern der Schande erniedrigt wären, würden die Ställe der Pferde und des unreinen Viehes sein; Pest und Hungersnot würden kommen – so donnert er los am vierten Morgen der Fasten in einer Predigt, die heute noch einen aufregenden Eindruck macht.
Wir wissen nicht, in welchem Maße Michelangelo sich diesen Stimmungen hingab, wohl aber, daß er zu Savonarolas Anhängern gehörte. In hohem Alter noch studierte er seine Schriften und erinnerte sich der starken Stimme, mit der er gepredigt. Als im Jahre 1495 der Saal für das Consiglio grande im Palaste der Regierung auf Savonarolas Drängen ausgebaut zu werden begann, war Michelangelo unter denen, die dabei zu Rate gezogen wurden. Die Sangalli, Baccio d'Agnolo, Simone del Pollaiuolo und andere bildeten diese Kommission. Simone del Pollaiuolo, bekannter unter dem Namen Cronaca, erhielt den Bau, Fra Bartolommeo übernahm das Gemälde für den im Saale errichteten Altar, lauter Anhänger Savonarolas und Michelangelo mitten unter ihnen. Am 15. Juli wurde Cronaca erwählt. Dieses Datum gibt zugleich einen Anhaltspunkt für Michelangelos Rückkehr aus Bologna. Er mußte in Florenz gerade wieder angekommen sein, als er bei dieser Angelegenheit beteiligt wurde.
Trotzdem blieb er immer noch weltlich genug gesinnt, um den Cupido zu arbeiten. Im April oder Mai 1496 hatte er ihn vollendet. Medici war entzückt von der Arbeit und gab ihm an, auf welche Weise der beste Preis dafür zu erzielen sein würde. Er möge dem Stein das Ansehen geben, als hätte er lange in der Erde gelegen. Er selber wolle ihn darauf nach Rom schicken, wo er als eine Antike hoch bezahlt werden würde. Man sieht, daß den Medici trotz ihrer Vornehmheit der Kaufmannsgeist nicht verloren gegangen war. Lorenzo bewährte das noch bei anderen Gelegenheiten. Er verstand die in Florenz eintretende Teuerung wohl zu benutzen, indem er aus der Romagna Korn kommen ließ und daran ein Erkleckliches verdiente.
Michelangelo ging auf den Vorschlag ein, gab dem Marmor ein verwittertes, uraltes Aussehen und empfing bald durch Lorenzo den Bescheid, daß ihn der Kardinal von San Giorgio, jener selbe Raffael Riario, der in Florenz die Messe las, als Guiliano von den Pazzi ermordet wurde, für dreißig Dukaten angekauft habe. Messer Baldassare del Milanese, durch dessen Vermittelung in Rom der Handel abgeschlossen war, ließ Michelangelo die Summe in Florenz auszahlen, welche diesem demnach als ein vernünftiger Preis erschienen sein muß.
Das Geheimnis aber von der wirklichen Entstehung der Antike wurde nicht bewahrt. Dem Kardinal kam allerlei zu Ohren; er ärgerte sich, betrogen zu sein, und schickte einen der ihm dienenden Edelleute nach Florenz, um der Sache auf den Grund zu kommen. Dieser nahm den Schein an, als suche er Bildhauer, die in Rom beschäftigt werden sollten, und lud auch Michelangelo zu sich ein. Er kam, statt jedoch mitgebrachte Arbeiten zu zeigen, nahm er eine Feder und zeichnete eine menschliche Hand groß aufs Papier hin, daß ihm der Römer voller Erstaunen zusah. Hierauf zählte er auch die Skulpturen auf, die er bereits vollendet hätte, und nannte darunter ohne weiteres den schlafenden Cupido.
Nun eröffnete der Mann, warum er ihn eigentlich habe rufen lassen; statt der dreißig Dukaten, die Messer Baldassare geschickt, erzählte er von zweihundert, welche der Kardinal für die Arbeit bezahlt hätte, so daß sich Michelangelo ebensosehr als der Kardinal selbst betrogen sah. Eingeladen von dem römischen Herrn, der ihn in seinem eigenen Hause aufzunehmen versprach, erfüllt von dessen Erzählungen, daß man in Rom ein weites Feld finde, um seine Kunst zu zeigen und Geld zu gewinnen, hauptsächlich aber in der Absicht, sich von Messer Baldassare die übrigen hundertsiebzig Dukaten auszahlen zu lassen, machte er sich nach Rom auf, wo er am 25. Juni 1496 eintraf.