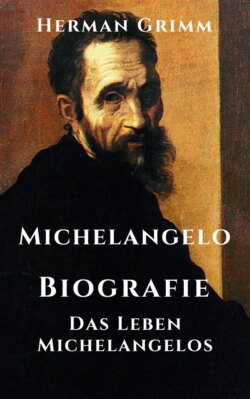Читать книгу Michelangelo - Biografie - Herman Grimm - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Viertes Kapitel
Оглавление1496-1501
I
Das älteste Schriftstück von Michelangelos Hand, das wir besitzen, ist der Brief, in welchem er Lorenzo dei Medici seine Ankunft in Rom anzeigt.
»Ew. Magnifizenz teile ich mit, daß wir am vorigen Sonnabend gesund angekommen sind und sogleich zum Kardinal di San Giorgio gingen, dem ich Euren Brief überreichte. Er schien mir wohlgeneigt zu sein und begehrte auf der Stelle, daß ich mir verschiedene Figuren ansähe, womit ich den ganzen Tag zubrachte und deshalb Eure anderen Briefe noch nicht abgab. Sonntag kam der Kardinal in den neuen Bau und ließ mich rufen. Als ich kam, fragte er mich, was ich von dem hielte, was ich gesehen hätte. Ich sagte ihm meine Meinung darüber. Es sind in der Tat, scheint mir, hier sehr schöne Sachen. Der Kardinal wollte nun wissen, ob ich mir etwas Schönes zu arbeiten getraute. Ich antwortete, daß ich keine großen Versprechungen machen wolle, aber er würde ja selbst sehen, was ich zu leisten imstande sei. Wir haben ein Stück Marmor für eine lebensgroße Figur gekauft, und nächsten Montag fange ich an zu arbeiten. Vergangenen Montag gab ich Eure übrigen Briefe Paolo Rucellai, der mir das Geld auszahlte, das ich nötig hatte, und das für Cavalcanti. Dann brachte ich Baldassare den Brief und verlangte den Amor zurück, ich wollte ihm dafür sein Geld wiedergeben. Er antwortete mir sehr heftig, lieber wolle er den Amor in tausend Stücke schlagen, er habe ihn gekauft, er sei sein Eigentum, er könne schriftlich beweisen, daß er dem genug getan, von dem er ihn empfangen hätte. Kein Mensch solle ihn zwingen, ihn wieder herauszugeben. Er beklagte sich über Euch. Ihr hättet ihn verleumdet. Einer von unseren Florentinern hier hat sich dazwischen gelegt, um uns zu vereinigen, hat aber nichts ausgerichtet. Ich denke jetzt durch den Kardinal die Sache durchzusetzen; Baldassare Balducci hat mir diesen Rat gegeben. Ich schreibe Euch, was weiter geschehen wird. Soviel für diesmal. Ich empfehle mich Euch. Gott behüte Euch.
Michelagnolo in Rom.«
Wie lebhaft führen uns die wenigen Worte in den Verkehr der Leute hinein, die über den Handel mit der Statue aneinandergeraten. Ein geärgerter hoher Herr, ein wütender, betrügerischer Kaufmann, dazwischentretende Freunde, und dennoch dies alles Nebensache gegen Rom selber! Michelangelo durchstreift die Stadt, und über dem Anblick der Kunstwerke kommen ihm neue Gedanken zu eignen Arbeiten.
Er war einundzwanzig Jahre alt, als er nach Rom kam.
Wie die Römer einst sagten »die Stadt«, um Rom zu bezeichnen, sagen wir heute »Rom«, um das zu nennen, was jedem, der es gesehen hat, als das Ideal einer Stadt erscheinen muß. Man meint, als die Welt geschaffen sei mit Bäumen, Flüssen, Meeren, Gebirgen, Tieren und Menschen endlich, da hätte an dem Flecke der Erde, wo Rom steht, eine Stadt aus dem Boden wachsen müssen, aufsprossend ohne menschliches Zutun. Bei anderen Städten könnte man denken, hier war einst eine wüste, öde Fläche, ein Wald, ein Sumpf, eine stille, weitgedehnte Wiese; dann kamen Menschen und errichteten Hütten, aus denen Häuser wurden, eins klebte sich ans andere, und es ward endlich eine ungeheure Menge mit Kirchen und Palästen dazwischen, aber alles zerstörbar wieder, und nach Jahrhunderten könnten da frische Bäume stehen, zwischen denen nur scheues Wild durchschlüpfte; bei Rom aber sind solche Gedanken fast eine Unmöglichkeit. Man glaubt nicht, es sei hier jemals sumpfiger Grund gewesen, in dessen seichtem Gewässer Romulus und Remus als Kinder ausgesetzt wurden, oder es könne der rohesten Gewalt gelingen, die sieben Hügel von Gebäuden zu befreien. Bei Berlin, Wien, Paris könnte ich mir einen Sturm denken, der wie ein Rasiermesser alles vom Boden abmähte und tot zur Seite würfe; in Rom aber scheint es, als müßten die Steine sich wieder zu Palästen zusammenfügen, wenn sie eine Erschütterung auseinanderrisse, als sei es gegen die Gesetze des Daseins, daß die Höhe des Kapitols ohne Paläste, Tempel und Türme sei.
Es ist ein Übelstand, daß man sich, um dergleichen Gedanken auszudrücken, fester Bilder mit begrenztem Inhalte bedienen muß. Praktisch genommen, sind es wertlose Gedanken, die hier eben vorgebracht wurden, denn Rom kann einmal so gut wie Babylon und Persepolis mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Und dennoch liegt in diesen Phantasien ein Inhalt höherer Art, und die Notwendigkeit ist vorhanden, sie zu sagen. Das Gefühl des Ewigen, Unvergänglichen sollte ausgedrückt werden, das uns in Rom beschleicht; das Gefühl, als sei die Erde ein großes Reich und hier sein Mittelpunkt; die Liebe zu dieser Stadt aller Städte. Ich bin kein Katholik und spüre nichts von romantischer Verehrung von Papst und Kirche in mir, aber leugnen kann ich das allmächtige Heimatsgefühl nicht, das mich in Rom ergriffen hat, und die Sehnsucht dahin zurück, die ich nie verlieren werde. Die Idee, daß der junge Michelangelo, voll vom Geräusche des fanatisch bewegten Florenz, in dieses Rom vom Schicksal geleitet wird und zum ersten Male den Boden betritt, wo das verworrenste Treiben dennoch von der stillen Größe der Vergangenheit überboten wurde, hat etwas Furchtbares, Gedankenerweckendes in sich. Es war der erste Schritt seines wirklichen Lebens, den er tat. Vorher ließ er sich hin- und herleiten von den Menschen und von den eigenen unklaren Absichten; jetzt auf sich selber angewiesen, nimmt er einen neuen Anlauf für seine Zukunft und das, was er hervorbringt, eröffnet die Reihe seiner Meisterwerke.
II
Welcher Art die schönen Sachen gewesen sind, von denen er gegen den Kardinal äußerte, daß sie in Rom vorhanden seien, läßt sich heute kaum bestimmen. Die Ausbeute des reichen Bodens hatte begonnen, und viel war gefunden worden, allein die Entdeckung der meisten Antiken, welche heute als Prachtstücke der Sammlungen bekannt sind, fällt in spätere Zeiten; andererseits ist von dem, was sich im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert in Rom angehäuft hatte, in der folgenden Zeit viel nach allen Seiten hin entführt worden. Der heutige Zustand gibt keinen Maßstab für den damaligen, es war ein anderes Rom, in das Michelangelo eintrat. Die vorhandenen Kunstwerke waren nicht wie jetzt in Museen kalt nebeneinander gereiht, sondern verteilt durch die ganze Stadt, zum Schmuck der Gebäude und zur Freude der Menschen, allüberall an günstigen Plätzen frei aufgestellt. Diese Gebäude waren in einem Stile aufgeführt, von dem nur geringe Reste übrig geblieben sind. Als Michelangelo den Felsen des Kapitols bestieg, ahnte er nicht, daß er ihn einst mit Palästen besetzen würde, die seine ganze Form veränderten. Als er da droben, auf den nackten Trümmern des alten Jupitertempels sitzend, die Augen umherschweifen ließ, ahnte er nicht, daß man von da einst die Peterskuppel, die er erdachte, und die unzähligen kleineren Kuppeln, die alle nach ihrem Muster gebaut sind, mit den Blicken überfliegen würde. Heute denkt man, Rom sei nicht möglich ohne diese Aussicht. Nichts von alledem war vorhanden. Damals stand noch die alte Basilika von Sankt Peter; der prachtvolle, geräumige Platz des Bernini mit den sausenden Springbrunnen und den gewaltigen Säulengängen, die ihn in ihre Arme nehmen, war mit einem wüsten Wirrwarr kleiner Häuser bedeckt. Ein Platz lag in ihrer Mitte, auf dem Turniere und Ringelrennen abgehalten wurden. Der langgestreckte vatikanische Palast war kaum viertel so groß als heute und festungsartig abgeschlossen. Von hier aus zog der Papst einen bedeckten gemauerten Gang nach der Engelsburg, die durch Festungswerke mit der Brücke, die unter ihr über die Tiber führt, eng verbunden, sichtbarer als heute das Bild eines Kastells darbot, dessen Inhaber dadurch, daß er die beiden Hälften Roms, die päpstliche neue Stadt nördlich vom Flusse und das alte große Rom südlich von der Tiber, je nach seinem Willen völlig voneinander trennen konnte, Herr der Stadt war.
Das Kastell von Santangelo bildete die Zitadelle von Rom, aber doch nur eine einzige all der geringeren Festungen, von denen es, wie Florenz in alten Tagen, immer noch erfüllt war. In Florenz hatte ein freierer, lichterer Stil längst freie, schöne Paläste geschaffen, in Rom, wo der öffentliche Zustand der Dinge der Stärke vor der Schönheit noch den Vorrang lassen mußte, sah man erst wenige von den ausgedehnten mit Fensterreihen erfüllten Prachtfassaden. Die von hohen Türmen überragten Paläste der Kardinäle und des hohen Adels, der Orsini, Colonna und anderer zeigten sich als ringsum abgeschlossene, finstere Bauwerke, wohlgeeignet verteidigt zu werden, und mit allen Mitteln versehen, plötzliche Überfälle abzuwehren. Der römische und florentinische Palastbau ist ein Produkt der Zeiten und der Geschichte. Die Fassade lag nach innen, der Hof war der eigentliche Mittelpunkt des Gebäudes, ein ringsum eingeschlossener Raum, wo zu allen Tageszeiten schattige Kühle waltete, wo sich der Brunnen befand und die Statuen in günstigem Lichte standen. Die nach außen rauhen und düsteren Massen der Paläste öffneten sich um den Hof in leichten, offenen Säulengängen. Hier war man sicher und hatte dennoch den freien Himmel über sich. Die Loggien des Vatikans, die Raffael ausmalte, sind die offenen Bogengänge, welche den Hof des päpstlichen Palastes umgeben.
Um diese Burgen der weltlichen und geistlichen Fürsten lagen die Wohnungen ihrer Dienstleute und derer überhaupt, die sich zu dem Herrn hielten, der in ihrer Mitte thronte. Die engen Straßen zwischen diesen Häusern wurden nachts mit Ketten gesperrt. So hatte jeder Mächtige seine Stadt in der Stadt für sich, seinen Hof, seine Kirche, seine Untertanen, Edelleute, Soldaten, Künstler und Gelehrte, und zwischen diesen Höfen all und dem päpstlichen eine ewige Flut von Intrigen mit versteckter oder auch offen ausbrechender Feindschaft. Damals war noch mehr als die Hälfte von Europa geistliches Eigentum, lieferte nach Rom seine Abgaben und empfing von dort Befehle. Heute (1859!) ist die Stadt eine Wüste gegen jene Zeiten. Die Paläste stehen leer, die Kardinäle, Leute, die nur in Ausnahmefällen Macht und Ansehen besitzen, fahren in schwerfälligen Karossen durch die Straßen, meist gebrechliche Herren, deren Namen kaum in der Stadt bekannt sind; damals sprengten sie in vollen Waffen mit ihren Leuten zum Vatikan, an ihren Kirchen vorüber, wo sie zur Zeit der Papstwahl öffentlich die silbernen und goldenen Weihgefäße verkaufen ließen, weil sie Geld brauchten, um ihre Freunde und Feinde zu bestechen. Es waren Männer aus den ersten Fürstenfamilien, jung, streitbar und mit glühenden Leidenschaften. Ungeheure Summen hatte der Kardinal Ascanio, Lodovico Sforzas Bruder, darangesetzt, um nach Innozenz' Tode seine Wahl zum Papste durchzusetzen, ebenso der Kardinal Vincula, der wie Ascanio seine eigene Armee ins Feld stellen konnte, so mächtig waren beide, dennoch besiegte sie diesmal Alexander Borgia, der am meisten vermocht hatte und zu der Zeit, wo Michelangelo ankam, Rom beherrschte. Es war der erste Papst, der öffentlich von seinen Kindern sprach; früher war immer nur von Neffen und Nichten die Rede gewesen. Lucrezia Borgia war seine Tochter. Ihrem ersten Manne wurde sie wieder abgekauft, von ihrem zweiten geschieden, ihr dritter vor dem Vatikan selber niedergestoßen, und als er sich dennoch zu erholen drohte, von Cesare Borgia, Lucrezias Bruder, der diesen Überfall eingerichtet hatte, auf seinem Krankenlager erdrosselt.
Dieser Cesare Borgia, der Lieblingssohn Alexanders, war damals fünfundzwanzig Jahre alt, schön von Gestalt und riesenmäßig stark. Auf einem mit Schranken umgebenen Platze vor dem Vatikan tötete er sechs wilde Stiere, gegen die er zu Pferde kämpfte. Dem ersten schlug er auf einen Hieb den Kopf herunter. Ganz Rom staunte. Nicht geringer aber als seine Kraft war seine Wildheit. Messer Pierotto, den Liebling seines Vaters, erstach er unter dessen eigenem Mantel, wohin er sich geflüchtet hatte, daß dem Papste das Blut ins Gesicht spritzte. Alle Morgen fand man in den Straßen vier bis fünf Leichen, darunter Bischöfe und hohe Prälaten. Rom war in Schrecken vor Cesare.
Zu jener Zeit muß er den Herzog von Gandia, seinen Bruder, ermordet haben. Er ließ ihn erdolchen und in die Tiber werfen. Dann teilte er dem Papste selber mit, daß die Tat von ihm ausgegangen sei. Das Oberhaupt der Christenheit, außer sich vor Wut und Schmerz, erscheint im Kollegium der Kardinäle, heult um seinen Sohn, wirft sich seine Verbrechen vor, die er bis dahin begangen hat, und gelobt Besserung. Das hielt vor einige Tage, da war es vorüber, und die Aussöhnung mit Cesare ließ nicht lange auf sich warten. Diese furchtbare Familie war zu sehr auf einander angewiesen, um in sich selbst lange uneins bleiben zu können. Falsch, schamlos, lügnerisch, ohne Treu und Glauben, von unersättlicher Habgier und ruchlosem Ehrgeize, grausam bis zur Barbarei, so zählt Guicciardini des Papstes Laster auf. Ein solcher Charakter scheint unmöglich in unseren Tagen, er fände keinen Raum, um seine Geierflügel völlig auszuspannen, und keine Beute mehr, auf die er stoßen könnte. So völlig aber passen die Borgia in ihre Zeit hinein, daß sie nur dann daraus hervorstechen, wenn wir ihre Eigenschaften aus dem Rahmen dessen, was sie umgab, herausgenommen für sich betrachten. Vertiefen wir uns in die Taten, die von anderen um sie her ausgingen, so erscheinen ihre Verbrechen beinahe ausgeglichen, und wir gewinnen sogar die Freiheit, ihre guten Seiten zu würdigen, das heißt die Kraft, durch die sie die anderen überboten, die vielleicht nur ihrer Schwäche wegen weniger gebrandmarkt dastehen.
»Der Papst ist siebzig Jahre alt«, berichtet der venezianische Gesandte aus jener Zeit, »alle Tage scheint er jünger zu werden, keine Sorge behält er über Nacht im Herzen, er ist heiter von Natur, und was er tut, schlägt ihm zum Vorteil aus.« Alexander hatte einen Riesenkörper, einen durchdringenden Blick für den Sachverhalt der Dinge und für die rechten Mittel, die zum Zwecke führten, auf wunderbare Weise wußte er den Leuten die Überzeugung zu verleihen, er meine es redlich mit ihnen. Ebenso geschickt war Cesare, Lucrezia aber besaß soviel Schönheit und solche Gaben des Geistes, daß sich selbst heute noch Verehrer gefunden haben, die an ihre Verbrechen nicht glauben wollen. Sie berufen sich auf ihre Briefe, ihren Verkehr mit den edelsten Männern Italiens, ihre spätere Laufbahn, wie sie als Herzogin von Ferrara lange Jahre die beste Gattin und Mutter gewesen sei. So sehr überstrahlen die Gaben des Geistes die dunklen Handlungen, denen wir uns schuldig machen. Doch will es uns nicht scheinen, als ob die Verbrechen dieser Familie jemals zu übertünchen wären.
III
Das waren die Menschen, die im Vatikan wohnten, als Michelangelo nach Rom kam. Von Künstlern, die er dort antraf, sind die bedeutendsten zwei Florentiner, Antonio Pollaiuolo, der noch unter Ghiberti an den goldenen Türen mitgearbeitet hatte, und sein jüngerer Bruder Piero, völlig eingebürgert, wohlhabend und willens, ihre Tage in Rom zu beschließen. Piero muß um die Zeit gestorben sein, als Michelangelo ankam; Antonio jedoch, der bedeutendere, lebte noch bis 1498. Er begann als Goldschmied, ward berühmt seiner Zeichnungen wegen, nach denen viele Künstler arbeiteten, bekam selber Lust zu malen, modellierte, bildhauerte und goß in Erz. Nach Papst Sixtus' Tode wurde er vom Kardinal Vincula nach Rom berufen, um ein Grabmonument für ihn auszufahren. Dies geschah 1494. Pollaiuolos umfangreiches Bronzewerk zeigte den Papst lang ausgestreckt auf einem Unterbaue, der mit korinthischem Blätterschmuck meisterhaft umkleidet ist. Nach seiner Vollendung übertrug man ihm die gleiche Arbeit für Innozenz den Achten, der mit Lorenzo dei Medici in einem Jahre verschied und den er in sitzender Gestalt arbeitete. Außerdem sind viele Werke seiner Hand in den römischen kleineren Kirchen zu finden; jene beiden Monumente wurden in der Basilika von Sankt Peter errichtet, wo sie noch zu sehen sind.
Pollaiuolos Stärke war die Strenge der Zeichnung, seine Farbe ist kalt und undurchsichtig. In den Figuren aber liegt ein Zug zum Großen und Einfachen, das sonst den Florentiner Meistern weniger eigen war als denen der umbrischen Malerschule. In San Miniato zu Florenz befand sich ein zehn Ellen hoher heiliger Christoph von seiner Hand, den Michelangelo zu wiederholten Malen kopiert haben soll. Es ist daher wohl anzunehmen, daß er sich jetzt in Rom an Pollaiuolo persönlich anschloß. Dies vielleicht um so mehr, als er mit Cronaca, dessen Schüler und nahem Verwandten, in Florenz bekannt war.
Indessen, wie dem auch sei, die Brüder Pollaiuolo waren nicht die Männer, ihn künstlerisch auf eine höhere Stufe zu heben. Dagegen lernt er in Rom jetzt die Arbeiten zweier Meister kennen, deren Art und Weise weit abliegt von der Auffassung der florentinischen Kunst und deren Werke nicht ohne Einfluß auf ihn bleiben konnten, Mantegna und Melozzo da Forli.
Mantegna gehörte zu den allerersten. Eine Tiefe der Empfindung liegt in seinen Bildern, ein Adel in seinen Linien, daß man sogleich fühlt, er sei kein Mann, der übertroffen oder nachgeahmt werden könne, wohl aber eine Natur, deren belebenden Einfluß jeder empfinden mußte, der von ihr berührt zu werden fähig war. Mantegna lebte in Mantua, wo die Gonzaga seine Gönner waren. Er kam während der achtziger Jahre nach Rom. Die Kapelle, die er für den Papst ausmalte, ist heute nicht mehr vorhanden, aber man darf annehmen, daß diese Arbeit, zu der er eine Reihe von Jahren brauchte, nicht geringer gewesen sei als die übrigen. Während in Florenz die Einwirkung der Antike auf die Kunstanschauung nicht von ersichtlicher Stärke war, sondern die freie Bewegung des Lebendigen, Natürlichen die Quelle blieb, aus der man schöpfte, gestattete Mantegna dem Stil der antiken Meister auffallenden Einfluß, setzte ihrer Kraft aber eine so entschiedene Eigentümlichkeit entgegen, daß auch hier von Nachahmung keine Rede sein kann. Seine Farbengebung ist einfach, beinahe kalt, und ordnet sich durchaus der Zeichnung unter, diese Zeichnung aber läßt die Gestalten so durchdringend zur Erscheinung kommen, daß sie fast eine typische Gewalt empfangen. Man meint, es sei nicht möglich, eine Szene anders aufzufassen, als er getan. Wenn man vor dem vom Kreuze genommenen Christus steht, den wir von seiner Hand in Berlin besitzen, so scheint das Gefühl des grausamsten Todes, der dennoch eine lächelnde himmlische Ruhe zurückließ, erschöpft zu sein durch die Kunst des Meisters, und kein Gedanke bleibt übrig an andere Künstler, denen es besser hätte gelingen können und die noch tiefer in unsere Seele drängen. Mantegna ist befangen in einer gewissen Steifheit, die erst Leonardo und Michelangelo überwanden, von denen beiden dann Raffael die glücklich errungene Freiheit empfing. Das aber verhindert nicht, Mantegna mit jenen drei in eine Reihe zu stellen. Und so wurde auch von Anfang an in Italien geurteilt.
Melozzo da Forli reicht nicht an Mantegna heran in dem, was er leistete, in dem aber, was er leisten wollte, übertrifft er vielleicht alle Künstler vor Michelangelo. Es sind nur wenige von seinen Werken übrig geblieben, und von den größten nur geringe Bruchstücke. Forli, sein Geburtsort, liegt in der Romagna, nicht weit von Urbino, wo Giovanni Santi, Raffaels Vater, lebte. Dieser, ein genauer Freund Melozzos, zeigt dieselben strengen Formen in seinen Bildern, denselben erdigen Ton, der mehr auf Mantegna als auf die Florentiner Schule hinweist. Die Romagna, durch das Gebirge von Toskana getrennt, empfing aus dem Norden größere Anregung als vom Nachbarlande. Forli gehörte dem Grafen Girolamo Riario, dem Neffen des Papstes Sixtus. Durch ihn wurde Melozzo nach Rom gebracht. Die Ernennung zum Maler des Papstes folgte, endlich die Erhebung in den Ritterstand. Dazu ein reiches Gehalt und großartige Aufträge. Es befindet sich ein Bild von ihm im Vatikan, das den Papst umgeben von seinen Neffen darstellt. Es sind dieselben, die mit den Pazzi Lorenzo dei Medici ermorden wollten; gerade in jenen Zeiten malte sie Melozzo. Unter ihnen auch der Kardinal Vincula, jung und unbärtig. Der Papst selber im Profil, ein scharfes, volles Gesicht, der Mann, der den Italienern Respekt einflößte weil er seine Familie so energisch in die Höhe brachte. Das Hauptwerk Melozzos, eine Himmelfahrt Christi, die ehedem die Altarwand der Kirche San Apostoli einnahm, ist heute zerstört, und nur einzelne Stücke, die in der Sakristei von Sankt Peter und im Lateran aufbewahrt werden, gewähren eine Idee der grandiosen Zusammenstellung kolossaler Figuren, aus denen das Gemälde bestand. Diesen Gestalten wüßte ich, was die Kühnheit der Komposition anlangt, nichts Gleichzeitiges an die Seite zu stellen. Denn eine Phantasie, welcher menschliche Körper in so kühnen Verkürzungen vorschwebten, und eine Hand, wie sie der Künstler besaß, der so frei und fest hinzeichnete, was er im Geiste erblickte, finde ich bis dahin bei keinem Maler vereinigt. Dennoch nimmt Melozzo kaum einen Platz in der Kunstgeschichte ein, weil zu geringe Überbleibsel seiner Tätigkeit vorhanden sind; Vasari erwähnt ihn erst in der zweiten Auflage seines Werkes, und auch da beinahe nur um zu sagen, daß er nichts von ihm wisse. Wie mir nach den vorhandenen Resten der Mann vor Augen steht, ist er als Künstler und Charakter gleich groß und verdient die Vergessenheit nicht, in die sein Name hinabsank. Man begreift, daß dieser wilde Papst mit seinen ebenso tollen Neffen (oder Söhnen, wie man will) vor dem Genie Melozzos Respekt hatte und ihn nicht mit Geld allein abfand, wie Pollaiuolo etwa, der bei seinem Tode jeder seiner Töchter fünftausend Dukaten hinterlassen konnte. Wie gering erscheint Pollaiuolo mit aller seiner umfassenden Tätigkeit neben Melozzo, dessen Christus und Apostel emporstiegen, als durchbrechen sie das Kirchendach! Es sind noch eine Anzahl Fragmente von den Engeln erhalten, die wahrscheinlich in vollem Chor den anlangenden Sohn Gottes in den Gewölben empfingen. Sie spielen auf verschiedenen Instrumenten und singen dazu; auch sie beugen sich in schönen Verkürzungen nieder, lauter edle, schöne Mädchengestalten. Zwei erschienen mir besonders reizend. Die eine mit beiden Armen ein Tamburin emporhaltend, das sie schlägt, und mit dem Körper weit zurückgebogen; ein lila Gewand über grünem Unterkleide umfliegt sie in freien, großen Falten; nichts ist gemein natürlich daran, und doch keine Spur leerer, konventioneller Großartigkeit. Die andere sitzt auf dem Gewölk und schaut vorgeneigt in die Tiefe nieder, während sie auf einer Laute spielt. Sie hat braune, stumpf abgerundete Eulenflügel, ganz wie nach der Natur gemalt. Melozzo war schon zwei Jahre tot, als Michelangelo nach Rom kam. Die Neffen des ehemaligen Papstes lagen mit Alexander Borgia und seinen Söhnen im Kriege. Der Kardinal Vincula saß in Ostia, seiner Residenz. Damals kann Michelangelo deshalb noch nicht mit ihm bekannt geworden sein, der später sein berühmter Freund und Beschützer ward.
Sollte aufgezählt werden, was er außer den Werken Mantegnas und Melozzos allein an Arbeiten florentinischer Künstler in Rom fand, so würde das einen langen Katalog füllen. Sie hatten fast sämtlich hier gearbeitet, von Giotto bis auf Ghirlandaio herab, und die Kirchen waren voll von Denkmälern ihrer Tätigkeit; persönlich anwesend aber war gerade keiner. Doch sind wir nicht so genau unterrichtet, um die, welche in Rom zu jenen Zeiten arbeiteten, alle zu kennen. Wir haben auf dem Berliner Museum eine überlebensgroße Porträtbüste Alexander des Sechsten, welche damals entstanden sein muß. Das Werk ist in jeder Beziehung eines großen Meisters würdig, ja von solcher Vortrefflichkeit, daß es für Pollaiuolo zu gut erscheint. Aus Mangel an Nachrichten aber bleibt dieser dennoch der einzige bedeutende Künstler, von dem wir annehmen dürfen, daß er mit Michelangelo zusammentraf.
IV
Der Kardinal di San Giorgio, von dem Michelangelo so gut aufgenommen worden war, gab sich in der Folge trotzdem nicht als den Mann zu erkennen, von dem etwas zu erwarten gewesen wäre. Er ließ zu der Zeit, als Michelangelo in Rom ankam, in der Nähe des Campo del Fiore einen umfangreichen Palast bauen, an dem er ihn leicht hätte beschäftigen können. Dies muß der »neue Bau« sein, von dem im Briefe an Lorenzo dei Medici die Rede ist. Schien der Kardinal anfangs Michelangelo dabei benutzen zu wollen, wie gleichfalls aus dem Briefe hervorgeht, so gab er ihm in der Folge trotzdem keine Aufträge. Auch zog er sich aus der Affäre mit Messer Baldassare auf wenig fürstliche Weise heraus. Er nötigte den Kaufmann, das Geld wieder herzugeben und die Statue zurückzunehmen. Michelangelo hatte erwartet, der Kardinal würde den Baldassare zwingen, ihm den unterschlagenen Rest zu zahlen. Nun war er vielleicht froh, seine dreißig Dukaten behalten zu dürfen. Auch von der lebensgroßen Figur, zu der er gleich in den ersten Tagen Marmor kaufte und die offenbar vom Kardinal bestellt worden war, wird nichts weiter gesagt. Es muß zwischen ihnen beiden irgend etwas vorgefallen sein, was dem Verhältnis einen Stoß gab. Denn Condivi, der nach Michelangelos eigenen Worten schrieb, spricht sich hart über das Benehmen des Kardinals aus, ohne jedoch nähere Angaben zumachen.
Nur in sehr mittelbarer Weise machte sich Michelangelo im Hause San Giorgios geltend. Vasari erzählt, derselbe habe einen Barbier gehabt, der sich aufs Malen gelegt, aber vom Zeichnen nichts verstanden hätte. Diesem habe Michelangelo den Karton zu dem heiligen Franziskus, wie er in der Verzückung die Wundmale empfängt, angefertigt. Varchi lobt das Bild in seiner Leichenrede auf Michelangelo. Lomazzo will den Karton gesehen haben und sagt, es sei ein strahlenausstreuender Serafim mit sechs Flügeln darauf. Da jedoch Condivi darüber schweigt und von Varchi und Lomazzo nicht bekannt ist, ob sie es in Rom selbst gesehen oder nur in Vasaris Buche darüber gelesen haben, so bleibt die Sache ungewiß. Möglich wäre, daß der heute in San Piero in Montorio, wo das Gemälde sich in der ersten Kapelle linker Hand befunden haben soll, sichtbare heilige Franziskus die letzten Reste dieser Malerei unter sich trägt.
Dagegen möchte ich in diese ersten römischen Zeiten eine Arbeit setzen, von der freilich niemand etwas erzählt, die aber unzweifelhaft von Michelangelo geschaffen worden ist und sich allen Merkmalen nach am besten hier einreiht: die Madonna des Nationalmuseums in London, welche, ehe sie an dieser Stelle einen festen Platz erhielt, in den Händen verschiedener Besitzer war, nach denen sie zeitweise genannt worden ist.
Es ist ein Temperabild und unvollendet. Die Komposition zerfällt in drei Teile: in der Mitte die Madonna, rechts und links von ihr je zwei jugendliche Gestalten dicht nebeneinander, Engel wenn man will. Die zur Linken sind nur in Umrissen da, die auf der anderen Seite aber vollendet und von so rührender Schönheit, daß sie zu dem Besten gehören, das Michelangelo hervorgebracht hat. Sei stehen dicht nebeneinander, zwei Knaben zwischen vierzehn und fünfzehn Jahren etwa, der vorn stehende im Profil sichtbar – die ganze Gestalt herab –, der hinter ihm en face; dieser hat seinem Genossen beide Hände auf die Schulter gelegt und blickt mit ihm zugleich auf ein Pergamentblatt, das derselbe mit beiden Händen vor sich hält, als läse er darin, auch hat er den Kopf etwas vorgeneigt und die Augen darauf niedergeheftet. Ein Notenblatt vielleicht, von dem beide singen; die halbgeöffneten Lippen könnten es andeuten. Die nackten Arme, die Hände, die das Blatt halten, von jugendlicher Magerkeit beide, aber mit einer Naturbeobachtung gemalt, die zu loben oder zu beschreiben unmöglich ist, reichten allein hin, um dieser Gestalt den höchsten Wert zu geben. Dazu aber der Kopf, die köstlich schlanke Figur, das leichte Gewand in anliegenden, vielfach geknickten Falten bis über die Knie herab, dann das Knie und das Bein und der Fuß; – es gibt eine Darstellung der Natur, die etwas fast zu Ergreifendes hat, – man fühlt tief im Herzen eine Liebe zu diesem Kinde und möchte die Hand ins Feuer legen, daß es rein und unschuldig sei. Das Gewand des anderen ist dunkel, es liegt ein Schatten über den Augen und im Auge selbst ein ganz anderer Charakter, doch nicht weniger liebenswürdig. Auch das Haar anders, die Locken dichter, dunkler und in Häkchen ausfahrend, während die des ersten sanfter und voller, hinter das Ohr zurückgestrichen, auf dem Nacken liegen.
Die Jungfrau sehen wir ganz von vorn. Ein heller Mantel ist auf der linken Schulter mit den Zipfeln zu einem starken Knoten zusammengebunden, verhüllt den rechten Arm beinahe und ist unten weitfaltig um und über die Knie geschlagen. Auf dem dunklen Haar liegt ein weißer Schleier, doch so, daß es ringsum sichtbar bleibt. Über ihren Schoß hin greift das Jesuskind nach dem Buche, das die Mutter in der Linken haltend ihm entzieht, wobei die Rechte, unter dem Mantel vorkommend, ihr behilflich wird. Es ist, als hätte auch sie selbst im Chor mitgesungen und eben das Blatt umwenden wollen, als das Kind ihr ins Buch griff, das sie leise nach links emporhält. Johannes steht rechts neben dem Jesuskinde mehr im Hintergrunde; ein Tierfell ist um das kleine Körperchen geschlagen, doch fast ohne es irgendwo zu verhüllen. Das Licht kommt von der Linken, dadurch fällt der Schatten, den die Gestalt der heiligen Jungfrau wirft, ein geringes über ihn.
Die beiden nur mit wenigen Linien angedeuteten Gestalten auf der anderen Seite neben der Madonna waren vielleicht Mädchen, im Gegensatze zu den Knaben dort. Von der Farbe kann ich nichts sagen, da ich nur Photographien vor Augen hatte.
Michelangelo hat viel unvollendete Werke hinterlassen. Seine heftige, oft abspringende Natur war schuld daran. Hier vielleicht mögen besondere Umstände mitgewirkt haben, die seinem Gedächtnisse jedoch wie das Bild selbst und die ganze so entfernt liegende Zeit nicht mehr zurückkehrten. Wüßte man, woher die Tafel stammt, so ließe sich möglicherweise dadurch mehr Licht gewinnen.
Michelangelos erste notorische Arbeit, die er in Rom ausgeführt hat, ist seine Statue des trunkenen Bacchus, die Arbeit wohl, an der er im August 1497 beschäftigt war. Er schreibt seinem Vater darüber. Nachdem er im Juli gemeldet, man solle ihn in Florenz nicht sobald zurückerwarten, weil der Kardinal noch immer nicht bezahlen wolle und man bei großen Herren nur allmählich mit seinen Ansprüchen aufkomme, meldet er sieben Wochen später, wie es ihm mit Piero dei Medici gegangen sei. Dieser habe ihm eine Statue in Auftrag gegeben, doch sei nichts daraus geworden, »weil ihm von seiten Pieros nicht gehalten worden sei, was er ihm anfangs zugesagt«, und deshalb, nachdem er obendrein bei dem Marmor Unglück gehabt und Geld verloren habe, arbeite er zu seinem eigenen Vergnügen jetzt an einer Figur.
Ist in der Tat der Bacchus hier gemeint, so fand sich auch ein Abnehmer dafür in der Person des Jacopo Galli, von Condivi ein Gentiluomo Romano »di bello ingegno« genannt, ein gebildeter, vornehmer Mann also. Dieser ließ das Werk für sich ausführen, das heute noch in unversehrtem Zustande erhalten ist, eine lebensgroße Gestalt, von der Michelangelos Zeitgenossen mit Bewunderung reden, während Neuere in diese unbedingte Anerkennung nicht einstimmen wollen.
Es ist kein göttlicher Rausch, von dem wir den Gott durchströmt sehen, kein heiliges Feuer der Trunkenheit, von dessen Gluten umhaucht uns die alten Dichter den die Welt durchziehenden Dionysos erblicken lassen, sondern das Taumeln eines weinerfüllten Menschen, der mit lächelndem Munde und matten Gliedern sich aufrecht zu erhalten strebt. Dennoch aber kein alter dicker Bauch, nichts Aufgeschwemmtes, sondern ein jugendlich schöngebildeter Körper. Mit der Antike verglichen, ein beinahe widerliches Abbild irdischer Schwäche, mit der Natur zusammengehalten, trotzdem das ideale Bild der von Wein erzeugten, zu den Wolken tragenden Fröhlichkeit.
Hören wir Condivi. »In jeder Hinsicht«, schreibt er, »ist dieser Bacchus der Gestalt und dem Ausdrucke nach den Worten der antiken Autoren entsprechend hingestellt. Das Antlitz voll heiterer Seligkeit, den Blick üppig und verlangend, wie bei denen der Fall zu sein pflegt, die den Wein lieben, hält er in der Rechten eine Schale, als wollte er trinken, und sieht sie an, als schlürfte er in Gedanken den Wein schon, dessen Schöpfer er ist. Deshalb trägt seine Stirne auch einen Kranz von Weinlaub. Über dem linken Arm hängt ein Tigerfell, weil ihm der Tiger, der den Wein liebt, heilig war. Mit der Hand hat er eine Traube gefaßt, von der ein kleiner hinter ihm stehender Satyr gewandt und listig die Beeren abnascht. Der Satyr ist wie ein siebenjähriges Kind, der Gott selber wie ein achtzehnjähriger Jüngling.«
Daß Condivi sich nur auf die antiken Schriftsteller und nicht auch auf die antiken Skulpturen beruft, ist ein Zeichen der Unbefangenheit, mit der man selbst in seinen Zeiten noch dem Altertum frei gegenüberstand. Man benutzte, was es darbot, sich aber durch es bestimmen zu lassen, fiel niemand ein. Szenen aus der griechischen Götterwelt wurden ebenso in die neueste Geschichte verlegt, wie dies mit den biblischen Erzählungen geschah. Mars ist ein nackter Florentiner, Venus eine nackte jugendliche Florentinerin, Cupido ein Kind ohne Kleider. Dem Künstler kam es nicht in den Sinn, die Natur, die er vor sich sah, etwa auf antike Muster hin verbessern zu wollen, zu »idealisieren«, wie heute der Handwerksausdruck lautet. Es wäre eine Unnatur gewesen, hätte Michelangelo einen trunkenen Bacchus anders darstellen wollen. Es ist ein vom Wein berauschter, nackter Jüngling. Er ist aufs Feinste ausgearbeitet. Seine Glieder sind rein und tadellos. Immerhin mag man sagen, die Natur des alten Donatello habe hier im jungen Michelangelo gewaltet. Aber wenn das Antlitz der Statue etwas gemein Natürliches an sich hat, so findet das darin seinen Grund, daß er einen silenenhaften Familienzug milde, aber erkenntlich hineinlegen wollte.
Gedenken wir aber noch einmal des schwärmenden Gottes der Griechen, dessen leuchtende Schönheit die empörten Schiffer bändigt und der die Tränen der verlassenen Ariadne trocknet. Durchdrungen von derartigen Anschauungen und befangen außerdem von der Erinnerung an die Werke der griechischen Bildhauer, deren zu Michelangelos Zeiten nur wenige bekannt waren, müssen wir heute uns künstlich erst auf seinen Standpunkt versetzen, um ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Michelangelos Statue steht heute in der Nationalgalerie in ebenso ungünstigem Lichte wie früher in den Uffizien. Shelley, der große englische Dichter, nennt sie in einem seiner Briefe ein empörendes Mißverständnis des Geistes und der Idee des Bacchus. Betrunken, brutal, albern, sei sie ein Bild der abscheulichsten Völlerei. Die untere Hälfte steif, die Art, wie die Schultern an Hals und Brust ansetzen, unharmonisch; kurz, die zusammenhanglose Phantasie eines Katholiken, der einen Bacchus göttlich habe darstellen wollen.
So ungerecht macht die Unkenntnis der näheren Umstände. Shelley kannte keine einzige der Bedingungen, unter denen dieses Werk entstanden war. Dennoch widerruft er sein Urteil selbst. »Die Arbeit aber, an sich betrachtet, hat Verdienste«, bemerkt er weiter. »Die Arme sind von vollendeter männlicher Schönheit, der Körper ist energisch modelliert, und alle Linien fließen kühn und wahrhaftig empfunden eine in die andere. Als Kunstwerk fehlt ihm nur die Einheit, als Bacchus alles.« Dieser Mangel an Einheit erschien Shelleys Augen gewiß nur deshalb als ein Fehler, weil die Statue am falschen Orte stand. Im Hofe des Palazzo Galli in Rom, wo sie noch zu Condivis Zeiten befindlich war, muß sie von der kühl hinunterströmenden Helligkeit des freien Himmels ganz anders umleuchtet gewesen sein. Der im Berliner Museum aufgestellte Abguß erlaubt, die Arbeit nun auch von der Rückseite zu betrachten. Die Beine und der Rücken zeigen hier eine bewunderungswürdige Feinheit der Ausführung.
Für denselben Galli arbeitete Michelangelo einen Cupido, der, nach fast drei Jahrhunderten des Verstecktseins, im Kensington-Museum wiederaufgetaucht ist, wohin er aus der Sammlung Campana in Rom gelangte. Daß er in dieser vorhanden war und woher er in sie kam, weiß und wußte niemand.
Ich kenne die Arbeit aus einem Gipsabguß sowie aus zwei vorzüglichen Photographien. Mit dem einen Knie auf dem Boden ruhend, stemmt Amor sich mit dem straffen Arme gegen die vordere Lehne des Wagens, auf dem er fährt, während er mit der anderen erhobenen Hand – die freilich heute restauriert ist – die Zügel der Tauben leicht hält, die einst vor dem Wagen vorn als Gespann sichtbar waren. Offenbar war er für einen hohen Standpunkt berechnet und darf deshalb auch im Abgusse nur von unten auf betrachtet werden. Wir haben nichts vor uns in ihm als einen Knaben von acht bis zehn Jahren, mit unendlicher Sorgfalt der Natur nachgebildet. Arme, Rücken, Schulter, Knie: alles flößt Bewunderung ein. Das Fleisch scheint weich, die Muskeln sind wie beweglich, das Momentane der Stellung ist in wunderbarer Kunst wiedergegeben.
V
Steht der Bacchus in unvorteilhaftem Lichte, so ist er doch wenigstens sichtbar. Michelangelos Hauptwerk aber, diejenige Arbeit, durch die er plötzlich aus einem geachteten Künstler zum berühmtesten Bildhauer Italiens ward, ist heute so gut wie verhüllt: die trauernde Maria mit dem toten Sohne im Schoße, »la Pietà«, wie die Italiener eine solche Gruppe nennen. Der Cardinal von San Dionigi, ein Franzose, bestellte sie bei ihm, und Jacopo Galli vermittelte den Auftrag. Im Kontrakte, den wir noch haben, verbürgte sich dieser dafür, Michelangelo werde ein Werk zustande bringen, schöner als irgendein in Rom vorhandenes, und besser als irgendeiner unter den lebenden Bildhauern es herstellen könnte. Selten ist die Schönheit eines anerkannten Meisterwerkes in solchem Maße durch eine ungünstige Aufstellung beeinträchtigt worden. Zuerst in eine Seitenkapelle der alten Basilika von Sankt Peter postiert, erhielt die Statue beim Umbau der Kirche einen anderen Platz und steht jetzt wiederum in einer Seitenkapelle des Sankt Peter so hoch und in so verzwicktem Lichte, daß es nur mit Mühe möglich ist, aus der Nähe oder aus der Ferne ihres Anblickes teilhaftig zu werden. Kopien, welche verschiedene Bildhauer für römische und florentinische Kirchen anfertigten, kommen nicht in Betracht. Es bleibt für die genauere Untersuchung nichts übrig, als sich an Abgüsse zu halten.
Das Material aber ist ein wesentlicher Bestandteil einer Bildhauerarbeit. Holz, Marmor, Bronze bedingen jedes eigentümliche Behandlung. Es kann eine Bronzearbeit nicht mechanisch in Marmor kopiert werden, ohne einen Teil ihres Inhaltes einzubüßen, noch weniger verträgt ein Marmorwerk die mechanische Nachbildung in Metall. Gips aber ist gar kein Material, ein negativer, toter Stoff, der statt der weichen, durchsichtigen, fast bewegten Oberfläche des Marmors nur eine starre, lastende Ruhe gibt. Die ideale Ähnlichkeit mit der menschlichen Haut, deren sanfte, leicht wechselnde Flächen und Linien der schöne Stein anzunehmen befähigt ist, geht beim Gips verloren, und dennoch ist er unentbehrlich, wie die Gelegenheit, bei der er eben so arg geschmäht wird, am besten darlegt.
Was sich bei näherer Betrachtung der Pietà zuerst zeigt, ist die ungemeine Vollendung des Einzelnen, verbunden mit einer wunderbaren Harmonie des Ganzen. Von allen Seiten bietet die Gruppe edle Linien. Die Stellung der beiden Gestalten zueinander ist die hergebrachte, viele Maler haben vor Michelangelo Maria und Christus ähnlich dargestellt. Aber wie sehr übertrifft Michelangelo sie sämtlich. Die Lage des auf den Knien der Frau ruhenden Körpers, die Falten ihres Gewandes, das ein quer über die Brust laufendes Band andrückt, die Neigung des Hauptes, das sich trostlos und so erhaben zu dem Sohne herabneigt, oder das seinige, das tot, erschöpft und mit milden Zügen in ihren Armen ruht: man fühlt, jeder Zug ist zum ersten Male geschaffen von Michelangelo, und das, worin er andere nachahmte in dieser Gruppe, war nur ein allgemeines Eigentum, das er benutzte, weil seine Anwendung hergebracht war. Nur Handwerker und Stümper reden von gestohlenen Ideen. Das geistige Eigentum besteht nicht in dem, was sich einem Meister nehmen läßt, sondern in dem, was ihm niemand rauben kann, und wenn er es selber gestatten wollte. Michelangelo wäre gar nicht imstande gewesen, die Gedanken anderer anzuwenden. Sie würden auf ihm gelastet haben, statt ihn zu fördern.
Unser tiefstes Mitleid wird erweckt durch den Anblick Christi. Die beiden Beine mit matten Füßen daran, die über dem Knie der Mutter seitwärts herabbaumeln, der hängende Arm, der eingeknickte, gesunkene Leib, das vom Halse hinterrücks gefallene Haupt, die Windung des ganzen Manneskörpers, der daliegt, als wäre er durch den Tod wieder zum Kinde geworden, das die Mutter in ihre Arme genommen hat, dabei im Antlitz eine wunderbare Vermischung des althergebrachten byzantinischen Typus, in länglichen Zügen mit geteiltem Barte, und der edelsten Bestandteile des jüdischen Nationalausdruckes: – Keiner vor Michelangelo wäre darauf verfallen; je öfter man das Werk betrachtet, um so rührender wird seine Schönheit; überall die reinste Natur, deren Inneres und Äußeres ineinander gehen. Was vor dieser Arbeit in Italien von Bildhauern geleistet worden ist, tritt in Schatten und nimmt das Ansehen von Versuchen an, denen es irgendwo fehlt, sei es am Gedanken oder in der Ausführung: hier deckt sich beides. Künstler, Werk und Zeitumstände greifen ineinander ein, und es entstand etwas, das vollkommen genannt zu werden verdient. Michelangelo zählte vierundzwanzig Jahre, als er seine Pietà beendete. Er war der erste Meister in Italien, der erste der Welt von nun an, sagt Condivi; ja man ging soweit zu behaupten, sagt er weiter, daß Michelangelo die antiken Meister übertroffen habe.
Wie war es möglich, daß in einer Zeit, wo die Auflösung aller politischen, sittlichen, äußerlich und innerlich religiösen Zustände zu erwarten sind, in Rom, dem Mittelpunkte der Verderbnis, ein Werk wie diese Madonna geschaffen, tief empfunden in ihrer Schönheit, und von einem jener Kardinäle mit teurem Golde bezahlt werden konnte?
Es wurden bei dem Werke damals Fragen aufgebracht, an die heute niemand denken würde. Man fand die Maria zu jung im Verhältnis zum Sohne. Uns stehen beide Gestalten so fern in betreff ihres irdisch-äußerlichen Lebens, daß dergleichen heute kaum auffallen würde, den Italienern aber von damals war die Sache wichtig, und es wurde darüber gestritten. Condivi wandte sich an Michelangelo selbst, und dieser gab ihm die Erklärung, die wir in seinen eigenen Worten niedergeschrieben finden. »Weißt du nicht«, antwortete er mir (sagt Condivi), »daß keusche Frauen sich viel frischer halten als die, welche das nicht sind? Um wieviel mehr aber eine Jungfrau, welcher sich niemals die geringste sündhafte Begierde in die Seele verirrte! Aber noch mehr, wenn eine solche Jugendblüte auf die natürlichste Weise schon in ihr erhalten blieb, so müssen wir glauben, daß die göttliche Kraft ihr noch zu Hilfe kam, damit der Welt die Jungfräulichkeit und unvergängliche Reinheit der Mutter Gottes um so deutlicher erschiene. Nicht so notwendig war das bei dem Sohne; im Gegenteil, gezeigt sollte werden, wie er in Wahrheit menschliche Gestalt annahm und allem ausgesetzt war, was einem sterblichen Manne begegnen kann, die Sünde ausgenommen. So war es hier nicht nötig, das göttliche Teil an ihm vor dem irdischen zu bevorzugen, sondern er mußte in dem Alter dargestellt werden, das dem Laufe der Jahre nach ihm zukam. Deshalb darf es dir nicht wunderbar erscheinen, wenn ich die heiligste Jungfrau und Mutter Gottes im Vergleich zum Sohne viel jünger darstellte, als die Rücksicht auf das gewöhnliche Älterwerden des Menschen verlangt hätte, und daß ich den Sohn in seinem natürlichen Alter ließ.«
Es ist den romanischen Völkern eigen, das Reich der Religion körperlicher zu empfinden, als uns möglich wäre. Bei uns fallen Religion und Sittlichkeit zusammen, bei den Romanen sind es getrennte Gebiete. Das Reich Gottes, das in unserer Seele jeder Gestaltung widerstrebt, ist den Romanen ein über den Wolken gelegenes Reich, ein ideales Abbild menschlichen Treibens enthaltend. Um den Thron Gottes (des sommo Giove, wie ihn Dante nennt) lagern sich die Heiligen in verschiedenen Rangstufen bis hinunter zu den geringeren Seelen, wie um den Papst die Fürsten, der Adel und das niedrige Volk sich scharten. Die Verzückung ist der Weg, der dahinführt. Das Bedürfnis, in diesem paradiesischen Staate einst einen sicheren Platz zu erhalten, ist jedem Romanen angeboren, und die römische Religion enthält die Lehre von seinem Wesen und von den Wegen, die zu ihm hinaufleiten. So ist dem Romanen seine Unsterblichkeit in Bildern bereits vorausgezeigt. Verhüllter, wenn er sie klar bedenkt, sicherer, wenn ihn die von der Phantasie erfüllte Sehnsucht zu ihr auf ihre Flügel nimmt. Er träumt von Glanz und Gold und Edelsteinen, zittert vor einem Meer brennenden Feuers oder badet sich mit vorauseilender Sinnlichkeit in den Sonnenfluten der Erkenntnis. Was besitzen wir Germanen dagegen? Einsam muß da jeder seinen Weg sich selbst suchen. Eine stille Erwartung mit der Gewißheit, nichts zu wissen, aber dennoch keine vergebene Hoffnung auf höheres Dasein gehegt zu haben, ist alles, was an die Stelle jener festen, strahlenden Bilder tritt. Das Heilige zeigt sich uns mehr in Gedanken und Taten, und Christus selber, wenn wir lesen, wie er auf Erden umherging und lebte, tritt uns dennoch nicht mit festem Antlitz und in irdischer Gestalt entgegen, daß wir seine Hände, die Falten seines Gewandes, den Gang seiner Füße in scharfen Linien zu sehen begehrten, sondern wir suchen die Gedanken zu ahnen, die er hegte, und begleiten ihn bis zu seinen letzten Augenblicken. Das äußerliche Bild seiner Qualen ist zu ergreifend beinah, als daß wir seine bildliche Darstellung ertragen könnten.
Bei den Romanen tritt dies Innerliche mehr zurück. In dem Maße, als sie das Körperliche vor Augen sehen, verschwimmen ihnen die Gedanken zu allgemeineren Gefühlen. Bei uns war gerade das Entgegengesetzte der Fall. Und diese Gefühle, die weniger dem, was tagtäglich getan und gedacht wird, entspringen, sondern wie eine ewige höhere Atmosphäre über ihren Herzen schweben, sind ihnen notwendig wie die Luft, die sie atmen. Auch in jenen Zeiten der höchsten Verderbnis mangelten sie nicht. Verworfen war nur die Geistlichkeit, die sich gerade am Ruder befand und die Religion repräsentierte: die Sehnsucht nach dem Reinen, Göttlichen war immer vorhanden, und das Aufhorchen von ganz Italien bei der Stimme Savonarolas beweist am besten, welch ein Drang die Gemüter erfüllte, sich frei zu machen von der Last jener parasitischen Vertreter Gottes auf Erden und zu dem reinen Inhalte des wahren Christentums zurückzukehren.
Ja, es kann behauptet werden, daß jene Zeiten befähigter waren als die unsrigen, die Gestalten und Ereignisse zu begreifen, deren Zusammenhang im Neuen Testamente erzählt wird. Was gehört nicht dazu, um die Verklärung auszudrücken auf dem Antlitze Christi, die dem Kampfe folgte, der seit achtzehn Jahrhunderten die Welt zu Tränen rührt. Man spricht uns heute zuerst davon als Kindern, wo wir nicht wissen können, was Verrat und Verlassenheit, was Leben und Sterben bedeutet. Und auch unser folgendes Leben, selbst wenn wir Schiffbruch leiden, läßt uns nie so offen gegen die Felsen anprallen. Es sind immer nur gemischte Gefühle, die uns bewegen, wenige von uns werden durch persönliches Schicksal auf die Tragödie vom Leiden Christi hingewiesen, die alles erschöpft, dessen unsere Phantasie an Mitleid fähig ist. Zu sterben wie der niedrigste Verbrecher zwischen Verbrechern, verraten zu sein und verleugnet aus der Mitte der nächsten Freunde, endlich selbst zu zweifeln und sich von Gott verlassen zu fühlen, einen Moment lang, und in ihm den Trost entbehren zu müssen, der einzig treu blieb! Und das alles der Lohn wofür? Daß man still und rein seinen Weg verfolgte, den Menschen hilfreich war und keinen beleidigte. Wer geht heute durch Ereignisse hindurch, die ihn einen Abglanz wenigstens dieses furchtbaren Geschickes erleben ließen?
Solche Zeiten waren die Michelangelos aber. Nun erfüllten sich die Prophezeiungen, die Savonarola über sich selbst getan. Er hatte mehr als einmal verkündet, daß seine Laufbahn ihm den Tod bringen müsse. Schritt für Schritt näherte er sich diesem Ausgang, bis er eintraf Und in Rom, wo man die Nachrichten aus Florenz täglich und in den genauesten Einzelheiten erfuhr, waren sie das, was unaufhörlich die Gedanken Michelangelos erfüllen mußte, während er an seiner Pietà beschäftigt war.
Das Jahr 96, in dem er Florenz verließ, war noch ein ruhiges gewesen im Vergleich zu dem folgenden. Die Piagnonen, diesen Namen führte die Partei Savonarolas, hatten das Übergewicht, und weder die Pest und Hungersnot in der Stadt noch der Krieg mit Pisa oder die Drohungen des italienischen Bundes vermochten sie irre zu machen. Sie hofften auf Frankreich, wo man zu einem neuen Feldzuge rüstete. Auch die Herkunft des römischen Königs erschütterte sie nicht.
Der italienische Feldzug Maximilians entsprang einer der romantischen Ideen, welche diesen Fürsten zu Unternehmungen veranlaßten, aus denen nichts wurde. Er hatte Lodovico Sforza als Herzog von Mailand anerkannt und belehnt, nachdem der junge Visconti, an dessen Leben der Besitz hing, endlich zugrunde gegangen war. Lodovico, der auf alle Weise Pisa wiederzugewinnen suchte und sich gegen die Venezianer, die denselben Zweck verfolgten, beide einstweilen vereint gegen Florenz, nicht stark genug fühlte, wollte Max in seinem Interesse benutzen und wußte ihm klar zu machen, daß ein Zug nach Italien die großartigsten Folgen haben müßte. Pisa und Florenz wären alte kaiserliche Lehen; käme er, so würde er zu entscheiden haben. Die Verbündeten würden sich natürlicherweise seinem Worte unterordnen und auch Florenz sich ihm fügen, und so, indem er durch die Schlichtung der wichtigsten Streitigkeit seine eigene Autorität stärke, verhelfe er ihm, seinem treuesten Bundesgenossen, zum Besitze Pisas, das in anderen Händen nur ein Machtzuwachs seiner Feinde sei. Max hatte weder Geld noch Truppen, beides stellte ihm Lodovico in Aussicht. So erschien er dann und segelte von Genua auf Livorno los, das die Florentiner hielten. Der Erfolg entsprach seinen Erwartungen nicht. Die Venezianer, statt sich zu fügen, schickten frische Truppen nach Pisa, die Florentiner wiesen ihn absolut zurück, und er mußte, wie er gekommen war, nach Deutschland wieder abziehen.
Als man aber in Florenz erfuhr, daß des Königs von Frankreich neuer Kriegszug sich ins Ungewisse hinausziehe, als die Getreideschiffe der florentinischen Kaufleute, die aus der Provence anlangten, dicht vor Livorno weggefangen oder zurückgescheucht wurden und die Pest zunahm, traten die Parteien immer schärfer sich entgegen. Es gab deren drei in der Stadt: die Freunde der Medici, die Feinde Savonarolas, und seine Anhänger. Die ersteren, nach dem Wappen der Medici, das aus einer Anzahl Kugeln, palle, bestand, die Pallesken genannt. Die Gegner Savonarolas, die Arrabiati, das heißt die Wütenden, er selbst hatte ihnen den Namen gegeben. Die Piagnonen aber überboten beide. Ihre Prozessionen erfüllten die Stadt, ihre Gebete und die Predigten ihres Führers waren die Hauptwaffen, mit denen sie siegten. Er aber herrschte, und alles befestigte nur seine Macht und sein Ansehen. Als die Anerbietungen des italienischen Bundes immer lockender und die Aussicht auf das Kommen der französischen Armee immer unsicherer wurden, hielt er an der Hoffnung fest und bestand auf seinem Willen. Mitten in der Hungersnot, die die Stadt und Umgegend überdeckte, daß die Landleute in Scharen hereinkamen und halbtot vor Erschöpfung in den Straßen lagen, organisierte er die Wohltätigkeit der Seinigen. Die Karnevalsumzüge, wo die Kinder mit Blumenkränzen, in weißen Kleidern und mit roten Kreuzen in den Händen Gaben sammelten, schlossen mit einer Verteilung an die verschämten Armen. Einmal, als die Not am größten war, im Jahre 96, ließ er eine ungeheure Prozession veranstalten, und gerade, als alle Straßen voll von Menschen sind, kommt ein Kurier durch das Tor gesprengt mit der Nachricht, daß eins der erwarteten Getreideschiffe angelangt sei. Es hat etwas Rührendes zu lesen, wie der Reiter, einen grünen Zweig hoch in der Hand haltend, durch das begeisterte Gedränge sich durcharbeitet über die Arnobrücke das Ufer entlang zum Palaste der Regierung. Solche augenscheinliche Wunder erhöhten die Macht Savonarolas ins Unbegrenzte. Es findet sich aber keine Spur, daß er sie mißbraucht hätte.
Zu Weihnachten 1496 versammelte er mehr als dreizehnhundert Knaben und Mädchen bis zu achtzehn Jahren in Santa Maria del Fiore und ließ sie kommunizieren. Die Frömmigkeit der Kinder mitten in der drohenden Zeit rührte das Volk, das sie umgab, so, daß es in laute Tränen ausbrach. Der Karneval 97 brachte eine Wiederholung der geistlichen Spiele des vorigen Jahres. Abermals eine Pyramide, aus Gegenständen der Verdammnis aufgebaut in lichten Flammen und eine Segnung der Häuser, aus denen man dazu beigesteuert, abermals Tänze, Absingen geistlicher Lieder und das Geschrei: viva Cristo il rè di Firenze! viva Maria la regina! Zu Zeiten aber wurde dies Geschrei Savonarola selber zu viel, und er warnte von der Kanzel gegen den Mißbrauch der heiligen Worte.
Die Begeisterung, die er erregte, hatte ihre ziemlich nüchternen Seiten. Wenn wir von den Tänzen hören und die Lieder ansehen, die zu diesen Festen der höheren Tollheit, maggior pazzia, wie er es selber nannte, gedichtet wurden, wenn wir uns vorstellen, wie Jung und Alt dahineingezogen ward, wie er die Kinder gegen ihre unfrommen Eltern aufhetzte, sie zu einer öffentlichen Sittenwache gestaltete, daß sie die Leute auf der Straße anreden und in die Häuser eindringen durften, wie Gebet und Gesang das Leben des Tages unaufhörlich unterbrechen, so scheint alles auf den Kopf gestellt und die Herrschaft krankhafter Ideen durchgeführt, deren Steigerung zur Verrücktheit führen muß; genauer betrachtet aber stellen sich die Dinge anders dar. Die Grundlage seiner Lehre ist keine puritanische Moral, sondern die Bekämpfung des Lasters und Aufrechthaltung der öffentlichen Sittlichkeit, wie sie etwa heute bei uns überall ohne Widerspruch durchgeführt wird. Nirgends verlangt er Außerordentliches von den Leuten, aber freilich war das öffentliche Leben der Art, daß den Florentinern Beschränkungen, die uns natürlich erscheinen, unerträglich dünkten. Seine Anweisungen, wie man den Tag zu beginnen und seine Geschäfte zu betreiben habe, wie man im Hause und auf der Straße auf den Anstand achten solle, sind kaum der Rede wert; wo sie seltsam erscheinen, liegt dies mehr in den allgemeinen Sitten der Zeit als darin, daß unerhörte neue Dinge von ihm ersonnen werden. Nirgends tritt er kategorisch befehlend auf, sondern die Abscheulichkeit der Laster und der übermäßigen Leidenschaften erklärt er logisch aus sich selbst. Nirgends gibt er pedantische Normen, sondern appelliert an die eigene Einsicht der Zuhörer. Er wettert gegen seine Feinde und fordert auf, sich gegen sie zu kehren wie er selber tue, aber es läßt sich kein Wort nachweisen, womit er zur Gewalt gegen sie aufgereizt. Ja, es geht aus seinen Predigten hervor, daß er auch in den Zeiten, wo er wirklich alles vermochte, keinen Zwang ausübte. Wenn er ehrbare Frauen immer wieder ermahnt, sich züchtig anzuziehen und auf der Straße den Dirnen und Kurtisanen nicht aus dem Wege zu weichen, sondern sie stolz und furchtlos zur Seite zu drängen, so sieht man schon daraus, wie wenig er die Üppigkeit in Florenz zu überwältigen vermochte, denn diese Aufforderung finden wir ununterbrochen in seinen Predigten, ein Zeichen, daß die Dirnen sich nicht abhalten ließen, auf den Straßen eine Rolle zu spielen.
So auch der Kampf der Parteien gegeneinander, der im Consiglio grande unablässig auf- und abwogte. Er zeigt, wie frei man sich bewegte und wie vorsichtig die Piagnonen trotz ihrer Übermacht sich von einem feindlichen Zusammenstoße zurückhielten. Sogar die Tänze haben etwas Natürliches. Es war eine alte Vorstellung, sich die ewige Seligkeit als einen Tanz zu denken. Fiesole malt die Freuden des Paradieses in Gestalt von Tänzen der Engel, die abwechselnd mit frommen Mönchen Hand in Hand lange Ketten bilden und singend emporschweben. Dies war die Idee der Aufzüge, zu denen Savonarola in den Sitten der Stadt eine Aufforderung fand. Wenn er in früheren, stilleren Zeiten als Prior seines Klosters mit den Mönchen hinaus ins Freie gezogen war und sie im Walde sitzend zuerst über theologische Dinge gelehrter Weise disputiert und seine Worte gehört hatten, ließ er sie nach beendigten Übungen einen Tanz ausführen. Endlich die gesungenen Lieder mit ihren seltsamen Worten dürfen nicht nach gemeinem Sinne genommen werden, sie hegen einen tieferen mystischen Inhalt, wie er gleichfalls den damaligen theologischen Anschauungen natürlich war.
Gerade diese Zurückhaltung der Piagnonen machte den Arrabiaten eine immer wirksamere Opposition möglich. Man arbeitete von Florenz aus in Rom darauf hin, Savonarola das Handwerk legen zu lassen. Ende 96 war die dritte Ermahnung vom Papste eingetroffen, sich des Predigens zu enthalten. Savonarola hatte sie schriftlich beantwortet und sich eine Zeitlang still gehalten, dann aber auf Bitten der florentinischen Regierung trotz dem Papste die Kanzel aufs neue bestiegen. Vielleicht hätte er die Sache durchsetzen können, denn man fühlte in Rom zu tief die Notwendigkeit einer Reform und wollte zugleich die Florentiner durch Nachgeben herüberziehen. Wir haben einen Brief Michelangelos an seinen Bruder Buonarroto, der die gerade in jenen Tagen in Rom herrschende Stimmung beschreibt. Alle Welt spreche dort von Savonarola und erkläre ihn für einen stinkenden Ketzer. Am besten würde sein, wenn er in Person erscheinen und als Prophet auftreten wolle: man werde ihn dann zum Heiligen machen. Freilich schimpfe Fra Mariano auf ihn, und es seien neulich erst fünf Ketzer gehangen worden, aber er möge nur den Mut nicht verlieren. Aus dem Schreiben klingt recht heraus, daß die Anhänger Savonarolas damals noch obenauf waren und den Mut nicht verloren hatten. Savonarola aber tat jetzt nach anderer Seite hin etwas Entscheidendes. Er begann sich tiefer in die Verfassungsverhältnisse der Stadt einzumischen, seine Partei beging Fehler auf diesem Gebiete und trug selber zu seinem Sturze bei.
Die Vereinigung der Arrabiaten und Pallesken war allmählich eine so vollständige geworden, daß sie im Consiglio grande die Majorität bildeten. Aus dem Schoße des Consiglio aber wurden die Staatsämter besetzt, und die Majorität gab den Ausschlag. Bisher hatten die Pallesken mit den Piagnonen zusammengestimmt, weil sie unter einer Signorie von Piagnonen besser für die Medici wühlen konnten als unter den Arrabiaten, die sich energisch nach beiden Seiten hin kehrten und die Freiheit ohne Savonarola, aber auch ohne die Medici, verlangten. Die Piagnonen dagegen mußten zum Danke für die geleistete Hilfe stets einige von den Pallesken in die Signorie hineinlassen, und hierauf hatte Piero dei Medici seine Pläne gebaut.
Die Piagnonen wußten das. Sie wollten nun keine Pallesken mehr in der Signorie haben. Die Arrabiaten, deren Wut gegen Savonarola täglich wuchs, machten den Pallesken Konzessionen, und so kam es zu gemeinschaftlichem Handeln der beiden gegen das Zentrum.
Die Piagnonen sahen sich in der Minorität und sannen darauf, sich zu verstärken. Francesco Valori, der für Januar und Februar 97 Gonfalonier war, setzte eine Verfassungsänderung durch, die seiner Partei das verlorene Übergewicht einbringen sollte. Valori stand in so enger Verbindung mit Savonarola, daß anzunehmen ist, von diesem sei der Plan erdacht oder wenigstens gutgeheißen worden.
Bisher war ein Alter von dreißig Jahren erforderlich gewesen, um Eintritt in das Consiglio zu erlangen. Von jetzt ab sollte das zurückgelegte vierundzwanzigste genügen. Savonarola zählt auf die begeisterte Jugend, auf die jungen Männer, welche ihn als Kinder gehört, und auf die Kinder, welche ihn noch hörten und rasch heranwuchsen.
Um den Vorschlag durchzubringen, hatten sich die Pallesken noch einmal zur Verbindung mit den Piagnonen bereitfinden lassen, verlangten dafür aber, sich in die Signorie für März und April in bedeutendem Maße gewählt zu sehen. Sie hatten ihre geheimen Pläne. Die Hungersnot hielt die Stadt in Aufregung; am 10. März wurde der Markt vom gemeinen Volk gestürmt; die Massen waren den Medici immer günstig gewesen, und die Pallesken taten das ihrige, um das Andenken an die alten, milden Herren nicht einschlafen zu lassen.
Um ja nicht den mindesten Verdacht zu erregen, befürwortete die Regierung dem Papste gegenüber die Sache Savonarolas. Im stillen verhandelten sie mit Piero. Geheime Boten gingen hin und her mit Briefen. Es wurde festgesetzt, wenn er vor der Stadt eintreffen solle, wenn er die Tore offen finden würde. Die Orsini hatten die nötigen Truppen aufgebracht. An einem Festtage, wenn jedermann auf dem Lande wäre, sollte der Überfall ausgeführt werden. Am 28. April geschah es. Piero erschien mit seinen Reitern vor dem Tore San Piero di Gattolini; sperrweit standen die Flügel offen, und er konnte die Straße entlang bis tief in die Stadt sehen, die niemand verteidigte. Vier Stunden aber stand er so und wagte sie nicht zu betreten, denn keine Seele regte sich zu seinen Gunsten.
Derweilen hatte man drinnen Zeit gehabt, sich zu fassen. Die Signorie war schon vorher verdächtig erschienen, jetzt hielt man die Herren im Palaste fest, schloß die Tore der Stadt und fuhr Kanonen auf. Piero machte kehrt mit seinen Reitern und kam abends in Siena wieder an, wie er früh morgens ausgeritten war. Gegen die Signoren hatte man in Florenz keine Beweise in der Hand. Ihre Amtszeit war abgelaufen, sie traten ab und die gesetzlichen Nachfolger an ihre Stelle. Diesmal aber waren es die Arrabiaten, die ans Ruder kamen!
Valoris Maßregel war schuld daran. Die neuen jugendlichen Mitglieder des Consiglio hatten zum ersten Male mitgestimmt. Statt jedoch für Savonarola entflammt zu sein, offenbarten sie eine ganz andere Gesinnung. Junge Männer sind keine Kinder mehr. Bis dahin hatten sie die Abbestellung des alten fröhlichen Lebens still ertragen müssen, jetzt besaßen sie Stimme, Macht und Einfluß, und indem sie mit klingendem Spiel in das feindliche Lager einzogen, bewirkten sie, daß mit einem Male die Situation umschlug, und während von den früheren Regierungen alles für Savonarola geschehen war, nun nichts versäumt wurde, wodurch man ihn unterdrücken zu können vermeinte. Pasquille und Sportgedichte gegen ihn tauchten auf. In Rom, wo der florentinische Gesandte bisher auf das künstlichste die beabsichtigte Exkommunikation aufzuhalten gewußt hatte, trafen plötzlich entgegengesetzt lautende Instruktionen ein. Fra Mariano da Genazzano, der einst in Lorenzos Auftrage gegen Savonarola gepredigt hatte und kürzlich aus Florenz verwiesen worden war, weil er den verunglückten Aufstand zu Gunsten Pieros vorbereiten half, drängte im Vatikan zu entscheidenden Maßregeln. Die Franziskaner- und Augustinermönche in Florenz, die alten Feinde der Dominikaner, erhoben sich mit ungewohnter Kühnheit, und bald kam es so weit in der Stadt, daß Savonarolas persönliche Sicherheit gefährdet schien.
Unter den vornehmen, jüngeren Leuten der Florentiner Bürgerschaft bildete sich eine Verbindung, die Genossen, gli compagnacci, genannt. Ihr Zweck war, den alten Florentiner Straßenunfug wieder herzustellen. Am 1. Mai war die neue Signorie eingetreten, und am dritten bereits, als Savonarola im Dome predigte, kam es durch die Compagnacci zu öffentlichem Skandal. Er wollte die Kanzel besteigen und fand sie mit einer Eselshaut behangen und mit Unrat beschmutzt. Man entfernte das, die Predigt begann, mittendrin brach ein höllischer Lärm aus; Savonarola mußte aufhören. Umgeben von seinen Anhängern, die bewaffnet mit ihm zogen, kehrte er nach San Marco zurück, und in derselben imponierenden Begleitung erschien er tags darauf im Dome wieder, wo diesmal die Ruhe nicht gestört wurde.
Am 12. Mai unterzeichnete Alexander Borgia die Exkommunikation. Die Nachsicht sei erschöpft, Savonarolas Ausstoßung solle öffentlich bekannt gemacht und ihm das Predigen mit Gewalt unmöglich gemacht werden. Aber der Kommissar des Papstes wagte es nicht, die Exkommunikation persönlich nach Florenz zu bringen; von Siena aus ließ er sie der Signorie einhändigen, die sie gleichfalls öffentlich anzuschlagen nicht den Mut besaß. Sie entschuldigte sich damit, daß man sie ihr nicht direkt, sondern durch zweite Hand habe zukommen lassen. Dagegen erklärten die Augustiner und Franziskaner, sie würden sich an der großen Prozession des Sankt Johannisfestes nicht beteiligen, wenn die Dominikaner zugelassen würden. Man deutete deshalb diesen an, sich an jenem Tage zu Hause zu halten.
Savonarola aber, nachdem der Schlag endlich gefallen war, fühlte sich nun aller Fesseln frei und ledig. Auf die Bannbulle des Papstes erließ er eine Antwort, worin er Fra Mariano, den geistigen Urheber dieses Verdammungsbriefes, als einen Menschen darstellt, der gegen den Papst selber die schändlichsten Dinge aussagt und verräterisch gegen ihn gehandelt habe. In einem offenen Briefe, der an alle Christen gerichtet ist, verwahrt er sich gegen den Vorwurf, ketzerische Dinge gepredigt und dem Papste und der Kirche den Gehorsam verweigert zu haben. Die Exkommunikation sei ungültig. Nur dann dürfe man seinen Oberen gehorchen, wenn ihre Befehle nicht gegen Gottes Wort verstoßen.
Damit aber sagte er sich allerdings vom Gehorsam los. Um jedoch den Beweis dafür zu geben, wie notwendig seine Handlungsweise sei, donnerte er nun gegen die Laster Roms mit einer Schärfe und Offenherzigkeit, gegen die seine früheren Predigten nur verblümte Andeutungen erscheinen. Und ihm zur Seite versuchten seine literarischen Freunde die Kompetenz des Papstes in Frage zu stellen.
Mai und Juni gingen hin. Die Arrabiaten hatten trotz ihrer Energie nichts Entscheidendes bewirken können. Die Pallesken lösten sich wieder los von ihnen und schufen vereinigt mit den Piagnonen für Juli und August eine Signorie, die sogleich alles rückgängig machte, was die Arrabiaten vor sich gebracht. In Rom wurde das Unmögliche aufgeboten, eine Rücknahme der Kirchenstrafe zu erwirken. Einflußreiche Kardinäle verwandten sich in diesem Sinne. Die Dominikaner von San Marco verfaßten eine Verteidigungsschrift, die mit einer langen Liste beistimmender Unterschriften versehen nach Rom abging.
Borgia aber hatte seine eigene Methode. Er bestand darauf, Savonarola solle sich persönlich stellen. Entschuldige er sich hinreichend, so werde er ihn mit seinem Segen entlassen; werde er schuldig befunden, so wolle er ihn gerecht, aber barmherzig bestrafen. Jedermann aber wußte, was Segen und Barmherzigkeit hier zu bedeuten hatten. Einfacher war das Mittel, das der Kardinal Piccolomini vorschlug. Fünftausend Goldgulden würden den Papst umstimmen, meinte er. Die Summe hätte sich leicht aufbringen lassen. Savonarola schlug das aus, wie er früher den Kardinalshut ausgeschlagen, mit dem sein Stillschweigen erkauft werden sollte.
So unterhandelte man zwischen Rom und Florenz, als hier plötzlich Geheimnisse zutage kamen, welche den Streit der Parteien zur Wut aufstachelten. Die Verschwörung, durch welche Piero im April sich der Stadt hatte bemächtigen wollen, wurde entdeckt. Es stellte sich heraus, daß die Signorie für März und April den Umsturz der Dinge vorbereitet hatte, und das Ärgste, daß für Mitte August eine neue Erhebung zugunsten der Medici in Vorbereitung war.
Fünf Männer von den ersten Familien, darunter der ehemalige Gonfalonier, wurden eingezogen und nach rascher Verhandlung zum Tode verurteilt. Der Plan lag offen da, die Schuld war nicht abzuleugnen. Alles wurde verraten, nicht nur der verabredete Tag, sondern die Liste der Familien, deren Häuser und Paläste der Zerstörung des niederen Volkes preisgegeben werden sollten. Noch mehr, zwei von den Verurteilten, Gianozzo Pucci und Lorenzo Tornabuoni, die bis dahin als die gläubigsten Anhänger Savonarolas aufgetreten waren, hatten, wie nun zum Vorschein kam, diese Maske angenommen, um sich in die Beratungen der Piagnonen einzudrängen und ihre Geheimnisse zu besitzen. Denen war zumute, als hätten sie auf einem Vulkan geruht. Um sich zu rächen, brauchten sie nur Gerechtigkeit fordern.
Aber den Verurteilten stand ein Ausweg offen: die Appellation an das Consiglio grande. Valori hatte diese Berufung selbst eingeführt. Jetzt trat zum zweiten Male der Fall ein, daß Institute, die seine Partei zu ihren eigenen Gunsten gemacht hatte, von entgegengesetzter Wirkung waren. Die Tornabuoni, Pucci, Cambi, Ridolfi gehörten zu den ersten Häusern der Stadt und konnten auf ihren Anhang im Volke rechnen. Bernardo del Nero, der hochverrätische Gonfalonier, ein ehrwürdiger, die aus alter Freundschaft und Dankbarkeit erwachsene Anhänglichkeit an die Medici ausgenommen, rein und unbescholten dastehender Mann von fünfundsiebzig Jahren, hatte nicht vergebens das Mitleid der Bürger angesprochen, zu welcher Partei sie auch gehören mochten.
Die Signorie war in der schwierigsten Lage. Die Freisprechung der Angeklagten durch das Consiglio grande hätte die Piagnonen dahin gebracht, sich in Waffen zu erheben, um die Rache zu vollziehen, welche die Regierung verweigerte. Die Appellation aber nicht zu gestatten, war gegen das Gesetz. In Rom, in Mailand, in Frankreich boten die Medici alle Kräfte auf, um ein Interesse für die Opfer ihrer Politik heraufzubeschwören. Francesco Valori jedoch machte jeden Rettungsversuch zunichte. Sein Haus war unter denen gewesen, die gestürmt und geplündert werden sollten. Giovio behauptet, der brennende Haß dieses Mannes gegen Bernardo del Nero habe den Ausschlag gegeben. Die übrigen vier wären seine Freunde gewesen, aber um diesen einen zu treffen, habe er sie mitgeopfert. Nach den heftigsten Szenen im Schoße der Regierung gab diese die Erklärung ab, daß die höhere Rücksicht auf das Wohl des Staates die Suspension des Gesetzes für den vorliegenden Fall notwendig mache, und die Fünfe wurden vom Leben zum Tode gebracht.
Ob Savonarola diese Tat herbeiführte oder ob er sie verhindern konnte, seinen Einfluß jedoch geltend zu machen unterließ, ist nicht festzustellen. Sicher ist nur, daß man schwankte und daß Valoris Energie den Ausschlag gab. Er, als eifrigster Anhänger Savonarolas, wälzt auf diesen eine höhere Verantwortung. Es liegt das in der Natur der Sache und so wurde geurteilt. Savonarola erschien als der Urheber des Entschlusses, und seine Schuld strahlte zurück über die Sekte der Piagnonen. Sie hatten das Gesetz gemacht, sie es umgangen. Es gab keine schwerere Anklage in dem auf Beobachtung der Gesetze so peinlich gerichteten Kaufmannsstaate. Ein Vorwurf ließ sich erheben von nun an, der nicht zurückzuweisen war. Mochten die Verhältnisse noch so zwingend gewesen sein, das Gesetz war mißachtet worden. Von diesem Momente an, sagt Machiavelli, ging es abwärts mit Savonarola.
Dennoch blieb die Regierung bis zum März 98 im Besitze seiner Anhänger. Zu Rom dieselben Verhältnisse. Der Papst verlangt persönliches Erscheinen, Savonarola antwortet mit Briefen und Büchern. Die Geistlichkeit von Santa Maria del Fiore, der Erzbischof voran, wollen nicht dulden, daß ein Exkommunizierter ihre Kanzel besteige, die Regierung beseitigt ihren Widerspruch. Der Andrang des Volkes war ungeheuer, wenn Savonarola predigte. Der Karneval wurde zum dritten Male nach dem Ritus gefeiert, den er vorgeschrieben, niemals erschien die Macht des Mannes so groß als in diesen Tagen, und doch standen die so nahe bevor, die die letzten seines Wirkens und seines Lebens werden sollten.
VI
Ich finde, wo von Savonarola die Rede ist, seinen Untergang zu sehr als das Resultat der Bemühungen seiner Feinde und des päpstlichen Zornes dargestellt. Die zwingendste Ursache seines Falles war das Erlöschen seiner persönlichen Gewalt. Das Volk ermüdete. Er mußte stärker und stärker auf die Geister einwirken. Es gelang eine Zeitlang, die einschlafende Begeisterung wieder emporzureizen. Aber während sie nach außen hin sogar zu wachsen schien, zehrte sie doch von ihren letzten Kräften. Savonarola kam auf den Punkt, wo er übermenschlich stark hätte sein müssen, um sich ferner zu behaupten.
Die großen Familien der Stadt gehörten von Anfang an zu den Anhängern der Medici oder doch zu Savonarolas systematischen Gegnern, den Arrabiaten; nur wenige hielten sich zu den Piagnonen, solche, die ebensosehr der Ehrgeiz als die innige Überzeugung auf Savonarolas Seite stellten. Seit der Einführung des Consiglio grande, in welchem jeder Bürger, arm oder reich, seine eine Stimme hatte, empfand der Adel tagtäglich, wieviel er bei der Neugestaltung des Staates verloren. Niedrige Persönlichkeiten, Handwerker, die aus ihrer Werkstatt kamen, gelangten durch die Stimmenmehrheit ihrer Partei zu den höchsten Staatsämtern. Die Strenge, mit welcher die Luxusgesetze durchgeführt wurden, erschien wie eine Rache der weniger Begüterten gegen die Reichen. Diesen Anschein einer Rache nahm auch die Hinrichtung der fünf Verschworenen an: es sollte auf eklatante Weise gezeigt werden, daß sie durch ihren Rang und ihr Vermögen nicht geschützt seien. Immer mehr mischten sich solche Gefühle mit der zuerst rein religiösen Begeisterung. Man war für Savonarola, aber man war auch für Valori und für die anderen, die neben ihm von oben herab die Menge leiteten. Und so hatten also doch wieder einige wenige vornehme Familien durch Savonarola die Führung des Staates usurpiert und die geringeren nach sich gezogen.
Nach außen hin kam man nicht vorwärts. Pisa blieb verloren; Karl der Achte kehrte nicht zurück; mit dem Papste war kein Übereinkommen zu treffen. Hungersnot und Pest hatten die Stadt stark angegriffen, der Handel konnte die dauernde Unsicherheit nicht länger tragen. Es zogen sich die Wolken zusammen gegen Savonarola wie gegen Piero einst, und das Gefühl machte sich geltend, daß der allgemeine Zustand nicht der richtige sei.
Savonarola überblickte die Lage der Dinge. Er hatte seinen Untergang vorausgewußt und verkündet, aber er war nicht willens, ohne Kampf zu weichen. Die Opposition in Florenz konnte er bewältigen, seine Feinde im Vatikan aber blieben unverwundbar, solange der Papst nicht selber beiseite geschafft worden war; ihn mußte er treffen. In energischen Sendschreiben an die höchsten Fürsten der Christenheit: den Kaiser und die Könige von England, Spanien und Frankreich forderte er, mit Berufung auf die anerkannte Verworfenheit Borgias und die Notwendigkeit einer Reform des Kirchenregimentes, die Konstituierung eines Konzils, auf welchem der Papst gerichtet und abgesetzt würde. Einen dieser Briefe, den an Karl den Achten gerichteten, fing Lodovico Sforza auf und ließ ihn in den Vatikan gelangen.
Die scharfen Predigten Savonarolas hatten dem Papst keine Unruhe verursacht bis dahin. Borgia kümmerte sich wenig darum, seine Taten zu verbergen, oder um das, was darüber geurteilt wurde. Großartigere Dinge hatte er im Sinne als den Streit mit diesem Prior von San Marco. Ein Konzil aber war die wunde Stelle seiner Macht, das einzige was die Päpste fürchteten. Denn die Anschauung behauptete sich damals noch als die herrschende, daß die versammelten Kardinäle den Papst zur Verantwortung ziehen und absetzen könnten.
Alexander forderte die Regierung von Florenz kategorisch auf, Savonarola das Predigen zu untersagen und ihn nach Rom auszuliefern. Keiner schriftlichen Rechtfertigung, sondern tatsächlichem Gehorsam sehe er entgegen. Er werde die Stadt mit dem Interdikt belegen im Weigerungsfalle. Savonarola predigte von jetzt an im Dome nicht weiter, in der Kirche seines Klosters aber um so heftiger. Dies geschah in den ersten Tagen des März 98. Er drang von der Kanzel herab auf die Berufung des Konzils. Wütend erließ der Papst eine erneuerte Aufforderung nach Florenz, er werde es die florentinischen Kaufleute in Rom büßen lassen! – aber die neue Signorie, obgleich ihrer Majorität nach aus Arrabiaten gebildet, wagte nicht sogleich einzuschreiten. Nach stürmischen Beratungen wurde Savonarola dann aber dennoch auch das Predigen im Kloster verboten. Mehr wagte man nicht gegen ihn. Am 18. März predigte er zum letzten Male, und indem er dem Papste, der römischen Wirtschaft und den Florentinern das Eintreffen göttlicher Strafen voraussagte, nahm er, bewegt zu gleicher Zeit von der Ahnung seines baldigen Unterganges, Abschied von der Gemeinde.
Liest man diese letzten Predigten, so kann man nicht anders, als den Mann bewundern, der inmitten einer Wüste unklarer Leidenschaften die reine Straße seiner Überzeugungen wandelnd sich freiwillig zum Opfer für seine Lehren hingibt. Er hätte noch immer das Volk zur Wut bringen und einen Kampf heraufbeschwören können, dessen Ausgang zweifelhaft gewesen wäre. Doch er verschmähte andere Waffen als die, welche in der Seele des Menschen liegen. Er wollte nur aussprechen, was ihm klar vorstand. Mochte dann daraus werden, was gut war. Immer blieben seine politischen Ansichten deutlich und einfach. Intrige und Eigennutz kannte er nicht. Seinen Bruder, der durch seine Fürsprache Karriere zu machen wünschte, wies er ab. Die einfachste Lebensart führte er. Ein Ton der Wahrhaftigkeit klingt aus seinen Worten, deren herzgewinnende Macht heute noch auf traurig seltsame Weise anlockt und versöhnend das Widerstreben, das wir empfinden, in Bedauern auflöst.
Man begreift die Täuschung so sehr, der er sich hingab. Zuerst begeisterte er das Volk, das er mit der Ahnung eines edleren Daseins erfüllte. Er vergaß, daß die menschliche Natur nur zu vorübergehenden Augenblicken des Aufschwunges befähigt ist, daß diese Momente sich vielleicht verlängern und einige Zeit festhalten lassen – er aber wollte ihr plötzliches Aufflammen in dauernde Gluten verwandeln, er schürte, er goß den Florentinern sein eigenes Feuer in die Adern, das ihn selber doch verzehrte, er schuf einen Fanatismus, den er, betrogen durch seine Kraft und Beständigkeit, für das wirkliche Eintreten der reineren Natur hielt. Und da endlich, wo er selber ermattend sich auf diese Stärke stützen wollte, mußte er gewahren, daß er allein und einzig die Kraft gewesen und daß das Echo nicht selber eine Stimme geworden war, die fortsprach, als seine eigenen Worte verstummten. Sein beobachtender Geist war zu klar, als daß ihm nicht immer eine Ahnung dieses Endes der Dinge geblieben wäre, sein unerbittlich scharfer Blick ließ es ihn jetzt sogleich gewahren. Deshalb redet er von seinem Untergange mit solcher Gewißheit und schreibt zu Ende seines Briefes an den Papst, der noch in vollem Selbstgefühl und zu einer Zeit verfaßt worden ist, wo er nichts zu befürchten Grund hatte, daß er mit inniger Sehnsucht den Tod erwarte.
Die Signorie erachtete sich nach Savonarolas freiwilliger Resignation weiterer Schritte überhoben. Sie ließ dem Papste durch ihren Gesandten notifizieren, daß seinen Wünschen gemäß verfahren worden sei, und man beruhigte sich dabei für den Augenblick. Allein jetzt begann in Florenz und innerhalb der Partei der Piagnonen selber aus dem Samen, den Savonarola gestreut, eine Saat zu wachsen, die das Gift trug, das ihn tötete.
Er hatte sich nie für einen Propheten ausgegeben, wohl aber als auserwähltes Werkzeug Gottes hingestellt, durch welches die Zukunft verkündet würde. Er lehnte eigentlich nur den Namen eines Propheten ab, um nicht des Hochmutes bezichtigt zu werden, als wolle er sich den Propheten des Alten Testamentes anreihen. In seinen Predigten redete er einzelne an, als durchschaue er ihre Seele ganz und gar, von Wundern hatte er gesprochen, durch welche die Stadt errettet werden würde, Visionen hatte er mitgeteilt, die ihm den Willen Gottes offenbarten, und die Idee nicht zurückgewiesen, daß durch ihn selbst Wunder geschehen könnten.
Daran glaubten die Piagnonen wie an eine unumstößliche Wahrheit. Sie vertrauten auf die Macht seiner Persönlichkeit. Als Piero damals vor der Stadt erschienen war, die unverteidigt offenstand, und man mit der Nachricht zu Savonarola stürzte, antwortete er ruhig, sie brauchten die Tore Pieros wegen nicht zu schließen, dieser werde die Stadt dennoch nicht zu betreten wagen. Und Medici hatte kehrt gemacht nach Siena! Dem Volke war Savonarola als der Prophet, der Zauberer, der Heilige, der Mann, dem Gott die Verfassung der Stadt offenbart hatte, der alles wußte, alles konnte, und dem keine Gewalt etwas anzuhaben vermochte. Seine Feinde aber hielten ihn für einen Betrüger, der dem Volke diesen Aberglauben mit Schlauheit aufzudrängen verstand.
Nun aber liegt es in der Natur der großen Menge, daß sie von Zeit zu Zeit glänzende Beweise von der Machtfülle des Mannes zu sehen verlangt, den sie für so mächtig hält. Savonarola hatte die Ankunft der Franzosen vorausgesagt, hatte das Eintreffen von Getreideschiffen während der Hungersnot vorher verkündet, hatte manches gesagt und gewußt, was der, den es betraf, für sein innerstes Geheimnis hielt, aber das war allmählich alt geworden und man begehrte frische Taten. Man verlangte etwas, woran man sich von neuem berauschen könnte, dessen bloße Erwähnung alles zu Boden schlüge, was Savonarolas Feinde vorbrachten. Die Signorie hatte ihm das Predigen untersagt und er sich zurückgezogen. Man hegte die Erwartung, er werde mit einer ungeheuren Tat plötzlich neu hervortreten und, wie so oft geschehen, glänzend triumphieren über seine Gegner.
So dachte man während der Fastenzeit 98, als Domenico da Pescia, sein treuester Anhänger und Genosse, statt seiner in San Marco predigte, während in den übrigen Kirchen die anders gesinnte Geistlichkeit laut gegen ihn die Stimme erhob. Ein Franziskaner, der in Santa Croce predigte, Francesco da Puglia, forderte Savonarola heraus, durch ein Wunder die Echtheit seiner Lehre zu beweisen. Auf der Stelle entgegnete Domenico, er wolle durchs Feuer gehen für Savonarola. Das Wort, einmal ausgesprochen, greift dämonisch um sich, und bald war die Sache so gedreht, daß Savonarola selber durch die Flammen schreiten werde; seine Freunde drängten ebensosehr als seine Gegner, und so gewiß waren die Piagnonen ihrer Sache, daß alle die dreihundert Mönche von San Marco nebst einer Anzahl von Nonnen, Männern, Frauen und Kindern in Gemeinschaft mit ihm die Probe zu bestehen begehrten.
Die Signorie nahm die Angelegenheit in die Hand. Es wurde angefragt bei Savonarola. Er lehnte die Probe ab, gedrängt aber von Freunden wohl noch mehr als von der Gegenpartei, erklärte er sich endlich bereit. Ein Scheiterhaufen sollte auf der Piazza errichtet werden und von der einen Seite Savonarola, von der anderen der Franziskaner, der seine Person gegen ihn einsetzen wollte, in die Flammen steigen.
Die Sätze, für die Savonarola so mit seinem Leben einstand, waren folgende: »Die Kirche bedarf der Umgestaltung und Erneuung. – Die Kirche wird von Gott gezüchtigt werden. – Danach wird sie umgestaltet, erneuet und blühend werden. – Die Ungläubigen dann bekehrt werden. – Florenz wird gezüchtigt werden, sich dann erneuen und frisch aufblühen. – Alles dies in unseren Tagen. – Die verhängte Exkommunikation ist ungültig. – Wer sich nicht an sie kehrt, sündigt nicht.« – Wichtig war nun der letzte Satz als eine Verneinung der päpstlichen Macht in einem besonderen Falle, der aber doch für alle Fälle gelten konnte.
Savonarola ahnte nicht, als er am 7. April auf der Piazza erschien, daß zu derselben Stunde König Karl von Frankreich sein Leben aushauchte. Ein Schlagfluß raffte ihn hin zu Amboise. Wäre es nach Savonarola gegangen, so hätte er Italien noch einmal befreit, Pisa den Florentinern zurückgegeben, ein Konzil berufen, einen anderen Papst eingesetzt, dann weiter die Ungläubigen bekämpft, besiegt und bekehrt. Viele mächtige Männer teilten diese Idee, wenn auch aus weniger erhabenen Ursachen. So aber war nichts geschehen, der König starb hin, und das Schicksal kehrte sich nicht an die Gedanken derer, die die Zukunft nach ihrem Willen zu gestalten dachten.
Man hatte quer über die Piazza einen erhöhten Pfad bereitet, der zu beiden Seiten mit brennbaren Stoffen umschichtet, in eine Allee von Flammen verwandelt werden konnte. Bewaffnete sperrten den Platz, das Volk umdrängte ihn und füllte die Fenster und Dächer der umliegenden Gebäude. Franziskaner und Dominikaner zogen auf, schweigend jene, diese mit geistlichen Liedern. Die Probe sollte beginnen. Da erhoben die Franziskaner Einwendungen. Savonarola solle die Kleider wechseln. Man vermutete einen Zauber darin. Man untersuchte ihn bis auf die nackte Haut. Man stritt, die Zeit verging, Ungeduld und Hunger ermüdete das Volk; es fing an zu regnen, der Tag war abgenutzt, ohne daß etwas geschah; das Gerücht verbreitete sich, Savonarolas Feigheit sei schuld an dieser Verzögerung. Endlich wurde verkündet, daß es nichts sei für heute mit der Feuerprobe.
Die Piagnonen waren diejenigen, welche das Gefühl der allgemeinen Enttäuschung am stärksten empfanden. Sie hatten auf glänzende Befriedigung ihres Stolzes gerechnet, nun trugen sie Spott davon und hatten nichts zu erwidern. Niemand verfiel darauf, was später oft behauptet worden ist, die Verzögerung sei eine künstliche, von der Signorie im Einverständnis mit den Franziskanern herbeigeführt gewesen, deren Effekt man, wie er eintraf, erwartete. Ohne daß ihnen ein Härchen versengt worden wäre, zogen die Franziskaner triumphierend ab, während Savonarola auf dem Wege nach San Marco mit den Waffen gegen die andrängende Menge geschützt werden mußte. Dort angekommen, betrat er die Kanzel, erzählte alles was sich begeben hatte, und entließ seine Anhänger.
Soviel steht fest: bereits am 30. März, eine Woche also vor diesen Ereignissen, hatte die Signorie den geheimen Beschluß gefaßt, daß die Brüder von San Marco oder die Franziskaner, je nachdem das Gottesurteil ausfallen würde, das florentinische Gebiet verlassen müßten. Am 6. April, als nur von Domenico da Pescia und von Savonarola noch nicht die Rede gewesen war, hatte man den zweiten Beschluß gefaßt, daß Savonarola, falls Domenico im Feuer umkäme, binnen drei Stunden fort müßte. Endlich soll ein dritter Beschluß zustande gekommen sein, des Inhaltes: dem Franziskaner dürfe unter keinen Umständen gestattet werden, die Probe zu bestehen. Man fürchtete also das Eintreffen eines Wunders und glaubte im Lager der Feinde selbst an Savonarolas göttliche Kraft. Doch bleibt das Dasein dieses letzten Beschlusses noch zu beweisen.
Viele von den Piagnonen flohen auf der Stelle, andere hielten sich bewaffnet in den Häusern oder zogen ins Kloster von San Marco, wo man sich in Verteidigungszustand setzte. Es war nichts Seltsames damals, daß Klöster in Festungen verwandelt wurden. Aus den angesehensten Familien waren die Söhne in San Marco eingetreten, um sich dem geistlichen Stande zu weihen; ihre Verwandten kamen jetzt, um an ihrer Seite den Sturm zu erwarten und zurückzuschlagen.
Der nächste Tag, 8. April, war der Palmsonntag. Von ihm ist der Beschluß der Signorie datiert, daß Savonarola aus Florenz verbannt sein sollte. Morgens früh predigte er in der Kirche des Klosters. Am Schlusse verkündete er voraus, was geschehen würde, nahm Abschied von den Seinigen und gab ihnen seinen Segen. Erst gegen Abend regten sich die Arrabiaten. Im Dome predigte ein Dominikaner. Die Compagnacci sprangen auf, schrien und drängten auf die Piagnonen ein, die flüchtend ins Freie stürzten. Draußen stand eine ungeheure Menge, der Ruf ertönte plötzlich von allen Seiten: zu den Waffen, zu den Waffen! nach San Marco, nach San Marco! Dort war die Kirche gefüllt, von draußen schlug man die Türen zusammen und stürmte hinein, von innen leistete man Widerstand und wehrte sich. Da erschien die Garde des Palastes. Sie fand die Eingänge des Klosters verrammelt und verzweifelte Verteidiger hinter den Toren, Mönche mit Panzern über ihren Kutten und mit Arkebusen, aus denen sie Feuer gaben, und mitten darunter die Frauen und Kinder, die die Kirche nicht hatten verlassen können und deren Geschrei dem Gebrüll der Menge draußen antwortete. Ein junger, blondbärtiger Deutscher, Heinrich mit Namen, war der tapferste unter den Mönchen von San Marco und wußte mit seiner Büchse besonders gut umzugehen.
Nachdem die Diener der Signorie sich Gehör verschafft, verkündeten sie den Befehl, daß alle die, welche nicht ins Kloster gehörten, dasselbe zu verlassen hätten. Wer nicht ginge, würde als Hochverräter behandelt werden. Viele gehorchten. Savonarola wollte sich freiwillig ausliefern, aber die Seinigen hielten ihn gegen seinen Willen zurück. Sie fürchteten, das Volk möchte ihn in Stücke zerreißen. Das Kloster hatte eine kleine Gartentür, durch diese suchten einige der angesehensten Piagnonen zu entrinnen. Unter ihnen Francesco Valori. Dem aber paßten die Tornabuoni, Pucci und Ridolfi auf mit den anderen, die diesen Tag der Rache so sehnsüchtig erwartet hatten. Umringt, wird er sogleich zu Boden geschlagen, daß er tot liegen bleibt, und weiter geht es nun zu seinem Palaste. Seine Frau, die oben am Fenster stand, erschießen sie von der Straße aus mit einer Armbrust, stürmen das Haus, plündern es und erdrosseln ein Enkelkind Francescos, das noch in der Wiege lag. Besser erging es den Soderinis. Hier trat der Bischof von Volterra, der ein Soderini war, im vollen Ornate den sich heranwälzenden Massen entgegen und brachte sie durch seinen Anblick und donnernde Rede zur Umkehr.
Vor San Marco war es stiller geworden, die Nacht lag längst über dem Kloster, als das wütende Volk dahin zurückkehrte. Feuer wurde angelegt, die Tore verbrannt und durchbrochen und Savonarola von den Leuten der Signorie, ohne deren Schutz er verloren gewesen wäre, in den Palast abgeführt. Mit ihm Domenico da Pescia und ein dritter Dominikaner, Silvestro mit Namen. Kaum vermochte man ihn vor Mißhandlungen des Pöbels zu schützen. Sie stießen ihn und schrien lachend, er solle doch prophezeien, wer es gewesen sei. Sie riefen: Arzt hilf dir selber! Auf dem Platze vor dem Kloster lagen Tote und Verwundete. Die Mönche kamen heraus und trugen sie zu sich hinein, um ihnen zu helfen oder sie zu begraben.
Und nun begann ein Prozeß, der kurz war, aber der unendlich erscheint, wenn man Schritt vor Schritt den Qualen folgt, die Savonarola zu erdulden hatte. Der Papst verlangte ihn nach Rom, bequemte sich jedoch, einen Kommissar zu schicken. Savonarola ward gefoltert; es wird genau berichtet auf welche Weise; die Kräfte verließen ihn unter den Händen seiner Peiniger, denn er war eine zarte kränkliche Natur; kaum losgelassen widerrief er alles. In diesem Zustande noch verfaßte er rührende Schriften. Die Tortur wiederholte sich zu verschiedenen Malen. Nardi, der in seinen Angaben sehr gewissenhaft ist, versicherte, er habe aus den besten Quellen gehört, daß die Akten gleich beim Niederschreiben gefälscht seien. Der Kommissar des Papstes gestand später gleichgültig offen ein, Savonarola sei ohne Schuld gewesen und der Prozeß erfunden, den die Florentiner nur ihrer Rechtfertigung wegen hätten drucken lassen. Savonarola wurde zum Tode verurteilt und am 23. Mai 1498, am Himmelfahrtstage, das Urteil vollzogen.
Auf dem Platze vor dem Palaste der Regierung war der Scheiterhaufen errichtet. Aus seiner Mitte ragte ein hoher Pfahl mit drei Armen, die sich nach verschiedenen Seiten ausstreckten. Als die drei Männer über eine Art fliegende Brücke zu diesem Galgen hinschritten, steckte der florentinische Pöbel spitze Pflöcke von unten auf zwischen den Brettern des Ganges hindurch, in die sie mit ihren nackten Füßen hineintraten. Savonarolas letzte Worte waren Trost für seine Genossen, die mit ihm duldeten. Da hingen sie nun alle drei und die Flammen schlugen zu ihnen auf. Ein mächtiger Windstoß trieb diese noch einmal zur Seite; einen Moment lang glaubten die Piagnonen, ein Wunder werde sich ereignen. Doch schon hatte sie das Feuer wieder verhüllt, und bald stürzten sie mit dem brennenden Gerüste in die Glut nieder. Ihre Asche wurde von der alten Brücke herab in den Arno geschüttet. Welche Gedanken müssen Savonarolas Seele bewegt haben, als das Volk, das er Jahre lang gespornt oder gezügelt hatte, das er so völlig mit seinen Lippen beherrschte, stumpf und teilnahmlos umherstand.
VII
Das härteste, dessen man Savonarola beschuldigt hat, ist der Vorwurf, er habe seine Partei angestachelt, ihre Gegner mit Gewalt aus dem Wege zu räumen. Dies sagt Machiavelli. Es sei nur darum nichts daraus geworden, behauptet er, weil das Volk seine Andeutungen nicht scharf genug verstanden habe. Darauf ist zu antworten, daß die Piagnonen zu verschiedenen Malen im Begriff standen, mit den Waffen dreinzuschlagen, und daß Savonarola sie zurückhielt. Es ist ferner zu erwidern, daß Machiavelli, dessen Unbefangenheit in anderen Fällen so bewunderungswürdig erscheint, sich dennoch diesem Manne gegenüber vom Haß der Partei zu einseitigen Behauptungen verführen ließ. Er gehörte zu denen, die Savonarola für einen bewußten Lügner hielten und nach Rom über ihn in diesem Sinne berichteten. Das älteste Schriftstück, das wir von Machiavelli haben, ist ein Brief über Vorgänge aus jenen stürmischen Tagen. Gründlicher Haß atmet aus diesem Schreiben. Machiavelli war damals noch nicht dreißig Jahre alt und eben in den Staatsdienst eingetreten.
Wo liegt nun das, das über die Verehrung, die der Mann einflößt, dennoch einen trüben Schatten wirft? Ich will ihn mit einem anderen Mönche von San Marco vergleichen, der lange vor ihm lebte und der das Kloster nicht weniger berühmt gemacht hat als er. Die Wände seiner Gänge, seiner Kapellen, niedriger, dunkler Zellen sogar, sind bedeckt von den Malereien Fiesoles, eines von den Nachahmern Giottos, dessen Werke, erfüllt von reizender Reinheit der Empfindung und verklärt durch eine Art süßer, in sich selbst beschlossener Begeisterung, zu den merkwürdigsten und ergreifendsten Denkmalen einer Künstlerseele gehören.
Seine Arbeiten sind in der Tat beinahe nicht zu zählen; in gleichmäßiger sanfter Schwärmerei scheint er ohne Aufhören seine Träume dargestellt zu haben. Die Gestalten trugen etwas Ätherisches an sich. Er malt Mönche, die am Kreuze niedersinkend, mit zitternder Inbrunst seinen Stamm umarmen, er malt Scharen von Engeln, die aneinandergedrängt die Luft durchschweben, als wären sie alle ein langgestrecktes Gewölk, dessen Anblick uns mit Sehnsucht erfüllt. Es waltet ein so unmittelbares Verhältnis zwischen dem, was er darstellen wollte, und dem, was er zu malen vermochte, und zugleich war das, was er wollte, stets so einfach und verständlich, daß seine Bilder auf jeden einen unmittelbaren, unvergeßlichen Eindruck machen, und so manche Naturen in dieselbe Begeisterung zu versetzen fähig sind, in der sie selbst geschaffen zu sein scheinen.
Im Jahre 1387 geboren, also ein Zeitgenosse Ghibertis und Brunelleschis, legte Fiesole mit einundzwanzig Jahren sein Gelübde ab; achtundsechzigjährig starb er in Rom, wo sein Grabmal noch vorhanden ist. Eigentlich war er Miniaturmaler, man sieht das auch seinen Freskobildern an. Sein Leben nach Vasaris Beschreibung klingt wie eine Legende aus uralten frommen Zeiten. Er sollte Prior des Klosters werden, lehnte jedoch die Würde demütig ab, und all seine Schicksale und Werke spiegeln das Gefühl, das ihn so bescheiden zurücktreten ließ. Und dennoch war die Wirkung, die von ihm ausging, groß und dauert jetzt noch.
Vergleichen wir den Geist seiner Gemälde mit dem der Predigten Savonarolas, die dieser inmitten der Klosterhallen hielt, von deren Wänden die Werke Fiesoles niederschauten, so empfinden wir am schärfsten, was Fiesole besaß und was Savonarola fehlte, was ihn bei seinen Gegnern so furchtbar verhaßt machte. Ein heiliger Eifer für das Gute, Wahre, Sittliche, Große entflammte sein Herz, aber daß ohne die Schönheit das Gute nicht gut, das Wahre nicht wahr, das Heilige selbst nicht heilig sei, das entging ihm. So wurde er, das weichste Gemüt, unversöhnlich und zwang seine Gegner, es auch zu sein, und so vernichtete er sich. Er vergaß, daß das, was die Menschen am meisten zwingt und bildet, nicht der bewußte Gehorsam, der heftig unterdrückte Hang zum Bösen, das gewaltsam sich selbst leitende Beharren auf einer scharf gezogenen Linie ist, die zu Gott leiten soll, sondern daß das unbewußte Aufnehmen eines freundlichen Beispiels, das leise Nachgeben, wenn das Gute und Schöne mit lockender Stimme redet, und das schmetterlingsartige Fortflattern, dem Göttlichen dennoch immer zugewandt, die Mächte eigentlich sind, die die Menschheit geheimnisvoll, aber sicher weiterführen. Und so haben Fiesoles sanfte, stumme Bilder mehr getan als Savonarolas Donner, die beinahe spurlos verhallten. Kaum aber war Savonarola gestorben, so umgab ein Heiligenschein seine Gestalt, der Inhalt seiner letzten Tage wurde als das ruhmvolle Leiden eines Märtyrers von Mund zu Mund getragen und mit Erzählungen von Wundern untermischt. Wie sein Herz nicht mit verbrannt, aus den Tiefen des Arno wieder emporgewirbelt und von seinen Verehrern unversehrt aufgefischt worden sei. Dem Unterliegen in den Qualen der Tortur setzte man das Beispiel des Apostel Petrus entgegen, der unter weniger dringenden Umständen den Herrn verleugnet hätte. Dagegen der jämmerliche Tod des Königs von Frankreich, der hingerafft wurde, nachdem ihm sein Kind vorausgegangen war, erschien als die unmittelbare Strafe des Himmels, die Savonarola vorausverkündete. Savonarolas Bild mit einer Strahlenkrone ums Haupt wurde in Rom selber auf den Straßen feilgeboten.
Der Gedanke drängt sich uns auf, daß sein Leiden und sein Tod auf den schaffenden Künstlergeist Michelangelos nicht ohne Einwirkung geblieben sei. Im November 1498 ging er nach Carrara, um den Marmor für die Pietà selbst zu holen. An Ort und Stelle dort scheint er die erste Arbeit getan zu haben und im April mit dem Blocke nach Rom zurückgekommen zu sein. Nur ein Jahr war für die Ausführung bedungen worden, über zwei Jahre jedoch sehen wir Michelangelo vom Beginn der Arbeit an in Rom noch bleiben: ohne Zweifel, weil die Vollendung seines Werkes ihn dort festhielt.