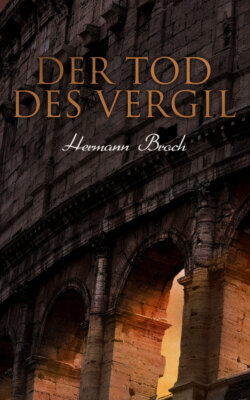Читать книгу Der Tod des Vergil - Hermann Broch - Страница 8
ОглавлениеAtmen, ruhen, warten, schweigen. Aus der Nacht kommend, in die Nacht sich ergießend, strömte das Schweigen, und lange währte es, bis er es unterbrach: «Komm, setze dich zu mir», beschied er den Jungen an seine Seite, und auch als sich dieser zu ihm hingekauert hatte, hielt das Schweigen an, blieben sie vom Schweigen umfangen, hingegeben der schweigenden Nacht. Von ferneher tobte es, tobte der Lärm der Schauwütigen, tobte das Getöse des Festes, brodelte das Kreatürliche, orkusartig, dumpf, unabwendbar, verlockend, unzüchtig und unwiderstehlich, wild und satt zugleich, blind und starrend, die stampfende Herde, die im schattenlosen Truglicht der Fackeln und Brände sich an den Unheilsabgrund des Nichts drängt, fast unrettbar, fast unerrettbar, würde nicht selbst auch noch hierin - und je länger man hinlauschte, desto deutlicher wurde es vernehmbar - ja würde nicht auch noch hierin der Gesang des Schweigens enthalten gewesen sein, enthalten seit jeher, enthalten für immer, des Schweigens Glockengeläute, anschwellend zum erzenen Geläute der Nacht und zum Geläut aller Menschenherden, leise singend die Herdennacht, aufseufzend die Herde in ihrem großen Schlaf: tief unter dem Humus des Seins, schattenrauschend und kindheitsverborgen, schicksalsentlöst, zufallsentlöst und unzuchtsfrei wohnet die Nacht; aus ihr sprießt das Kreatürliche, durchflutet vom Rauschen der Nachtsäfte, geschwängert vom Schlafe, ewig befruchtet vom Quell aller Innigkeit, es sprießen aus ihr in unsäglicher Verwebung und einander einverleibt Pflanze, Tier und Mensch, einander verschattet, denn der Fluch der Rückkehr ist im Segen des Schlafes geborgen, und es ist die holde Decke des Seins, ein Traum-Nichts über das Nichts gebreitet.
Oh, das Irdische! Ätherwelt und Nachtwelt im unablässigen Ein- und Ausatmen, schwebend zwischen der doppelten Verlockung der Schattengröße und der Schattenlosigkeit, unabänderlich die Gezeiten des Ablaufs eingespannt zwischen den beiden Polen der Zeitaufhebung, der tierischen und der göttlichen Zeitlosigkeit - oh, in allen Adern des Irdischen, in allem was der Erde entsprossen ist, strömt die Nacht aufwärts, unaufhörlich zu Wachheit und Bewußtheit verwandelt, Innen und Außen zugleich, das Gestaltlose zum dunkelhaltigen, schattenbergenden Gebilde formend, und zwischen dem Nichts und dem Sein, schwebend in solchem Schweben, wird die Welt zu Dunkelheit und Licht, wird sie erkennbar in ihrer Schatten- und Lichthaf-tigkeit. Immer tönt in der Seele, ob leiser, ob lauter, niemals jedoch verlierbar, das Glockengeläute der Nacht, das Glockengeläute der Herden, immer das Löwengebrüll des Tages, erschütternd im Lichte und in der Erkanntheit, der goldene Sturm, der das Kreatürliche verschlingt -, oh, Erkenntnis des Menschen, noch nicht Erkenntnis, nicht mehr Weisheit, aufsteigend aus dem Humus des Seins, aufsteigend aus dem Ur-Lebenden, aufsteigend aus der Mütter Weisheit, emporsteigend in die tödliche Klarheit der Über-Helle, des Über-Lebens, emporsteigend zur brennenden Vater-Erkenntnis, emporsteigend zur Kälte, oh, Erkenntnis des Menschen, unverwurzelte, ewig bewegte, die nicht unten und nicht oben ist, sondern stets an der Dämmerschwelle zwischen Nacht und Tag schwebt, ein Aufatmen und ein Atmen im Zwischenreich der Sternendämmerung, zwischen dem Leben der nächtlichen Herde und dem Tode der lichtumflossenen Vereinzelung, zwischen dem Schweigen und dem Worte, das wieder ins Schweigen zurückkehrt. Nichts Irdisches vermag wahrhaft den Schlaf zu verlassen, und nur wer niemals der Nacht vergißt, die in ihm wohnt, vermag den Ring zu schließen, vermag aus der Zeitlosigkeit des Anfanges zu der des Endes heimzukehren, vermag den Kreislauf stets aufs neue zu beginnen, er selber Gestirn im Unwandelbaren des Zeitenablaufes, aus der Dämmerung aufsteigend, in der Dämmerung verschwindend, Geburt und Wiedergeburt im Nächtlichen und aus dem Nächtlichen, empfangen vom Tage, dessen Helle in das Dunkel eingegangen ist, nachtbergender Tag: ja, so waren die Nächte gewesen, all die Nächte seines Lebens, all die Nächte, durch die er gewandert war, die Nächte, die er durchwacht hatte, voll Angst vor der Bewußtlosigkeit, die unter den Nächten droht, voll Angst vor der Schattenlosigkeit, die über ihnen ist, voll Angst, den Pan zu verlassen, voll einer Angst, die um die Gefahr der zwiefachen Zeitlosigkeit weiß, ja, so waren jene Nächte gewesen, gebannt an die Schwelle des doppelten Abschiedes, Nächte des unabänderlich gleichbleibenden Weltenschlafes, obwohl auf den Plätzen, auf den Gassen, in den Schenken, unweigerlich gleichbleibend in Städten und Aber-Städten von Anbeginn an, unhörbar hertönend aus allen Zeitenfernen und eben darum um so eindringlicher gewußt, die Menschen tobten, Schlaf auch dies, obwohl in Festräumen und Aber-Festräumen sich die Machthaber der Welt feiern ließen, umbrandet von Fackeln und Musik, angelächelt von Gesichtern und AberGesichtern, umworben von Leibern und Aber-Leibern und selber lächelnd, selber werbend, Schlaf auch dies, obwohl die Wachtfeuer brannten, nicht nur vor den Burgen, sondern ebenso draußen, wo Krieg war, an den Grenzen, an den nachtschwarzen Flüssen und an den nachtrauschenden Waldrändern und unter dem blinkenden Angriffsgegröle der aus dem Dunkel hervorbrechenden Barbaren, Schlaf auch dies, Schlaf und Aber-Schlaf wie jener der nackten Greise, die in stinkenden Höhlen sich ihren letzten Rest Wachheit vom Leibe schliefen, wie jener der Säuglinge, die aus dem Elend ihrer Geburt heraus in die dumpfe Wachheit eines künftigen Lebens traumlos hineinträumten, wie jener der angeketteten Knechtsrotte in den SchifFsbäuchen, die wie betäubtes Gewürm auf den Bänken, auf den Planken, auf den Taubündeln hingestreckt waren, Schlaf und Aber-Schlaf, Herde und Aber-Herde, heraufgehoben aus der Ununterscheidbarkeit ihres Urbodens gleich Nachthügelketten, die in der Ebene ruhen, eingesenkt ins unabänderlich Mütterliche, in die ständige Wiederkehr, die noch nicht Zeitlosigkeit ist und sie trotzdem in jeder irdischen Nacht neu gebiert; ja, so waren diese Nächte gewesen, so waren sie es noch immer, so war es auch diese, vielleicht für immerdar, Nacht an der Schwellenkippe von Zeitlosigkeit und Zeit, von Abschied und Wiederkunft, von Herden gemeinschaft und einsamster Einsamkeit, von Angst und von Rettung, und er, an die Schwelle gebannt, Nacht für Nacht an der Schwelle wartend, trübsichtig im Zwielicht des Nachtrandes, in des Weltenrandes Dämmerung, er, wissend um das Geschehen des Schlafes, er war heraufgehoben worden ins Unabänderliche, und selber Gestalt werdend, wurde er zurückgestürzt und aufwärtsgestürzt in die Sphäre der Verse, in das Zwischenreich des irdischen Erkennens, in das Zwischenreich der Mütter, der Weisheit und der Dichtung, in den Traum, der jenseits des Traumes ist und an die Wiedergeburt rührt, Ziel unserer Flucht, die Dichtung.
Flucht, oh, Flucht! oh Nacht, die Stunde der Dichtung. Denn Dichtung ist schauendes Warten im Zwielicht, Dichtung ist dämmerahnender Abgrund, ist Warten an der Schwelle, ist Gemeinschaft und Einsamkeit zugleich, ist Vermischung und Angst vor der Vermischung, unzuchtsfrei in der Vermischung, so unzuchtsfrei wie der Traum der schlafenden Herde und doch Angst vor solcher Unzucht: oh, Dichtung ist Warten, noch nicht Aufbruch, aber immerwährender Abschied. Er spürte an seinem Knie, unmerklich fast, die Schulter des hingekauerten Knaben, er sah nicht das Antlitz, spürte nur, wie es im eigenen Schatten versunken war, indes, er sah das wirrdunkle Haar in dem das Kerzenlicht spielte, und er gedachte jener fürchterlichen, glückhaft-glücklosen Nacht, in der er, vom Schicksal getrieben, ein Liebender und Gehetzter auch hier, zu der Plotia Hieria gekommen war und ihr, der Hingekauerten, der winterlich Harrenden, winterlich Unerschlossenen nur eben Verse vorgelesen hatte -, es war die Ekloge von der Zauberin gewesen, jene auf Wunsch und Auftrag des Asinius Pollio verfertigte Ekloge, die ihm niemals so gut geglückt wäre, wenn nicht der Gedanke an die Plotia, wenn nicht die Sehnsucht und die Lustbangigkeit nach dem Weib dabei Pate gestanden hätten, und die ihm doch nur so gut geglückt war, weil er von allem Anfang an gewußt hatte, daß es ihm niemals vergönnt sein würde, die Schwelle zu verlassen und in die vollkommene Nacht der Gemeinschaft einzugehen; ach, weil der Wille zur Flucht ihm seit jeher auferlegt war, hatte er die Ekloge vorlesen müssen, und Furcht wie Hoffnung hatten sich erfüllt, es war zum Abschied geworden. Und ebenderselbe Abschied war es gewesen, der dann nochmals und später und größer von dem Äneas erlebt werden sollte, da er, bemüßigt vom rätselhaft unergründlichen Schicksalsablauf der Dichtung, mit flüchtenden Schiffen ins Unwiderrufliche ziehend, die Dido verlassen hatte, für immer verzichtend bei ihr zu liegen, mit ihr zu jagen, für immer geschieden von ihr, die ihm süßer Schatten der Wirklichkeit gewesen, der süße Schatten der Lust, für ewig geschieden von der Nachthöhle der Liebe unter den Gewittern. Ja, Äneas und er, er und Äneas, sie waren geflohen in einem wirklichen Aufbruch, nicht nur im verharrenden Abschiednehmen der Dichtung, sie waren aus deren Zwischenreich geflohen, als taugte es nicht für den Lebenden, obwohl es auch jenes der Liebe ist -, wohin ging diese Flucht ? aus welcher Tiefe stammte diese Furcht vor Junos mütterlichem Geheiß? Ach, die Liebe ist bereits Hinabsinken unter den Spiegel der Nacht, ist Hinabsinken zu dem nächtlichen Urgrund, an dem der Traum zur Zeitlosigkeit wird, die Schwelle seiner selbst unterschreitend, zum Urgrund des Ungestalteten, des Unerschaubaren, das stets lauernd bereit ist, gewittergleich zerstörerisch hervorzubrechen: nur die Tage verändern sich, nur durch die Tage rinnt die Zeit, und am taghell Bewegten ist es die Zeit, die vom Auge geschaut wird; unbeweglich groß hingegen ist das Auge der Nacht, in dessen Tiefe die Liebe ruht, das Auge, das leer und brennend und starr im Sternenscheine, unabänderlich und unablässig, Nacht für Nacht, über alle Zeiten hinweg die irdische Zeitlosigkeit in sich erneuert -, weltenschöpfend und weltenverschlingend aus seiner tiefsten Augentiefe heraus, nichts mehr schauend, nichts als die blendende Blitztiefe des Nichts, nimmt es alle Augen in sich auf, die Augen der Liebenden, die Augen der Erwachenden, die Augen der Sterbenden, brechend in Liebe, brechend im Tode, das Auge des Menschen, brechend, weil es in die Zeitlosigkeit schaut.
Flucht, oh Flucht! Gestaltwerdung des Tages und Gestaltenruhe der Nacht, beides hingewendet zum ruhenden Geschehen der Zeitlosigkeit! Mählich verkrusteten die Kandelaberkerzen, um die mit bös-monotonem, ungestalthartem Summen pausenlos die Mücken schwärmten, pausenlos rieselte das Wasser des Wandbrunnens, und das Rieseln war wie ein Teil seines unsäglich zeitlosen, unbewegten, ozeanischen Dahinflutens; es spielten unbewegt die Amoretten in dem Wandfries, erstarrt zu einer Überfriedlichkeit, zu einer Überruhe, die kaum mehr Gestalt war, vielmehr teilhatte an der weiträumig-weiträumig starrbrausenden, jenseitigen Nachtstille, an ihrer äonenhaften Unabänderlichkeit, die - schattengebärend und schattendurchtränkt - als atemumwandete Höhle der Traumgezeiten ringsum sich aufbaute, gestaltloses Schweigen, überschwebt von der Lautlosigkeit der Donnervögel unter den unbewölkten Sternen. Denn was immer in der Nacht ruht, den Frieden trinkend, einander trinkend, von Schatten durchpulst, einander verschattend, Seele an Seele gepreßt, Gatte und Gattin vereint, das Mädchen in den Armen des Jünglings geborgen, der Knabe im Arme des Liebhabers, was immer in der Nacht sich begibt, ist teilhabend-dunkler Widerschein ihrer noch größeren Dunkelheit, ist Abbild ihrer dunkelzuckenden Blitze, ist Sturz in den Gewitterabgrund, aufgerissen die Decke des Traumes, und wenn wir auch nach der Mutter schreien, auf daß sie uns vor dem Nachtgewitter beschütze, sie ist so weit und so erinnerungsverloren, daß nur mehr hie und da ein Schauer der Kindheit zu uns geweht wird, kein Trost und kein Schutz mehr, höchstens der vertrautfremde Hauch längstentschwundener Heimat, der Ruhehauch, der dem Gewitter vorangeht: ja, so war es, und mochte die Nachtbrise noch so lau und so milde, mochte sie noch so kühl durch das Fenster hereinstreichen, mochte sie auch alles Irdische in ihren Gezeiten umfassen, Olivenhain und Weizenmahd und Weinberg und Fischerstrand umhauchend wie ein einigend einziger, wogender Nachtatem der Länder und Meere, ihre Ernten in sanfter Windhand tragend und vermengend, und mochte die sanftwehende Hand noch so linde herabsinken, hinstreichend über die Straßen und Plätze, die Gesichter kühlend, den Qualm zerteilend, die Brunst beschwichtigend, ja mag dieser wehende Atem, von dem die Gestalt der Nacht bis zu ihrer äußersten Oberfläche erfüllt wird, sogar noch über sie hinausgewachsen sein, verwandelt zu dem bebenden Höhlengebirge, das unerfaßlich, kaum noch ein Außen, zutiefst im eigensten Innern ruht, im Herzen und tiefer als das Herz, in der Seele und tiefer als die Seele, in unserem tiefsten Ich, das selber zur Nacht geworden ist, mochte dies alles auch sein und werden, es nützte nichts; es nützte nichts, es war zu spät an der Zeit, es nützte nichts mehr; unheilschwanger bleibt der Schlaf der Herden, unbeschwichtigt bleibt das irdische Toben, unverlöschbar das Feuer, ausgeliefert bleibt die Liebe dem schmetternden Blitze des Nichts, und über der Höhle der Nacht steht zeitlos das Gewitter.
Flucht, oh, Flucht! die Mutter bleibt unerrufbar. Wir sind verwaist am Herdenursprung, kein Name ist uns im Traume' erruf bar, keiner hat Geltung in der Dunkelheit des vollkommenen Zusammenschlusses -, und du, mein kleiner Nachtgefährte, der du dich mir wie ein Führer zugesellt hast, sollst du mir da wirklich noch erruf bar werden? bist du von deinem, bist du von meinem Schicksal zu mir gesandt worden, daß ich zu dir spreche? fühlst auch du dich von der Zeitlosigkeit bedroht? ist sie auch unter deiner Nacht verborgen - und kamst du deshalb zu mir? oh, lehne dich an mich, mein kleiner Zwillingsbruder, oh, lehne dich an mich; ich wende meine Augen von der Bedrohung ab und wende sie zu dir hin, hoffend, ein letztes Mal noch hoffend, aus der Verlassenheit heimkehren zu können, mit dir heimzukehren in das dunkle Gewölbe, das in mir errichtet ist wie eine Heimstatt, die ich nicht mehr kenne, oh, kehre ein mit mir in diese Vertrautheit, die als Fremdestes wiedervertraut in meinen Adern schlägt, und an der ich dich teilhaben lassen möchte: vielleicht wird mir dann auch das Fremdeste, vielleicht werde auch ich mir dann nicht mehr fremd sein; oh, schmieg dich an mich, mein kleiner Zwillingsbruder, schmieg dich an mich, und wenn du die verlorene Kindheit, wenn du die verlorene Mutter betrauerst, du sollst sie bei mir wiederfinden, da ich dich in meinen Arm und in meinen Schutz nehme. Noch einmal laß uns verharren in der schwebenden Höhle der Nacht, nur noch ein einziges Mal, und laß uns gemeinsam der Nacht und ihrem Traumschweben lauschen, dem Trotzdem ihres Zwischenreiches und ihrer süßen Wirklichkeit -, noch weißt du es nicht, mein kleiner Bruder, denn du bist jung, aus welch tiefstem Innern unseres Selbst die Nachthoffnung emporsteigt, so allumfassend und so allumseelt in ihrer Unabänderlichkeit, so sehr zärtlich leises Sehnsuchtsversprechen in ihrer Bedrängnis, daß wir sehr lange Zeit brauchen, ehe wir sie hören, sie und ihre Bangigkeit, die wie ein Echogebirge um uns errichtet ist, Echowand um Echowand, wie eine unbekannte Landschaft und trotzdem wie ein Rufen unseres eigenen Herzens, ja, trotzdem und trotzdem, so befehlshaberisch, als wollte nochmals aller Nachglanz einer längstgelebten Vergangenheit neu aufglänzen, trotzdem so zuversichtlich, als sei alle Verheißung des Endgültigen darin beschlossen -oh, kleiner Bruder, ich habe es erlebt, weil ich ein alter Mann geworden bin, älter als meine Jahre, weil ich jede Brüchigkeit und jede Verweslichkeit in mir spürte, ich habe es erlebt, weil es mit mir zu Ende geht; ach, erst im Verlangen nach dem Tode verlangen wir nach dem Leben, und in mir ist die unterhöhlende, die gefügelockernde Arbeit jedweder Todesgier, pausenlos, soweit ich zurückdenken kann, unaufhörlich pochend; so habe ich sie stets gespürt, Lebensbangigkeit und Todesbangigkeit zugleich, in all den vielen Nächten, an deren Schwelle ich gestanden habe, an den Ufern der Nächte und Aber-Nächte, die an mir vorbeigerauscht sind, im Rauschen anschwellend das Wissen um sie, das Wissen um die Trennung, das Wissen um den Abschied, der mit der Dämmerung anhebt, und es war Sterben, das an mir vorbeifloß, mich mit steigender Flut berührte, benetzte, umfing, von außen kommend und doch aus mir geboren, mein Sterben: erst der Sterbende erkennt die Gemeinschaft, erkennt die Liebe, erkennt das Zwischenreich, erst in der Dämmerung und im Abschied erkennen wir den Schlaf, dessen dunkelste Gemeinschaft ohne Unzucht ist, erkennen wir, daß unserem Auf bruch niemals mehr eine Rückkehr folgen darf, erkennen wir den Keim der Unzucht, der in der Rückkehr und nur in der Rückkehr eingebettet liegt; ach, mein kleiner Naehtgefährte, auch du wirst dies einstmals erkennen, auch du wirst einst an der Uferschwelle sitzen, am Ufer deines Zwischenreiches, am Ufer des Abschiedes und der Dämmerung, und auch dein Schiff wird zur Flucht gerüstet sein, zu jener stolzen Flucht, welche Erwachen heißt und von der es keine Rückkehr gibt. Traum, oh, Traum! Solange wir dichten, brechen wir nicht auf, solange wir ausharren im Zwischenreich unseres Nachttages, schenken wir einander alle Traumeshoffnung, alle Sehnsuchtsgemeinschaft, alle Hoffnung der Liebe, und darum, mein kleiner Bruder, um dieser Hoffnung, um dieser Sehnsucht willen^ geh nicht mehr fort von mir; ich will deinen Namen nicht wissen, den schattenwerfenden, ich will dich nicht rufen, weder zum Aufbruch noch zur Rückkehr, doch unerrufbar und ungerufen bleibe bei mir, damit die Liebe bleibe in der Verheißung ihrer Endgültigkeit, bleibe bei mir in der Dämmerung, bleibe bei mir am Ufer des Flusses, den wir schauen wollen, ohne uns ihm anzuvertrauen, fern seinem Quell, ferne seiner Mündung, gefeit vor dem urdunklen Zusammenschluß des Anfanges und gefeit vor der letzten, vor der schattenlosen Lichtvereinzelung Apollos, oh, bleibe bei mir, schützend und beschützt, wie ich für immerdar bei dir bleiben will, noch einmal die Liebe: hörst du mich? hörst du mein Bitten? vermag mein Bitten noch dich zu hören, sich selber erhörend, schicksalsentronnen, leidensentlöst ?
Unbewegt lag die Nacht, gestaltenstarr in all ihrer nahen und all ihrer weiten Sichtbarkeit, eingeschlossen im Raume hier, eingeschlossen in immer weiteren Räumen, hinausgebreitet aus der Unmittelbarkeit des Handgreiflichen zu immer weiteren Unmittelbarkeiten, hin über die Berge und Meere, ausgebreitet in stetem Dahinfluten bis zu den nimmererreichbaren Traumgewölben, aber dieses Fluten, aus dem Herzen entspringend, an den Gewölbegrenzen verbrandend und wieder heimflutend ins Herz, nahm Sehnsuchtswelle um Sehnsuchtswelle in sich auf, zerlöste selbst die Sehnsucht nach der Sehnsucht, brachte die dämmerungsschwingende mütterliche Sternwiege ihres Ur-beginns zum Stillstand, und umzuckt von den dunklen Blitzen des Unten, von den hellen des Oben, geschieden in Licht und Finsternis, in Schwärze und Grellheit, zweifarbig die Wolke, zwiefach der Ursprung, gewitterschwül, lautlos, raumlos, zeitlos, - oh, aufgebrochene Höhle des Innen und Außen, oh, groß hinziehende Erde! -, so klaffte die Nacht auf, zerbarst der Schlaf des Seins; stumm hinweggespült waren Dämmerung und Dichtung, hinweggespült ihr Reich, zerbrochen die Echowände des Traumes, und verhöhnt von den stummen Stimmen der Erinnerung, schuldbeladen und hoffnungsgebrochen, flutenüberströmt, flutenentführt, versank des Lebens übergroßes Aufgebot zum schieren Nichts. Es war zu spät geworden, es gab nur noch Flucht, das Schiff kg bereit, der Anker wurde hochgezogen; es war zu spät.
Noch wartete er, wartete, daß die Nacht sich nochmals melde, daß sie ihm Endgültiges und Tröstliches zuraune, daß sie mit ihrem Rieseln nochmals seine Sehnsucht wachriefe. Kaum war es noch Hoffnung zu nennen, eher Hoffnung auf die Hoffnung, kaum noch Flucht vor der Zeitlosigkeit, eher Flucht vor der Flucht. Es gab keine Zeit, keine Sehnsucht, keine Hoffnung mehr, weder für das Leben noch für das Sterben; es gab keine Nacht mehr. Es gab kaum ein Warten mehr, höchstens noch Ungeduld, welche Ungeduld erwartete. Er hielt die Hände verschränkt, und der Daumen der Linken rührte an den Stein des Ringes. So saß er, spürte an seinem Knie die Wärme der bis zur Anlehnungsnähe herangerückten, dennoch nicht angelehnten Knabenschulter, und es verlangte ihn sehr, die verschränkten Finger aus ihrer zunehmenden Verkrampfung zu lösen, um unbemerkt-sachte über die nachtdunklen wirren, kindlichen Haare, auf die er hinabschaute, zu streichen, um das nächtlich Sprießende, nächtlich Menschliche des nachtweichen knisternden Flors durch die Finger gleiten zu lassen, nachtsehnsüchtig nach Sehnsucht; indes, er tat keine Bewegung, und schließlich, obwohl es ihm schwerfiel, die Starrheit des Wartens zu unterbrechen, sagte er: «Es ist zu spät.» Der Knabe hob langsam das Gesicht zu ihm empor, so verständnisvoll und fragend, als wäre ihm etwas vorgelesen worden, dessen Fortsetzung nun folgen müßte, und dieser Frage gehorchend, sein eigenes Gesicht dem des Knaben sanft zugenähert, wiederholte er sehr leise: «Es ist zu spät.» War es noch Warten? War er enttäuscht, weil die Nacht sich nicht mehr regte, weil der Knabe sich nicht regte und nur der Knabenblick, grau, kindlich, unverwandt, selber fragend, auf ihn geheftet blieb? die Ungeduld, deren Kommen er herbeigewünscht hatte, stellte sich plötzlich ein: «Ja, es ist spät... geh zum Fest.» Jählings fühlte er sich übermäßig alt; das unmittelbar Irdische meldete sich mit dem Bedürfnis nach Schlaf und Eindämmern, mit der Sehnsucht ins Bewußtlose versinken zu dürfen und das Nie-mehr zu vergessen, es meldete sich mit einer Schwäche im Unterkiefer und dazu noch mit einem so argen Hustenreiz, daß der Wunsch, unbeobachtet allein zu bleiben, übermächtig wurde: «Geh ... geh zum Feste», brachte er noch heiser hervor, während seine flach aufwärts gerichtete Hand, allerdings bloß in Andeutung und über einen wachsenden Abstand hin, den zögernd zurückweichenden Knaben nun mit kurzen Rucken zur Türe hinschob. «Geh ... geh», rasselte es nochmals in ihm mit bereits versagendem Atem, und als er dann tatsächlich allein war, da war es als führe ein schwarzer Blitz in seine Brust, es brach der Husten aus ihr hervor, nachtblutgemischt, gestaltlos, zerschüttelt und zerstarrt, aufklaffend und berstend, bewußtseinsberaubend, ein würgender Krampf am Rande des Abgrundes, und daß es ihn diesmal nicht hineingestürzt hatte, daß es noch einmal vorbeigegangen war, daß er nochmals das Rieseln des Brunnens und das Knistern der Kerzen vernehmen konnte, das erschien ihm nachher wie ein Wunder. Er hatte sich, mühselig genug, von dem Lehnsessel zum Bett hinübergeschleppt, hatte sich hineinfallen lassen und war regungslos liegen geblieben.
Die Hände wiederum verschränkt spürte er wieder den Stein des Ringes, spürte die geflügelte Geniengestalt, die in den Karneol der Gemme eingraviert war, und er wartete, lauschend ob es sich zum Tod, ob es sich zum Leben wenden werde. Aber langsam wurde es besser - langsam zwar und sehr mühselig und sehr bedrängt - es wurde wieder zu Atem, zu Ruhen, zu Schweigen.