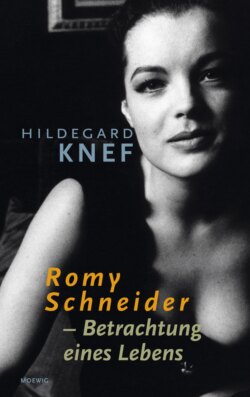Читать книгу Romy Schneider - Hildegard Knef - Страница 3
Curt Riess –
Letztes Gespräch mit Romy
ОглавлениеDer Anruf kam spät in der Nacht vom 9. zum 10. Mai. Ich vermute, daß es nach Mitternacht war. Jedenfalls hatte ich mich schon zu Bett gelegt.
»Hallo …, hier ist Romy, Curt!«
Sie klang wie von weit her, und sie klang irgendwie unsicher, gespannt, nervös. Ich, der so oft mit ihr gesprochen hatte, konnte die Stimme nicht sofort erkennen.
»Romy, du rufst aus Paris an?«
»Nein. Ich bin in Zürich. Können wir uns morgen nachmittag mal sehen? In der bewußten Angelegenheit …«
»Sicher. Du bist in deiner Wohnung?« Romy Schneider hatte, was nur wenige wußten, im Zürcher Vorort Höngg, in der Segantinistraße, seit vielen Jahren eine kleine Wohnung.
»Nein, wir sind im ›Baur au Lac‹ …«
Die bewußte Angelegenheit: Es handelte sich um Briefe und Aufzeichnungen, die mir Harry Meyen, ihr erster Mann und ein sehr alter Freund von mir, kurz vor seinem Tod übersandt hatte, um, wie er sich ausdrückte, damit anzufangen, ›was ich wollte‹.
Ich wußte eigentlich nicht, was ich damit anfangen sollte, schon gar nicht, nachdem Harry sich bald darauf das Leben genommen hatte. Vor kurzem war mir in den Sinn gekommen, daß diese Sachen vielleicht Romy interessieren würden, und ich hatte ihr deshalb geschrieben. Es war ausgemacht, daß ich in den nächsten Tagen, Mitte oder Ende Mai, während einer geplanten Reise nach Paris, ihr die Papiere übergeben würde. Nun war sie überraschenderweise nach Zürich gekommen. Ich fragte sie, warum. »Ich will mich mit unserem Freund Dr. Kaestlin unterhalten, das heißt, ich muß …« Auch Kaestlin gehörte zu meinen ältesten Freunden und war seit vielen Jahren der Schweizer Anwalt Romys. Sie mochte ihn sehr gern, und er mochte sie sehr gern und hatte oft genug rührend für sie gesorgt.
Mehr wurde während dieses nächtlichen Anrufs nicht gesagt.
Ich hatte Romy seit langem nicht mehr gesehen, nicht mehr seit letztem Sommer, als sie in Berlin filmte. Und auch da nur kurz. Aber wir kannten uns lange. Und wir waren gute Freunde, so weit das bei Romy möglich war, denn sie war sehr temperamentvoll, oft unberechenbar, eben noch freundschaftlich und nett, dann wieder betont grob und abweisend. Nun, diese Erfahrung hatten viele mit ihr gemacht.
Zum ersten Mal sah ich sie, als sie noch ein Kind war, so neun oder zehn Jahre alt, jedenfalls vor Beginn ihrer sensationellen Filmkarriere. Es war im Haus Mariengrund, dem Besitz ihrer Mutter, unweit von Berchtesgaden. Das nächstemal sah ich sie in Berlin im Restaurant des Hotels am Steinplatz mit ihrer Mutter Magda Schneider, die erzählte, ihre Tochter mache mit ihr zusammen einen Film. Sie mochte fünfzehn sein, sah aber viel jünger aus. Als ich später die Hatheyer vom Theater abholte, sagte ich ihr: »Ich habe heute abend ein Kind gesehen, das Weltkarriere machen wird.« Ich hatte diese wirkliche prophetischen Worte längst vergessen, aber die Hatheyer erinnerte mich nach Romys Tod daran.
Einige Zeit später sah ich Romy wieder, wiederum in Mariengrund, da hatte sie schon den ersten Sissi-Film oder vielleicht auch den zweiten hinter sich. Und ich war gekommen, um sie zu interviewen. Jawohl, das war das erste und übrigens einzige Interview, das ich mit ihr hatte. Ich schrieb an einer Serie für die Zeitschrift stern, ›Das gab’s nur einmal‹, eine Geschichte des deutschen Films, in der sie, wie ich fand, schon jetzt vorkommen müßte.
Später traf ich sie und ihre Mutter in New York, wo die beiden haltmachten, bevor sie nach Hollywood fuhren. In Rom rein zufällig auf der Via Veneto. In Wien, wo sie unter Preminger filmte, in Straßburg, wo sie im Rahmen einer Tournee in einem Tschechow-Stück auftrat – sie hatte damals um meinen Besuch gebeten, denn sie wollte wissen, was ich von ihr auf der Bühne hielt; Gustaf Gründgens hatte ihr durch meine Vermittlung angeboten, bei ihm am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg aufzutreten, und sie war nicht sicher, ob sie es schaffen würde. Ich war übrigens sicher. Auch ihre ›Kollegin‹ Heidemarie Hatheyer, die damals nach Straßburg gekommen war und sich sehr beeindruckt zeigte, was Romy freute.
Dann traf ich sie auf einem gemieteten Besitz, unweit von St. Tropez, nach der Heirat mit Harry Meyen, wo ich mehrere Tage bei ihnen verbrachte – damals war sie schon hochschwanger. In Berlin, wo sie sich mit Harry niedergelassen hatte, hatte ich sie mehrere Male gesehen, in Hamburg, wohin die beiden dann zogen, und schließlich in Paris, wo sie ja mit gelegentlichen Unterbrechungen den Rest ihres Lebens verbrachte.
Wie gesagt, ich hatte sie eine Weile nicht gesehen, und ich war ein bißchen erschrocken, als ich sie nun wiedersah. Sie hatte sich verändert, war ganz anders geworden … Sie war gar nicht mehr heiter, was sie so oft gewesen war, oder beherrscht, was sie früher fast immer war. Sie wirkte hypernervös, fahrig, hektisch, sie setzte sich hin, um sogleich wieder aufzustehen, sie machte ein paar Schritte, um sich wieder hinzusetzen, um wieder aufzustehen, um irgendein Möbelstück zurechtzurücken. Sie wirkte ratlos, fast verstört.
Und ihr Gesicht … Dieses wunderschöne Gesicht, das für mich immer Jugend und Lebensfreude ausgestrahlt hatte … Es war ein verstörtes Gesicht, und es war irgendwie auch ein zerstörtes Gesicht.
Natürlich dachte ich, ihre Verstörtheit rühre immer noch von dem furchtbaren Verlust ihres kleinen Sohnes David her, der vor etwas mehr als einem Jahr von ihr gegangen war. Freilich, in der Zwischenzeit hatte ich sie ja gesehen, vor allem in Berlin, und da war sie sehr, sehr traurig, aber doch eher gefaßt gewesen. Jedenfalls schien es mir so.
Ich sagte; »Das ist nun auch schon ein Jahr her« und hätte mir fast die Zunge abgebissen daß ich es gesagt hatte. Aber sie ging auf meine Worte gar nicht ein. Sie wischte sie weg, als hätte ich sie nicht gesagt, und sie sagte ohne Übergang, ohne eigentlichen Grund:
»Ich habe kein Geld mehr! Und ich habe Schulden!«
Nun, ganz unvorbereitet trafen mich diese Worte nicht. Vor etwa zehn Monaten, so Ende August 1981, hatte ich ihre Mutter mit ein paar gemeinsamen Bekannten unweit von Salzburg und Berchtesgaden getroffen, und Magda hatte mir damals erzählt, vor kurzem habe sie ihre Tochter Romy gefragt, warum sie, anstatt sich nach dem Tod ihres Sohnes zurückzuziehen, in ein Sanatorium vielleicht, fast sofort einen Film in Berlin drehen wolle. Und Romy habe ihr geantwortet – ich zitiere aus dem Gedächtnis: »Ich muß arbeiten, ich habe kein Geld mehr!«
Ich meinte damals, das könne nicht stimmen, sie habe doch in den letzten Jahren so viel verdient, etwa zwanzig Millionen französische Francs, vielleicht auch mehr, also immerhin gut zehn Millionen D-Mark. Magda sagte, sie könne das natürlich nicht genau kontrollieren, begann aber, auf die ›Männer‹ zu schimpfen, die Romy ›ausgenommen‹ hätten, und meinte, ihr eben geschiedener Mann, Daniel Biasini, habe, da er Generalvollmacht von Romy erhalten hatte, ihre sämtlichen Konten abgeräumt.
Was wiederum ich nicht glaubte, denn Romy hatte ihrem Schweizer Anwalt versichert, als sie Daniel heiratete, sie werde alte Fehler nicht wieder machen und ihm keine Vollmachten über ihre Konten erteilen, er müsse von dem leben, was sie ihm zahle – er war angeblich auch ihr Sekretär. Vorher, so hatte uns noch Harry Meyen erzählt, sei er Kellner gewesen.
Auch jetzt, bei dieser Unterhaltung in Zürich, glaubte ich nicht so recht an die Pleite. Romy neigte oft zu Übertreibungen. Vielleicht hatte sie nicht so viel Geld, wie sie meinte, daß sie hätte haben müssen. Vielleicht hatte sie mehr ausgegeben, als sie hätte ausgeben sollen. Vielleicht hatte Biasini, Kellner hin, Sekretär her, auch etwas mehr Geld gekostet, als er hätte kosten dürfen. Und ihr augenblicklicher Freund, Laurent Petin? Aber zwanzig Millionen Francs gibt man doch nicht in wenigen Jahren aus.
Genau das sagte ich ihr.
Sie lächelte schwach.
»Genau das ist doch mein Schicksal! Zuerst hatte mir Herr Blatzheim mein Geld weggenommen!«
Das war eine Anspielung darauf, daß der zweite Mann ihrer Mutter, ihr Stiefvater, den sie früher Daddy nannte, ihre Gagen kassiert und in seine geschäftlichen Unternehmungen gesteckt hatte. Und sie hatte wohl nie auch nur annähernd das zurückbekommen, was sie hätte zurückbekommen müssen, wenn sie überhaupt etwas zurückbekommen hatte.
Auch ihr erster Mann, eben Harry Meyen, hatte sie anderthalb Millionen D-Mark gekostet, die sie ihm bei der Scheidung überließ. Das hatten wir alle damals Harry übelgenommen, der behauptete, das Geld stehe ihm zu, denn er sei schließlich jahrelang ihr Manager gewesen. Unwahrscheinlich, denn er sprach, obwohl er mit ihr in Paris lebte, keine zehn Worte Französisch und auch kein Englisch, und ein Manager war er schon gar nicht.
Richtig war freilich, daß er, um mit ihr in Paris zu leben, seine eigene Karriere, die an Deutschland und vor allem in Berlin gebunden war, aufgegeben hatte und, wie sich später herausstellte – aber das war sicher nicht Romys Schuld –, die Fäden von einst nicht mehr aufnehmen konnte. Und dann den Drogen und dem Alkohol verfiel. Aber das ist eine andere Geschichte.
Immerhin scheint Romy ihm diese finanzielle ›Transaktion‹ nicht übelgenommen zu haben. Als er sich in Hamburg das Leben genommen hatte, flog sie hin, um am Begräbnis teilzunehmen. Teilzunehmen? Sie sorgte dafür, daß keiner seiner Freunde, die ihm alle die letzte Ehre hatten erweisen wollen, vom Tag oder der Stunde des Begräbnisses erfuhren, so daß sie als einzig Leidtragende erschien.
Das verstand damals keiner von uns. Mir sagte sie später, sie habe sich nicht zur Schau stellen wollen, deshalb habe sie die Reporter und die Pressefotografen gefürchtet. Sie war am Morgen in Hamburg angekommen, hatte Harry begraben, war am Nachmittag oder Abend wieder abgeflogen – niemand hatte sie zu Gesicht bekommen.
Sie war immer allergisch gegen Pressefotografen gewesen. Ihre Angst vor ihnen in Hamburg war verständlich, aber hätten die Freunde Harrys nicht ein Recht gehabt, ihm die letzte Ehre zu erweisen?
Wie dem auch sei: Das Geld, das sie ihm überlassen hatte, kam nach seinem Tod zurück. Was uns alle zutiefst erstaunte, die wir gedacht hatten, er habe zumindest den größten Teil verbraucht oder durch falsche Anlagen verloren! Nichts dergleichen, er hatte sogar mehr hinterlassen, als Romy ihm gegeben hatte, und das sollte nun laut Testament der gemeinsame Sohn David erben und sie bis zu dessen Volljährigkeit verwalten.
Was Romy nach Harry an Männern verbrauchte – das Wort ist mit Absicht gewählt –, war so erfreulich nicht. Man sollte über Tote nichts Negatives sagen. Es liegte kein Grund vor, über Romy Schlechtes zu sagen, denn sie war nicht nur ein genialisch begabter Mensch, eine gottbegnadete Schauspielerin, sie war auch ein anständiger Kerl. Doch darf oder muß gesagt werden, daß sie sich jetzt zu Freunden, oder wie man das nannte, zu Begleitern immer nur sehr gutaussehende Burschen suchte, die sehr viel jünger waren als sie selbst. Und manchmal waren sie auch Beleuchter oder Bühnenarbeiter aus dem Atelier – das dauerte dann wohl nur ein paar Stunden.
Warum wohl? Vielleicht, weil sie Angst davor hatte, alt zu werden, was ja zumindest vorläufig noch nicht der Fall war. Oder auch Angst davor, allein zu sein. Nun, wir werden es nie erfahren.
Aber sicher ist, daß alle diese jungen Burschen, und nicht nur ihr zweiter Mann oder vielleicht auch ihr letzter Freund, sie Geld kosteten, sehr viel Geld, vielleicht mit Ausnahme von Alain Delon, mit dem sie vor ihrer ersten Ehe eine Zeitlang gelebt hatte und der ihr später immer ein guter Freund blieb. Übrigens war er älter als sie, wenn auch nur um weniges. Das gleiche gilt für ihren Partner in vielen Filmen, den Schauspieler Michel Piccoli.
Wie dem auch sei: Alle Männer, mit denen sie später zusammenlebte, nahmen sie aus. Ihr ständiges Schicksal, das ja schon im Elternhaus begonnen hatte.
Wir alle hatten noch vor kurzem gehört, daß ihr hübscher Freund Laurent Petin, der übrigens mit nach Zürich gekommen war, nicht zur Kategorie derer gehörte, die von ihr gelebt hatten. Stimmte das? Sicher hatte er keinen Beruf, der viel einbrachte. Aber er sei, so hörte man, aus mehr als wohlhabendem Hause und also durchaus in der Lage, sich selbst zu ernähren, wenn auch in Grenzen.
Später, nach Romys Tod, erfuhr man, daß Petin keineswegs wohlhabend sei. Hat auch er von ihr gelebt?
Es gab wohl noch einen Grund dafür, daß sie sich mit Partnern umgab, die keinen Beruf hatten, sondern allenfalls nur einen nicht sehr aufreibenden Job, wie ihr zweiter Mann, den eines Sekretärs. Nach der Scheidung von Harry sagte sie mir einmal – und sicher nicht nur mir: »Ich will, daß der Mann, den ich liebe, nur für mich da ist. Harry war ja nicht nur für mich da. Er hatte ja schließlich seinen Beruf. Er wollte wieder spielen und inszenieren. Auch von Paris aus liebäugelte er immer wieder mit Berlin …«
Nur für sie da sein … Warum? Das Leben, voller Triumphe für sie, hatte ihr wohl eines versagt, was sie notwendiger brauchte als alle Erfolge: das Wissen darum, daß man für den anderen notwendig ist, dass man gebraucht wird, daß ein anderer, der andere, nicht leben kann, ohne daß man da ist. Das hätte ihr die Sicherheit gegeben, die sie niemals besaß.
Diesen Mangel an Sicherheit hatte sie schon als Kind zu spüren bekommen, als der Vater die Mutter und seine zwei Kinder im Stich ließ, der gutaussehende, mittelmäßige Schauspieler Wolf Albach-Retty, der es in der schwersten Zeit nach dem Krieg der Mutter überließ, durch ständiges Tingeln und unaufhörliches Theaterspielen und Filmen die Kinder durchzubringen. Gewiß, es klappte, aber es war nie sicher, ob es klappen würde. Man mag einwenden, daß es den meisten Familien in Deutschland und Österreich damals so ging. Die Kinder bekamen das wohl oft nicht ganz mit. Romy spürte diese Unsicherheit. Sie hat später oft darüber gesprochen.
Sicherheit schien einzukehren, als die Mutter wieder heiratete, und zwar einen Mann, dem es anscheinend sehr gut ging und der riesige Geschäfte zu tätigen schien. Später, vor allem nach dem Tod dieses Mannes, dieses Herrn Blatzheim, stellte sich dann heraus, daß die Geschäfte vielleicht groß, aber auch verlustreich gewesen waren, was Romy indirekt betraf, oder eigentlich sogar direkt, denn, wie gesagt, bekam sie, als sie noch minderjährig war, ihre Gagen nicht ausbezahlt, sie verschwanden in den Geschäften ihres Stiefvaters. Aber nicht einmal, als sie nach einem Zerwürfnis mit diesem ›Vater‹, noch immer minderjährig, das Haus der Mutter verließ, bekam sie die verdienten Filmgagen in die Hand, sondern von des Stiefvaters Gnaden nur 3000 D-Mark pro Monat. Gewiß, keine läppische Summe, aber eine, die es ihr nicht erlaubte, so zu leben wie die anderen Filmleute, obwohl sie schon prominenter war als die meisten. Jedenfalls war es nicht genug, um ihr das Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.
Und dann kam der junge, schöne Alain Delon, ihre erste große Liebe, und wohl auch ihre einzige. Und der verließ sie ziemlich plötzlich. Jedenfalls war er aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen und verreist, als sie aus Amerika zurückkehrte.
Romy schien meine Anwesenheit vorübergehend vergessen zu haben. Sie wiederholte immer wieder, daß sie kein Geld mehr besitze, und sagte schließlich: »Ich habe dieses Leben satt!« Was ich für einen Temperamentsausbruch hielt und durchaus nicht ernst nahm. Ich hätte es ernst nehmen sollen, wie ich heute weiß, wie ich gut zwei Wochen später begriff. Aber was hätte das schon geändert?
Und dann war da noch etwas. Sie trank. Auch das war mir zuerst nicht weiter aufgefallen. Als sie aber die Flasche Rotwein, die auf dem Tischchen stand, ausgetrunken hatte und der Kellner mit einer neuen erschien, wurde ich stutzig. Früher hatte sie nie getrunken oder jedenfalls so wenig, daß es gar nicht aufgefallen war. Jetzt mußte es einem auffallen.
Ich wußte auch, daß sie Pillen nahm. Das hatte mir ein gemeinsamer Pariser Bekannter erzählt, und ich wußte, wer weiß das nicht, daß Pillen und Alkohol nicht zusammenpassen. Sie mußte in meinem Gesicht gelesen haben, denn sie sagte:
»Ja, die Ärzte haben es mir verboten! Seit der Operation! Ich dürfte eigentlich nicht trinken. Ich tue es sonst auch nicht, aber heute bin ich eben sehr mit den Nerven herunter!«
Natürlich, die Operation! Die war kurz nach dem Tode ihres Sohnes erfolgt. Eine Niere war ihr herausgenommen worden. Sie hätte seitdem nicht trinken dürfen. Man braucht kein Arzt zu sein, um das zu wissen. Und auch ständiger Pillenmißbrauch konnte nicht gut sein für eine Frau , die nur noch eine Niere besaß. Mochte sein, daß die Ärzte ihr Pillen verordnet hatten, damals, in den Tagen nach der Operation, um die Schmerzen zu lindern. Aber sicher nicht Pillen auf Monate hinaus oder sogar über mehr als ein Jahr.
Zum ersten Mal kam mir die Idee, daß Romy eine Art von Selbstzerstörung betrieb, und zwar sicher nicht eine unterbewußte Selbstzerstörung, daß sie bewußt lebensgefährlich lebte und daß ihr das letztlich gleichgültig war.
Ich verdrängte diese Gedanken, die mir – nach ihrem Tod – wiederkommen sollten.
Ich kam auf ihre finanzielle Misere zu sprechen.
»Es ist ja bekannt, was du für einen Film bekommst. Mit ein, zwei Filmen ist das doch vorbei, und du bist wieder eine reiche Frau!« »Irrtum!« Sie trank wieder. »Ich habe Schulden.«
»Du hast Schulden?« Das glaubte ich nun wirklich nicht.
»Ich habe ziemlich hohe Schulden. Deswegen bin ich ja auch nach Zürich gekommen, um mich mit meinem alten Freund zu besprechen. Aber ich zweifle, daß etwas zu machen sein wird.«
Davon hatte ich nie gehört, und ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wo, wann und wie Romy Schulden gemacht haben sollte.
Ich fragte sie danach.
»Die Steuer … Sie sind hinter mir her, weil ich zu wenig Steuern bezahlt habe …«
»Seit wann? Warum? Um wieviel handelt es sich eigentlich?«
»Um sehr viel … Ich glaube, um mehr als eine Million, oder vielleicht sind es zwei. Du weißt ja, von diesen Dingen verstehe ich nicht das geringste …«
Und die jungen Männer, mit denen sie sich umgeben hatte, verstanden eben auch nichts davon und kümmerten sich darum gar nicht.
»Aber du hast doch sicher einen Steuerberater?«
»Ich habe sogar zwei, und angeblich die besten von Paris. Aber die tun überhaupt nichts.«
Das alles klang reichlich unwahrscheinlich – und stimmte doch. Später, nach ihrem Tod, erfuhr ich, wie das alles zusammenhing. Romy hatte seit Jahren so gut wie keine Steuern bezahlt. Warum? Früher, während ihrer ersten Ehe und nach ihr, war sie Deutsche gewesen, mit Wohnsitz in der Schweiz, formalem Wohnsitz, gewiß. Und die Schweizer Steuern waren relativ erträglich gewesen, jedenfalls wesentlich geringer als die doch sehr erheblichen – nach ihren Steueranwälten halsabschneiderischen – französischen Steuern. Die hatte sie einfach ignoriert. Und nun sollte sie nicht nur diese Steuern nachzahlen, sondern, gewissermaßen zur Strafe, sehr viel mehr, wie ich erfuhr, das Doppelte, wenn nicht das Dreifache.
Und warum sich ihre Steueranwälte nicht gekümmert hatten? Sie hatten sich gekümmert, aber sie hatte ihre Ratschläge oder Anordnungen nicht ernst genommen. Und vor allem hatte sie die Anwälte auch nicht bezahlt. Und sie erklärten eines Tages, sie würden keinen Finger mehr rühren, bevor ihre Rechnungen bezahlt seien.
So sagte Romy jedenfalls. Es mußte nicht unbedingt stimmen.
Und es gab auch andere Gründe dafür, daß Romy Schulden hatte: Vor allem war da ihr aufwendiger Lebensstil. Sie, die so lange kein Geld oder jedenfalls sehr wenig in der Hand gehabt hatte, wußte überhaupt nicht, wie man mit Geld umgeht. Sie kaufte wild drauflos, was ihr oder ihrem Freund gefiel. Einer ihrer Bekannten sagte, sie habe durchschnittlich drei oder vier Autos pro Jahr gekauft, teure Wagen, Mercedes, Cadillac, Porsche, deren sie und ihre Begleiter nach wenigen Monaten überdrüssig wurde. Sie habe die Wagen nicht eingetauscht, was jeder vernünftige Mensch getan hätte, sondern sie verschleudert, um wieder neue, teurere zu kaufen.
Sodann hatte sie, immer nach ihren Bekannten, ihren Freunden, den Tick, ständig neue Häuser oder Wohnungen zu beziehen, um sie aufs kostbarste einzurichten und sie bald danach zu verkaufen und wieder ein neues Haus oder eine neue Wohnung zu kaufen.
Kurz vor unserem letzten Gespräch hatte man in der Presse gelesen, sie habe ein altes Bauernhaus in einem Dorf unweit von Paris erworben. Das stimmte. Aber da sie damals schon kaum noch Geld hatte, war sie nicht in der Lage gewesen, den vollen Kaufpreis hinzulegen, sondern nur einen kleinen Teil. Das Haus war später wieder an die ursprünglichen Besitzer zurückgegangen.
Aber obwohl sie das Haus noch nicht besaß, hatte sie bereits mit einem kostspieligen Umbau begonnen, hatte einen Swimmingpool im Garten anlegen lassen, und das alles zu einer Zeit, in der sie kaum noch über Geldmittel verfügte oder immer nur über das, was gerade an neuen Gagen auf sie zukam.
Sagte sie deshalb jetzt wieder ganz ohne Übergang: »Gott sei Dank werde ich bald wieder filmen …?«
Aber dieses Gott sei Dank bedeutete wohl nicht, daß sie hoffte, damit ihre Schulden zu bezahlen. Das wäre denkbar gewesen, wenn sie lange keinen Film mehr gemacht hätte. Aber sie machte ja Filme fast am laufenden Band.
Etwas anderes wurde nur, indem sie die Worte sprach, klar. Ihre Bekannten, die nicht Bescheid über ihre finanzielle Misere wußten, hatten sich oft gewundert, warum sie nie Pause und einen Film nach dem anderen machte. Die Erklärung: Sie war eben nur beim Filmen glücklich. Weil sie dann vergessen konnte, wer sie war, wie es um sie bestellt war. Weil sie in eine Rolle schlüpfen konnte, und nur die Freuden oder auch die Sorgen der Frau, die sie gerade darstellte, erleben mußte und sich mit dem Bewußtsein trösten konnte, daß das ja keine echten Sorgen waren, die sie da empfand. Aber auf jeden Fall, weil sie die eigenen Sorgen vorübergehend verdrängen konnte und von ihnen nicht bedrückt wurde. Das Filmen war also eine Flucht vor sich selbst. Das war wohl letzten Endes die Erklärung dafür, daß sie einen Film nach dem anderen drehte.
Ich wies auf die Papiere hin, die ich mitgebracht hatte. Ich hatte ihr ja vor einigen Wochen telefonisch darüber Bescheid gegeben. Sie schüttelte den Kopf und trank ihr Glas aus, um sich sofort wieder ein neues einzuschenken.
»Nein, ich will das alles gar nicht sehen … Nimm es wieder mit. Mach damit, was du willst.« Und sie fügte hinzu: »Ich denke oft an Harry. Vielleicht hätte ich mit ihm nach Deutschland zurückgehen sollen … Nach Hamburg oder Berlin. Vielleicht wäre dann alles gut geworden … Ich weiß nicht … Aber ich will nicht darüber nachdenken. Ich möchte das alles vergessen …«
Und dann ging ich. Was war noch zu sagen?
Ich war tief erschüttert. Ich ging erst einmal in die Bar des ›Baur au Lac‹. Dann lief ich fast eine Stunde lang kreuz und quer durch Zürich. Den Rest des Tages konnte ich kaum einen vernünftigen Gedanken mehr fassen. Mir war klar, diese Frau, die ich als junges Mädchen so gut gekannt hatte, befand sich in großer Gefahr. Ich erinnere mich deutlich, daß ich mit einigen wenigen Freunden in den nächsten Stunden oder Tagen darüber sprach. Denen sagte ich sogar, wenn nicht etwas Unvorhergesehenes geschähe, würde Romy Selbstmord begehen. Doch ich war nur zu froh, mir das wieder ausreden zu lassen. Vielleicht bildete ich mir das alles nur ein. Aber war sie nicht dabei, sich selbst zu zerstören?
Vielleicht nicht einmal bewußt. Sicher plante sie keinen Selbstmord. Aber vielleicht beging sie Selbstmord auf Raten.
Natürlich dachte ich gar nicht daran, das zu veröffentlichen. Es hatte sich ja, bei Gott, nicht um ein Interview gehandelt. Und welchen Sinn hätte es gehabt, die Öffentlichkeit wissen zu lassen, wie verzweifelt mir Romys Zustand erschien? Das wäre sinnlos gewesen.
Aber als dann wenige Tage später die Kunde aus Paris kam, sie sei tot aufgefunden worden, glaubte zuerst alle Welt, sie habe sich umgebracht. Freilich, dafür gab es kein Indiz. Doch das Gerücht hielt sich standhaft, zumindest in Paris.
Eigentlich wollte ich zu ihrem Begräbnis fliegen, tat es aber dann doch nicht, weil ich mir vorstellte, es würden sich dort Tausende und Abertausende von Schaulustigen einfinden, und der Gedanke stieß mich ab.
Erst einige Tage nach dem Tod flog ich nach Paris und sprach mit einem ihrer bisherigen Berater. Der wies mich daraufhin, daß der Arzt Herzversagen festgestellt habe. Also ein natürlicher Tod? Eine Obduktion hatte jedenfalls nicht stattgefunden. Das hatte wohl Delon verhindert, der seine Beziehungen spielen ließ. Warum wohl? Mir gegenüber sagte er, eine Obduktion hätte gar keinen Sinn gehabt. Das mag stimmen, Romy hatte ja sicher nicht Selbstmord begangen, wie man sich im allgemeinen einen Selbstmord vorstellt. Sie hatte kein Gift geschluckt, vermutlich besaß sie nicht einmal welches, wohl auch keine Überdosis an Schlaftabletten, sie hatte sich nicht erhängt, sich nicht erschossen. Ihr Selbstmord, an den ich glaube und immer glauben werde, war kein gezielter Selbstmord. Sie hatte nicht beschlossen, hier und jetzt Schluß zu machen. Es handelte sich nicht um eine Kurzschlußhandlung, die durchaus nahe gelegen hätte: nach einem durchzechten Abend war es ihr nicht gut gegangen, und ihr schöner Lebensgefährte Petin hatte sie nach Hause gebracht und sich dann wohl, so sagte er jedenfalls, zu Bett begeben. Andere behaupteten, er sei weiter bummeln gegangen oder was immer er während des Rests der Nacht tat, bevor er beim Morgengrauen nach Hause kam und sie tot fand. Aber das mag Gerede sein. Romy hatte wohl einfach keine Kraft mehr gehabt – weiterzuleben.