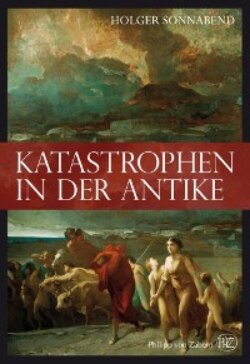Читать книгу Katastrophen in der Antike - Holger Sonnabend - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zerstörung und Auferstehung von Rhodos
ОглавлениеKeiner der Bewohner von Helike hat die Naturkatastrophe, die sich in einer kalten Winternacht des Jahres 373 v. Chr. ereignete, überlebt. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Jedoch: Hilfe war da. Und das war kein Einzelfall. Antike Opfer von Naturkatastrophen konnten sich, wenn sie das Desaster überlebt hatten, darauf verlassen, dass man sich um sie kümmerte. Das hatte weniger mit Humanität zu tun als vielmehr mit politischen Beweggründen. Im Fall von Helike erfolgten die wenn auch wirkungslosen Hilfsmaßnahmen aufgrund der Solidarität innerhalb einer politischen Organisation (des Achäischen Bundes). Eine andere Motivation lag den Hilfsaktionen in der Zeit des Hellenismus zugrunde – also jener Zeit nach dem Tod Alexanders des Großen (323 v. Chr.), die geprägt war von der Herrschaft konkurrierender griechisch-makedonischer Könige. Sehr bezeichnend ist in diesem Zusammenhang der Fall Rhodos. Die griechische Insel vor der Küste Kleinasiens liegt inmitten einer seismisch höchst aktiven Zone, war und ist demzufolge immer wieder teils schweren Erdbeben ausgesetzt. 227 v. Chr. gab es ein besonders heftiges Erdbeben, das immense Schäden verursachte. Viele Gebäude waren zerstört, auch der Hafen war in Mitleidenschaft gezogen worden. Zu beklagen war auch der Verlust eines Weltwunders: Der „Koloss von Rhodos“, eine monumentale Statue des Gottes Helios, 66 Jahre zuvor aufgrund eines Gelübdes errichtet, stürzte ebenfalls ein. Er durfte damit das zweifelhafte Privileg für sich beanspruchen, die kürzeste „Lebensdauer“ unter allen Sieben Weltwundern der Antike gehabt zu haben.
Rhodos war damals eine reiche Handelsrepublik. Reich geworden war man, weil man wusste, wie man zu Geld kam. Es hätte den Bürgern von Rhodos keine Probleme bereitet, den Wiederaufbau nach dem Erdbeben selbst zu finanzieren. Doch man wählte einen anderen, einen raffinierten und gleichzeitig doch auch naheliegenden Weg. Nach und nach besuchten eloquente Abgesandte der Stadt die einzelnen Könige und Fürsten in der großen, weiten Welt des Hellenismus. Sie schilderten die Auswirkungen des Erdbebens in den schwärzesten Farben. Wie die antiken Quellen betonen, traten sie dabei aber so würdevoll auf, dass keiner auf die Idee kam, es mit Bittstellern zu tun zu haben. Doch ihr Anliegen war ganz klar: Sie wollten finanzielle und materielle Mittel einwerben, um den Wiederaufbau durchzuführen und dabei möglichst die eigenen Kassen zu schonen. Und die Rechnung ging auf, denn die Rhodier waren zusätzlich zu allem anderen auch noch geschickte Psychologen. Freimütig sagten sie ihren königlichen Gastgebern, wie viel Geld oder welche Mittel sie von deren monarchischen Kollegen erhalten hatten. Und da zwischen den hellenistischen Herrschern eine gesunde (und manchmal auch ungesunde) Rivalität herrschte, war jeder bemüht, die anderen in Sachen Freigebigkeit zu übertrumpfen. So konnten die Gesandten aus Rhodos überall reich beschenkt die Heimkehr antreten. Was sie an Hilfszusagen im Gepäck hatten, konnte sich wirklich sehen lassen. Hieron und Gelon, die Herrscher von Syrakus, gaben zum Beispiel 75 Silbertalente für den Wiederaufbau der Stadtmauern und der Docks. König Antigonos Doson von Makedonien spendierte, wie buchhalterisch genau festgehalten wurde, 10.000 Dachbalken von 8 bis 16 Ellen Länge, 5.000 Querbalken, sieben Ellen lang, 3.000 Talente Eisen, 1.000 Talente Pech und viele andere Materialien mehr. Auch bei Seleukos, dem Herrscher Syriens, schauten die rhodischen Abgesandten vorbei und zogen auch dort mit reicher Ernte wieder ab. Bei alledem wollte auch der König von Ägypten, Ptolemaios III. mit dem Beinamen Euergetes I. nicht zurückstehen. Er versorgte die Rhodier mit Geld und Fachpersonal, das bei dem Wiederaufbau Hand anlegen sollte. Dank der gebefreudigen Könige konnten sich die Rhodier nun daranmachen, die durch das Erdbeben verursachten Schäden zu beseitigen. Und zufrieden stellten sie am Ende fest: Die Stadt Rhodos erstrahlte nun in neuem Glanz, sie war sogar schöner als vor dem Erdbeben. Nur das Weltwunder Koloss richtete man nicht mehr auf. Da hielten sich die Rhodier an einen alten Orakelspruch, der, allerdings etwas obskur, lautete: „Was gut liegt, soll man nicht bewegen.“ Nach einem Bericht des römischen Antiquars Plinius (Naturalis historia 14,41) machte das kolossale Erdbeben-Opfer aber auch in diesem Zustand noch eine gute Figur: „Der Koloss wurde nach 66 Jahren durch ein Erdbeben umgestürzt, doch auch liegend erregt er noch Staunen. Nur wenige können seinen Daumen umfassen, seine Finger sind größer als die meisten Standbilder. Weite Höhlungen klaffen in den zerbrochenen Gliedern. Innen sieht man große Steinmassen, durch deren Gewicht man die Statue beim Aufstellen stabilisiert hatte.“ Heute liegt der Koloss nicht mehr dort, wo ihn die Rhodier einst nach dem Erdbeben liegen gelassen haben. Als im 7. Jahrhundert n. Chr. die Araber kamen, wurden die wertvollen Trümmer abtransportiert.
Der antike Hafen von Phalasarna an der Westküste Kretas ist heute komplett verlandet – vermutlich eine Folge des Seebebens von 365 n. Chr.