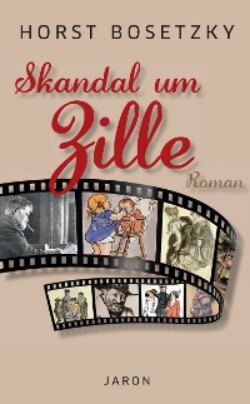Читать книгу Skandal um Zille - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 9
Vier
ОглавлениеJohannes Banofsky war nicht der Typ von Mensch, der Selbstmord beging, wenn er nicht mehr aus noch ein wusste, aber er hätte nichts dagegen gehabt, wenn ihn der Tod in diesen Tagen geholt hätte. Doch der zierte sich. Keine Straßenbahn, mit der Banofsky unterwegs war, kippte in einer Kurve um, noch überrollte ihn eine, wenn er gedankenverloren die Gleise überquerte. Kein Mieter in seinem Haus drehte den Gashahn auf und ließ das ganze Gebäude in sich zusammenstürzen. Kein tödlicher Bazillus wollte sich in Banofskys Körper einnisten, und auch der Schlaganfall suchte sich andere Opfer.
Banofsky blieb nichts anderes übrig als zu begreifen, dass er weiterhin zum Leben verurteilt war. Was seine Kontaktaufnahme mit Heinrich Zille betraf, war er sich mit Cilly einig, dass er nicht mit der Tür ins Haus fallen durfte, sondern einen Türöffner brauchte. Aber wer kam dafür in Frage? Die Wahl musste gut bedacht werden. Also stürzte sich Banofsky erst einmal auf das Thema Tonfilm, denn das war der Dernier Cri. Wenn er einen Produzenten von einem biographischen Zille-Film überzeugen wollte, musste er über dieses neue Verfahren bestens Bescheid wissen.
Mit Erich Pommer, dem Produktionschef der U FA, hatte er schon einige Male zu tun gehabt, und so gelang es ihm, schnell einen Termin für ein Gespräch zu bekommen. Er fuhr hinaus zu den Studios an der Oberlandstraße in Tempelhof.
Pommer war nicht sonderlich gut gelaunt. »Metropolis hat uns allen viel Ruhm und Ehre eingebracht und wird als bester deutscher Stummfilm aller Zeiten in die Geschichte eingehen, aber er hat fünf Millionen Reichsmark gekostet, und die Einführung des Tonfilms traut man mir offenbar nicht zu – meine Ablösung steht schon bereit.«
»Schade …« Banofsky hatte voll auf Erich Pommer gesetzt.
»Aber der Tonfilm als solcher wird kommen?«
»Sicher, sein Siegeszug wird unaufhaltsam sein, vorerst aber geht es nur langsam voran, weil mehrere Firmen erbittert darum kämpfen, ihr System weltweit durchzusetzen und damit Riesengewinne zu machen: Die deutsch-niederländische Gruppe Küchenmeister-Tobis-Klangfilm, Warner Brothers aus den USA und die Tri-Ergon-Musik-AG aus der Schweiz. Noch blockiert man sich gegenseitig, aber irgendwann wird man sich einigen – und dann wird es steil bergauf gehen mit dem Tonfilm. Schluss mit den Untertiteln, Schluss mit dem Gefühl, dass wir nur taubstumme Schauspieler haben!«
»Sind Sie sich da so sicher?« Banofsky zweifelte. »Ich kann mich erinnern, schon im September 1922 im Alhambra-Kino am Kurfürstendamm gesessen zu haben, als der erste deutsche Tonfilm gezeigt wurde. Das ist immerhin bereits sechs Jahre her.«
Erich Pommer nickte. »Der lief damals mit Lichttonspur.« Er sah auf die Uhr. »Nun zu Ihrer Idee …«
Banofsky berichtete, wie er geradezu besessen davon war, Zilles Leben auf die Leinwand zu bringen. »Ganz Berlin liegt ihm zu Füßen, ein solcher Film müsste sich doch rechnen.«
»Ich weiß nicht recht. Vergessen Sie nicht, mein Lieber, dass Heinrich Zille nur ein Berliner Thema ist und nicht alle Deutschen diese Stadt und ihren – Pardon! – teilweise fürchterlichen Dialekt lieben. Da wäre manchen ein Stummfilm wesentlich lieber.«
Banofsky musste schlucken. »Machen Sie mir nicht meinen Traum kaputt!«
»Das war nicht meine Absicht!«, rief Erich Pommer.
»An wen könnte ich mich wenden, wenn die U FA ausscheidet?« Pommer überlegte einen Augenblick. »Gehen Sie zu Otto Guttenberg, der hat für alles Berlinische ein mächtiges Faible.« Banofsky bedankte sich, lief zum Bahnhof Hermannstraße und fuhr mit der Ringbahn eine Station bis Neukölln. Dann lief er knapp einen Kilometer und fuhr anschließend mit der U-Bahn bis zum Bahnhof Friedrichstadt. Von da aus war er schnell in der Leipziger Straße, wo er mit Cilly im Kempinski zum Mittagessen verabredet war. Dort waren die Preise erfreulich zivil.
Sie fanden einen freien Tisch im Burgensaal, dessen Wände Gemälde der Burg Rheinstein, der Wartburg und der Schlösser Eltz und Heidelberg zierten.
»Das ist keine große Kunst«, urteilte Banofsky streng, aber treffend. »Da hätten sie besser Zille rangelassen.«
»Von dem kommst du gar nicht mehr los!«, rief Cilly.
»Genauso wenig wie von dir.« Er küsste sie so intensiv, wie das in der Öffentlichkeit überhaupt möglich war.
Ein Ober räusperte sich.
Banofsky lachte. »Ich weiß, Sie haben Angst um Ihre Gläser. Wenn Sie die bitte abräumen wollen, damit meine Braut und ich hier ungestört auf dem Tisch …«
»Mein Herr, dürfte ich Sie bitten, unser Haus sofort zu verlassen!«
»Sehr gern …«
Banofsky zog Cilly mit sich fort. Die sträubte sich und war böse über seinen Auftritt. »Wir sind hier nicht das Kabarett der Komiker!«
»Leider! Aber die Größe des Saales hat mich an den Reichstag erinnert.«
Den Witz verstand Cilly nicht, und Banofsky konnte sie auch nicht mit dem Vorschlag versöhnen, bei F. W. Borchardt an der Französischen Straße zu speisen.
»Bist du verrückt? Wer soll denn das bezahlen?«
»Keiner. Ich hatte an Zechprellerei gedacht.«
Sie einigten sich schließlich auf die Charlottenklause in der Charlottenstraße, weil die ihren Namen in Zille-Klause geändert hatte und sie hoffen konnten, Heinrich Zille dort zu treffen. Doch er war nicht da.
»Schade, dass das Leben kein Film ist«, sinnierte Banofsky.
»Sonst hätte ich eine Szene in das Drehbuch geschrieben, in der ich Zille hier in seiner Klause treffe – inmitten seiner Bilder.«
»Was nun?«, fragte Cilly.
»Ich werde mich bemühen, so viel wie möglich über Zille zu erfahren.« Dann kam Banofsky auf den Türöffner zu sprechen, an den er am Morgen gedacht hatte. »Ich muss jemanden finden, der mir den Weg zu Zille ebnet, einen engen Freund, nicht nur einen Bekannten wie Kurt Tucholsky.«
»Wie wäre es mit Claire Waldoff?«, fragte Cilly.
»Nein, ich glaube nicht, dass sie sich dazu bereit erklären würde. Ich werde nachher gleich anfangen zu suchen.«
Die Wirtin kam, sie gaben ihre Bestellung auf und redeten dann über Cillys verzweifelte Suche nach Arbeit.
»Bei den Theaterleuten habe ich keine Chance«, jammerte sie.
»Die von den seriösen Häusern sehen mich als kleines Dummchen, das ihre Stücke nicht versteht, und bei der leichten Muse bin ich denen zu interlektuell.«
Banofsky vermied es, sie zu verbessern. »Also gilt für dich dasselbe wie für mich: Nur der Tonfilm kann die Rettung bringen!« Sie stießen darauf an, wenn auch nicht mit Champagner, sondern nur mit Mineralwasser und Pils.
Danach gingen Banofsky und Cilly in eine große Buchhandlung in der Friedrichstraße und sahen sich alle Zille-Alben an, die in den Regalen standen.
Kinder der Straße. 100 Berliner Bilder
Erholungsstunden
Berliner Luft
Mein Milljöh. Neue Bilder aus dem Berliner Leben
Berliner Geschichten und Bilder
Rund um’s Freibad.
Rings um den Alexanderplatz
»Das kann sich sehen lassen!«, fand Cilly.
Banofsky war beim Durchblättern eines Bandes auf eine Zeichnung mit einem Hund gestoßen. »Siehst du, das wäre der Unterschied zwischen einem Bild und einem Film: Im Film würde der Hund jetzt mit dem Schwanz wedeln, und man könnte ihn bellen hören.«
Um das zu verdeutlichen, bellte er wirklich. Einige Kunden guckten pikiert. Ein Buchhandlungsgehilfe kam sogleich herbeigeeilt.
»Wie darf ich das verstehen, mein Herr?«
Banofsky lächelte und machte mit beiden Händen eine ausladende Bewegung in Richtung der deckenhohen Bücherregale.
»Bei so viel Bildung dachte ich, Sie hätten sich auch einmal in die Kynologie vertieft …«
»In was bitte?«
»In die Kynologie, die Lehre vom Hund. Das Wort kommt vom griechischen kýon, der Hund. Wenn Sie die Hundesprache verstehen würden, wüssten Sie, was ich mit meinem Gebell habe ausdrücken wollen: Ich suche eine Biographie über Heinrich Zille.«
Der Jungbuchhändler begriff die Welt nicht mehr. Er hatte den Kunden für einen armen Irren gehalten – und nun äußerte der in einer gehobenen Sprache einen ganz gewöhnlichen Wunsch. Dass sich Cilly kichernd abwandte, irritierte ihn ebenfalls.
»Ich möchte etwas Biographisches über Heinrich Zille«, wiederholte Banofsky. »Eine Biographie ist die Lebensbeschreibung einer Person. Von bíos, das Leben.«
»Ich weiß, ich weiß.«
»Gut. Haben Sie etwas für mich auf Lager?«
»Da bin ich überfragt, tut mir leid.« Der junge Mann eilte davon, um den Inhaber zu holen.
Der kam herbei. Banofsky fand, dass er eine frappierende Ähnlichkeit mit Adele Sandrock hatte. Sein Gehilfe musste ihm schon gesagt haben, worum es ging, denn er kam sofort auf Zille zu sprechen.
»Ich muss Sie leider enttäuschen, mein Herr, aber eine Biographie geschweige denn eine Autobiographie von Heinrich Zille kann ich Ihnen nicht anbieten. In Ausstellungskatalogen werden Sie etwas über sein Leben finden, auch Zilles Rede bei seiner Aufnahme in die Akademie der Künste liegt gedruckt vor. Dazu einige Essays von Otto Nagel. Aber ein richtiges Buch gibt es nicht, auch keine wissenschaftliche Monographie. Zu diesem Thema entsteht zwar derzeit vieles, aber fertiggestellt ist bisher noch nichts. Ich weiß nur, dass in diesem Jahr ein gewisser Rudolf Danke in einem Dresdner Verlag etwas über Heinrich Zille veröffentlichen wird, und hier in Berlin ist Hans Ostwald dabei, ein Zille-Buch zu schreiben – unter Mitwirkung des Künstlers selbst.«
Banofsky fasste sich an den Kopf. »Hans Ostwald – das isses, den kenn ich doch!«
Hans Ostwald war bekannt im Berlin der zwanziger Jahre – sowohl als Schriftsteller wie auch als Kulturwissenschaftler. Schon sein autobiographischer Landstreicherroman Vagabonden hatte einiges Aufsehen erregt, seine Großstadt-Dokumente aber waren Sternstunden der Stadtforschung. In fünfzig Bänden hatten namhafte Autoren – darunter Magnus Hirschfeld und Felix Salten – das Leben in den beiden Großstädten Berlin und Wien nachgezeichnet.
»Berlin wurde lange als Metropole ohne nennenswerte Geschichte gesehen, Wien dagegen als Kulturstadt mit Tradition«, erklärte Hans Ostwald Banofsky, als sie sich im Romanischen Café gegenübersaßen. »Die Bohèmekultur haben wir unter die Lupe genommen, ebenso Homosexualität und Prostitution – na ja, und von den Großstadt-Dokumenten zu Heinrich Zille war es nur ein kleiner Schritt. Schon 1908 habe ich das Vorwort zur Erstausgabe seiner Kinder der Straße geschrieben.«
»Ich erinnere mich an die Aufregung über die Zeichnung vorne auf dem Umschlag«, unterbrach ihn Banofsky. »Sie zeigt, wie zwei fette Polizisten eine Nutte packen und die den rechten Arm hochreckt, die Faust geballt.«
Ostwald nickte. »Genau. Ich habe Heinrich Zille einen sozialen Künstler genannt, den das Elend, das er bei seinen Wanderungen durch die Straßen Tag für Tag vor Augen hat, tief bewegt. Zille ist keiner, der bloß Gelächter erregen will, er hat anderes im Sinn: Er will uns zum Nachdenken zwingen und zur tätigen Mithilfe auffordern. Durch seinen Zeichenstift teilt er uns mit wenigen Strichen mit, wozu andere jahrelange Untersuchungen brauchen. Zudem geht es in seinen Darstellungen nicht nur um Elendsmenschen, sondern auch um die Kraft des Volkes.«
»Das alles will ich auch in meinen Film … äh …«, Banofsky musste kurz nach den richtigen Worten suchen, »… hineinpacken.«
Verhaftung
»In Ihren Film hineinpacken«, wiederholte Ostwald. »Wenn Sie Zille das erzählen, seien Sie vorsichtig, denn er hat oft zu mir gesagt: Mich haben se alle ausgeplündert.«
Banofsky lachte. »Das ist das Schicksal aller Menschen, die Geschichte geschrieben haben: Ihr Leben wird in Büchern, Bildern oder Filmen verarbeitet. Das ist der Preis, den sie zahlen müssen. Oder besser gesagt: Sollen sie sich doch darüber freuen!«
»Nun ja, das ist sicher alles zwiespältig, und noch hat Zille nicht abgewinkt. Aber er ist der Euphorie um ihn herum einfach müde geworden: Zille-Filme, Zille-Kneipen, Zille-Bälle. Außerdem weiß er selbst genau, dass er seit dem Tod seiner Frau nichts wirklich Erwähnenswertes mehr geschaffen hat. Ich will Sie auch nur warnen, lieber Banofsky: Der Umgang mit Zille ist nicht einfach. In mein Zille-Buch redet er mir ständig hinein und ist unzufrieden mit mir. Das liegt daran, dass er eigentlich selbst eine Autobiographie schreiben wollte, dann aber doch nicht die Kraft aufzubringen vermochte, einen solch langen Text zu verfassen. Jetzt wuselt auch noch dieser Rudolf Danke um ihn herum, der ihn ausquetscht wie eine Zitrone. Nein danke!«
»Aber ein Film ist etwas ganz anderes als ein Buch!«, rief Banofsky. »Im letzten Teil könnte sich Zille sogar selbst spielen.«
Ostwald sah ihn etwas spöttisch an. »Und der junge Zille – das sind Sie?«
»Der mittlere vielleicht. Für den jungen Zille, der aus Sachsen nach Berlin kommt, müssten wir noch jemanden suchen.«
»Na, dann man tau!«, rief Hans Ostwald.
»Sie würden so liebenswürdig sein, mich Herrn Zille wärmstens zu empfehlen?«
»Ich werde mein Bestes versuchen. Aber nur, wenn ich als Statist in Ihrem Film mitspielen darf.«
»Versprochen. Können Sie mir noch verraten, welches Zilles Lieblingskneipen waren?«
Hans Ostwald musste nicht lange überlegen. »Tübbecke in Stralau, der Lindengarten des alten Päkelmann in der Köpenicker Straße, der Nußbaum in der Fischerstraße, die Parochialritze, Stallmanns Künstlerkeller in der Jägerstraße, die Charlotten-Klause in der Charlottenstraße, der Stramme Hund am Oranienburger Tor, der Bayrische Bierkeller in der Poststraße, das Weiße Meer in der Rosmarinstraße und der Ausschank Zum Goldenen Hahn in der Landsberger Straße.«
Banofsky saß in der U-Bahn und war auf dem Weg zu Heinrich Zille. Er wäre lieber in die Ringbahn gestiegen, um noch einmal die alten Dampfzüge zu genießen, bevor auch sie Ende des Jahres von elektrisch betriebenen Wagen abgelöst würden, doch vom gemieteten Zimmer in der Köpenicker Straße waren es nur ein paar hundert Meter bis zum Hochbahnhof Schlesisches Tor.
Eigentlich hatte er über bestimmte Drehbuchszenen nachdenken wollen, doch in seinem Kopf lief noch immer der Film ab, bei dem er gestern selbst die Hauptrolle gespielt hatte: Er mit Cilly im Bett. Er liegt auf dem Rücken, sie reitet auf ihm. Er keucht: »Schneller, Cilly, schneller!« Sie nimmt ihn auf den Arm, weil er in letzter Zeit nur noch Zille im Kopf hat. »Cilly mit C vorne oder mit Z? Und hinten mit e?«
Banofsky hatte sich das Berliner Boulevard Blatt gekauft, um während der Fahrt etwas zum Lesen zu haben. Der Aufmacher war der Beginn des Prozesses um die Steglitzer Schülertragödie vom Juni des vergangenen Jahres. Der Oberprimaner Paul Krantz wurde beschuldigt, einen Kochlehrling umgebracht und die Ermordung einer Schülerin geplant zu haben. Seine Verteidigung hatte einer der berühmtesten Strafverteidiger Deutschlands übernommen: Dr. Dr. Erich Frey. Das versprach eine Menge Unterhaltung. Die Zeitung hatte mit Konrad Kowollek ihren besten Mann ins Landgericht II geschickt. Das wäre auch ein schöner Stoff für einen Film, dachte Banofsky.
Am Wittenbergplatz hätte er eigentlich den Zug Richtung Reichskanzlerplatz nehmen müssen, aber er stieg schon eine Station vorher aus, am Sophie-Charlotte-Platz, um über den Horstweg zur Sophie-Charlotten-Straße zu laufen. Im Mietshaus Nr. 88 sollte Heinrich Zille wohnen. Banofsky zog den Zettel hervor, auf dem Hans Ostwald die Adresse notiert hatte. Er mochte nicht recht glauben, dass der große Maler ausgerechnet hier zu Hause war. Als Elendsviertel konnte diese Gegend zwar nicht bezeichnet werden, aber andere Künstler vom selben Rang residierten immerhin in Villen oder hatten große Wohnungen in Berlin W gemietet. Max Liebermann nannte sogar ein eigenes Palais am Pariser Platz sein Eigen. Der Professor Heinrich Zille hingegen logierte im vierten Stock eines mittelmäßigen Mietshauses – natürlich ohne Fahrstuhl, wie Banofsky beim Betreten des Hausflurs feststellte. Selbst ein vergleichsweise junger Mann wie er atmete hörbar schwerer, als er endlich oben angekommen war. Er musste sich erst ein wenig sammeln, bevor er auf den Klingelknopf drückte. Drinnen blieb alles ruhig. Banofsky wagte es, ein zweites Mal zu klingeln, diesmal etwas energischer. Endlich waren schlurfende Schritte zu vernehmen. Dann war Zilles Stimme zu hören.
»Mensch, mich kratzen se ooch noch aus da Erde raus! Hör’n Se uff zu klingeln, ick bin nich da!«
»Ich auch nicht!«, rief Banofsky. »Keine Angst. Mein Name ist Johannes Banofsky. Hans Ostwald hat mit Ihnen gesprochen … Dass Sie so nett sein wollen …«
»Wat is mit’m Sonett? Ick bin doch keen Musiker.«
Banofsky blieb hartnäckig. »Ich will ein bisschen was über Sie wissen …«
»Ach wat!« Zille öffnete die Wohnungstür einen Spaltbreit, zögerte aber noch, sie aufzuziehen. Die Kette blieb davor. »Wissen Se, ick werde übalaufen, täglich, seit vielen Wochen. Von Photographen, Rundfunkleuten, Zeitungsschreibern, Abenteurern, Bettlern … Und nu ooch noch ’n Filmfritze! Bin schon jetzt krank. Die Tür werd ick zunageln. Habe ick nich übaall vakündet: Nüscht wie meine Ruhe will ick – und nich durch Liebkosungen sterb’n!«
»Dann beschimpfe ich Sie eben, damit Sie lange am Leben bleiben: Zille hat nie richtig über den politischen Inhalt seiner Arbeiten nachgedacht und war zu feige, in die K PD einzutreten!«
Zille steckte das mit großer Geste weg. »Det imponiert mir! Mal keena von den Schleimscheißan und Arschkriechan. Wat woll’n Se denn nu jenau, junger Mann?«
»Ich will das Drehbuch für einen großen Tonfilm schreiben, in dem nicht die Figuren aus ihren Zeichnungen die Hauptrolle spielen, sondern Sie als Maler.«
»Det hört sich jut an, dann komm’ Se mal rin.«
Die Kette wurde abgezogen, dann öffnete ihm Heinrich Zille die Wohnungstür. Banofsky, sonst eher frech wie Oskar, war in diesem Augenblick so befangen, dass er kein Wort hervorbrachte. Einem Halbgott so unmittelbar gegenüberzustehen hatte ihm glattweg die Sprache verschlagen.
Zille staunte. »Ehm ham Se doch noch jesprochen – und nu sind Se plötzlich unta die Taubstummen jejangen?«
»Nein, nein, ich finde nur nicht sofort die passenden Worte …«
Zille lachte. »Dann drehn’ Se doch lieba ’n Stummfilm und keenen, wo die Leute wat sajen!«
Banofsky bewunderte den Witz und die Schlagfertigkeit des Alten. Die waren also geblieben, so hinfällig Zille mit seinen siebzig Jahren auch aussehen mochte.
»Herzlichen Dank, dass Sie mich empfangen wollen …«
»Empfangen – wat für’n Wort! Empfangen tun Frauen ihre Kinda, ick bitte Sie nur herein. Und ’n Butler hab ick ooch nich.«
»Aber ich höre doch Stimmen! Ah, das sind Ihre Haushälterinnen …«
»Nee, det sind meine Tigerfinken und meine Sittiche.« Banofsky hatte das Vogelgekreische wohl als solches identifizieren können, wollte sich aber den kleinen Spaß nicht entgehen lassen.
Im Schlaf- und Arbeitszimmer, in das Zille ihn jetzt führte, standen drei Vogelbauer. Zille ging hin, schnalzte mit der Zunge und streichelte den Tieren mit einem Blattstengel die Bäuche. Er hatte die linke Hand, in der er eine erloschene Zigarre hielt, in die Seite gestemmt, wo seine Weste besonders abgetragen wirkte. Den Kopf schräg nach unten geneigt, sah er dem Treiben seiner Lieblinge zu. Einer der Tigerfinken war inzwischen in den Wassernapf gesprungen und spritzte ringsum alles voll.
»So is schön, mein Mätzken«, sagte Zille in einem sanften, singenden Ton. »Bade du nur schön. Ick wisch ooch allet wieda uff.« Dann wandte er sich zu Banofsky. »Die Tierchen wollen nur dafür sorgen, dass ich ’n bisschen Beschäftigung habe.«
Dann erzählte er Banofsky die Tragikomödie von seinen Tigerfinken. »Als det eene Weibchen beim Eialejen jestorm is, hab ick mir ’n neuet besorjt. Det Männchen hat zuerst janz panisch reagiert und det neue Tier fürchterlich hin und her jejajt. Dann hat er uffjehört zu singen, Fräulein Tigerfink aba hat sich einjerichtet bei mir. Die Vögelchen vatrajen sich jut und sprechen ooch mit mir. Und wissen Se wat? Neulich war zufällich ’n Tierarzt hier, und der hat mir azählt, det det Weibchen ooch ’n Männchen is.«
Als Zille geendet hatte, ging sein Blick zum Fensterbrett hinaus, wo sich die Spatzen das Winterfutter holten, das er ihnen hingestreut hatte. »Die bejrüße ick jeden Morjen, weil det die Proletarier unta den Vögeln sind.«
Banofsky sah sich um – und fand bestätigt, was er über Zilles Wohnung im Acht-Uhr-Abendblatt vom 24. Januar 1914 gefunden hatte:
Zille, liest man in großen Buchstaben an der Eingangstür seiner Wohnung, nachdem man die atemberaubende Höhe des vierten Stockwerks erklommen hat. Ein dunkler Gang gähnt dem Besucher entgegen. Dann erscheint Heinrich Zille sein bartumrahmtes Gesicht mit den gutmütig dreinschauenden Augen, die so gar nichts von der Wildheit jener nördlichen und östlichen Gesellen haben, die sein Stift mit Vorliebe entwirft. Nur seine äußere Erscheinung hat sich im Laufe der Jahre dieser Umgebung angepasst. Er trägt einen abgeschabten dunklen Rock, und Kragen und Schlips sind bei der Arbeit nur lästig. Er protestiert gegen das Anständige. Auch die Ölmalerei ist ihm aus diesem Grunde verhasst. Umso mehr überrascht das kleinbürgerlichaltmodisch eingerichtete Zimmer: Möbel aus den achtziger Jahren, Vertiko, Sekretär, Kommode überladen mit Krimskrams, Muscheln, Döschen, Büchsen, Nippesfiguren, über der eine Bronze-Plastik hängt, Zille selbst darstellend.
Banofsky bedauerte, keinen Photoapparat bei sich zu haben. Wenn der Requisiteur später Zilles Wohnung nachgestalten musste, hätten ihm ein paar Photos sicherlich gute Dienste geleistet. Aber das ließ sich sicherlich noch nachholen, bevor die Dreharbeiten losgingen.
Beim genauen Hinsehen entdeckte Banofsky einige Details, die der Zeitungsmann vor vier Jahren nicht wahrgenommen hatte: die Mozart- und die Beethovenbüste zum Beispiel, zwischen denen als Talismane kleine Äffchen aus Gips und putzige Hühnchen aus Ton zu sehen waren »Überall muss wat ruffjestellt sein«, erklärte Zille, »sonst isset nich jemütlich.«
Über dem Vogelkäfig hing ein Kinoplakat.
»Die Verrufenen!”, rief Banofsky. »In dem Film habe ich selber mitgespielt. Ich war der Freund von Robert Kramer.«
»Darum sind Se mir jleich so bekannt vorjekomm’n! Denn vastehn Se ja wirklich wat vom Fülm.« Zille nahm einen menschlichen Unterkiefer von seiner Kommode. »Det hier is ’ne schöne Jeschichte, die muss in’t Drehbuch rin.« Er begann zu erzählen, wie er das gute Stück bei Bauarbeiten auf dem Spittelmarkt gefunden hatte. »Da hat et im Dreißigjährigen Kriej ’n Pestfriedhof jejehm, und als die Arbeita die ausjegrabenen Knochen in Säcke jestoppt ham, hab ick mir den Untakiefa jeschnappt. Een Backenzahn war rausjefallen und hat bei mir inna Jackentasche jesteckt, den hab ick wieda einjeklebt – aba falsch rum. Mein Freund Doktor Heilborn, det is ’n Arzt, hat tajelang darüber nachjedacht, warum die Leuta früha so janz andere Zähne jehabt ham, und hat det uff die andere Anährung zurückjeführt.«
Das Eis war nun endgültig gebrochen, und Heinrich Zille kam mehr und mehr in Plauderstimmung, zumal er auch noch seine Cognacflasche aus dem Spind holte.
»Fülm is wat Wundabaret«, begann er und klagte darüber, wie er sich ein Leben lang gequält hatte, einen Hund zu zeichnen, dem man ansah, dass er mit dem Schwanz wedelte. »Man musste et sojar noch runta schreim. Und im Fülm is det allet keen Problem.«
Kaum hatte Zille die ersten Sätze gesprochen, hörte man ein Grammophon aus der unteren Wohnung.
»Stundenlang jeht det nu so mit det Jeplärre. Nächstens koof ick mir Näjel, tausend Näjel, und kloppe die alle hinta’nanda inne Wand, damit die andern ooch mal wat zu leiden ham.«
Banofsky stampfte ein paar Mal mit dem Fuß auf den Boden.
»Ruhe da unten! Wenn das jetzt ’n Film wäre, würde ich bei Ihnen einen solchen Kurzschluss verursachen, dass unten im Keller die Haussicherung rausfliegt.«
Zille schmunzelte. »Jute Idee, muss ick mir merken. Na, dann fang’n wa ma an.«
Banofsky packte seinen Notizblock aus und spitzte seinen Kopierstift an. »Nun breiten Sie bitte einmal Ihr Leben vor mir aus – ich bin gespannt …«
»Uff die Welt jekomm’n bin ick am 10. Januar 1858 in Radeburg. Det is ’ne Kleinstadt nördlich von Dresden …«
Gegen Mittag war Zille beim Umzug nach Berlin angekommen. Banofsky lud ihn zum Essen ein. Nachdem Zille sich anschließend zu einem kleinen Schläfchen hingelegt hatte, ging es bis zum späten Abend weiter. Banofsky hatte seinen Block vollgeschrieben. Er dankte Zille – nicht nur mit einem kräftigen Händedruck und ein paar freundlichen Worten, sondern mit einer herzlichen Umarmung – und machte sich wieder auf den Heimweg. Glücklich und euphorisch wie nie. Jetzt konnte er loslegen!
Der falsche Zille am Oranienburger Tor hatte Kowollek mächtig Auftrieb gegeben. Aber nun galt es, den engsten Freunden des echten Zille auf den Zahn zu fühlen. Davor grauste Kowollek ein wenig, denn es war schwierig, die Herren Max Liebermann, Hermann Frey und August Kraus zu einem Interview zu überreden. Beweismaterial musste er auch noch sichern. Ein Photoapparat war zu groß, den konnte er nicht eben unter seinem Mantel verborgen einschmuggeln, und gefälschte Bilder und Zeichnungen konnte er auch nicht einfach mitgehen lassen, denn er wollte nicht wegen Diebstahls angeklagt werden. Dennoch musste Kowollek unbedingt etwas unternehmen, wollte er nicht die Chance seines Lebens verspielen. Wenigstens hatte er Rummler überreden können, im BBB eine große Serie über Berlins berühmteste Maler, Schriftsteller und Schauspieler anzukündigen, was ihm bei seinen Nachforschungen eine gewisse Legitimation verschaffte.
Der erste Anruf im Sekretariat der Preußischen Akademie der Künste verlief so, wie es Kowollek erwartet hatte: Ein ausführliches Gespräch mit Herrn Professor Liebermann sei möglich, erklärte ihm ein Sekretär, allerdings nur im Dienstgebäude Unter den Linden.
»Für das BBB ist es unumgänglich, Professor Liebermann in seiner Wannsee-Villa aufzusuchen«, beharrte Kowollek. »Sein Atelier und sein wunderschöner Garten sind für unsere Leser von größtem Interesse.«
»Ich werde mit Herrn Professor Liebermann darüber sprechen.«
Der hatte tatsächlich nichts dagegen, dass Kowollek mit einem Photographen am Wannsee anrückte.
Da es dem BBB finanziell schlechtging, bekamen Kowollek und sein Freund Heiner weder einen Wagen zur Verfügung gestellt noch eine Taxe bezahlt und mussten mit der Reichsbahn fahren. Vom Bahnhof Wannsee bis zur Liebermann-Villa in der Colomierstraße waren es, so schätzte Kowollek nach einem Blick auf den Stadtplan, gut anderthalb Kilometer.
»Mann, is det ’ne Latscherei!«, maulte Karl-Heinz.
»Ich hab nachgeschlagen …«, sagte Kowollek, als sie die Brücke überquerten, die man über den Wasserlauf zwischen dem Großen und dem Kleinen Wannsee gespannt hatte.
»Ich auch«, brummte Karl-Heinz, »beim Fußball letzte Woche. Da ist Nachschlagen aber streng verboten.«
Kowollek quälte sich ein kurzes Lachen ab. »Vorbild für Liebermanns ›Schloss am See‹, wie er es selbst nennt, sind Hamburger Patriziervillen. Der Architekt heißt Baumgarten.«
»Hat der nicht die Bäume im Garten gepflanzt?«
»Nein, das war ein gewisser Alfred Lichtwark, Direktor der Hamburger Kunsthalle.«
Der Photograph wurde ernsthafter. »Hast du Max Liebermann nicht immer bewundert? Und jetzt willst du ihn als Kunstfälscher der Menge zum Fraß vorwerfen?«
Kowollek winkte ab. »Es wird ihm nicht schaden, im Gegenteil: Einem Freund zu helfen, der in Not ist, gilt doch als edel.«
Liebermann empfing sie überaus freundlich, ebenso Grandseigneur wie Original. »Das ist aber schön, dass das BBB mich wieder aus der Versenkung hervorholen will. Dann treten Sie mal näher, meine Herren!«
Kowollek wollte gleich zu Anfang beweisen, dass er sich auf das Gespräch gut vorbereitet hatte. »Man wirft Ihnen vor, nicht mehr der Provokateur von einst zu sein, und behauptet, dass Sie geradezu zum Klassiker geworden sind.«
»Ach, wissen Sie, junger Mann, der Fluch unserer Zeit ist die Sucht nach dem Neuen. Der wahre Künstler strebt nach nichts anderem als der zu werden, der er ist.«
»Mehr Ehrungen, als Sie im letzten Jahr zu Ihrem achtzigsten Geburtstag erfahren haben, sind kaum möglich«, fuhr Kowollek fort und zählte sie alle auf: »Die Ehrenbürgerwürde der Stadt Berlin, die Goldene Staatsmedaille, das Adlerschild des Deutschen Reiches, überreicht vom Reichspräsidenten persönlich …«
Liebermann lachte verschmitzt. »Den Hindenburg habe ich auch porträtieren dürfen. Bei allen unterschiedlichen politischen Auffassungen hatten wir dennoch Respekt voreinander.«
So ging es eine halbe Stunde lang, und Kowollek war schon nahe daran zu verzweifeln, als sich endlich eine Gelegenheit bot, über Heinrich Zille zu reden, ohne dass Max Liebermann hellhörig wurde.
»Womit beschäftigen Sie sich derzeit vorrangig?
»Mit einer Ausstellung der Berliner Secession, die im Herbst dieses Jahres eröffnet wird. Das Thema lautet: Humor in der Malerei.«
»Sicherlich steht Ihr Freund Heinrich Zille im Mittelpunkt«, rief Kowollek.
Liebermann seufzte. »Ach, der Arme …« Er führte Kowollek und den Photographen in eine Art Galerie, in der auch eine Lithographie seines Freundes hing: Zille und sein »Milljöh« gratulieren Max Liebermann. Darauf waren sie alle zu sehen: die dicke Frau mit einem Email-Eimer in der Hand, der Kriegsveteran mit Kiepe und Krücke, der Lude mit seiner Schiebermütze, die junge Mutter mit ihrem Balg auf dem Arm, die vielen frechen Gören … An ihrer Spitze stand Heinrich Zille, der Liebermann seine Glückwünsche aussprach. Unter der Zeichnung war ein kurzer Text zu lesen: Und ich sage mit mein janzet Milljöh:
»Maxe, du bist ooch unser lieber Mann!«
Kowollek staunte ein wenig, denn richtig Berlinerisch wäre doch »ick« statt »ich« gewesen, »unsa« statt »unser« sowie »lieba« statt »lieber«. Und bei »sage« wäre »sare« oder »saje« angebrachter gewesen. Bei diesem Text schien jemand am Werke gewesen zu sein, der die Sprache der unteren Schichten nicht so flüssig beherrschte wie Heinrich Zille.
»Kommt das in die Ausstellung?«
Max Liebermann zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht so recht …«
Kowollek entschloss sich, aufs Ganze zu gehen. »Sagen Sie, Herr Professor, sind denn Zilles Zeichnungen wirklich so einzigartig? Unser Chefredakteur ist fest davon überzeugt. Ich meine aber, dass Sie eine Lithographie wie diese im Handumdrehen auch hinbekommen würden. Auf dem Weg zu Ihnen haben wir einen Jungen gesehen, der Pferdeäppel aufsammelte. Das wäre doch ein typisches Zille-Motiv. Bildunterschrift: Siehste, mein Junge, ooch für unsaeens liejt det Jold uff de Straße.«
Max Liebermann kratzte sich den kahlen Schädel. »Det müsste schon zu machen sein.«
Schon hatte er einen Skizzenblock aufgeschlagen und nahm einen Stift in die Hand.