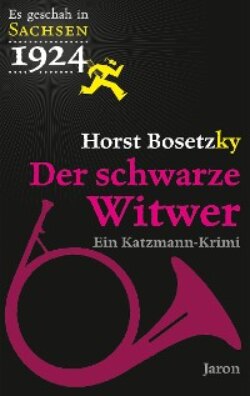Читать книгу Der schwarze Witwer - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 5
EINS
ОглавлениеDicht an einem großen Walde lebte ein alter Mann, der hatte drei Söhne und zwei Töchter; die saßen einstmals beisammen und dachten eben an nichts, als plötzlich ein prächtiger Wagen angefahren kam und vor ihrem Hause still hielt. Dann stieg ein vornehmer Herr aus dem Wagen, trat in das Haus und unterhielt sich mit dem Vater und seinen Töchtern, und weil ihm die eine, welche die jüngste war, überaus wohl gefiel, so bat er den Vater, dass er sie ihm zur Gemahlin geben möchte. – Dem Vater schien das eine sehr gute Heirath, und er hatte schon lange gewünscht, dass seine Töchter noch bei seinen Lebzeiten versorgt sein möchten. Allein die Tochter konnte sich nicht entschließen, ja zu sagen. Der fremde Ritter nämlich hatte einen ganz blauen Bart, und vor dem hatte sie ein Grauen und es ward ihr unheimlich zu Muth, so oft sie ihn ansah. – Sie gieng zu ihren Brüdern, die tapfere Ritter waren, und fragte diese um Rath. Die Brüder aber meinten, sie solle den Blaubart nur nehmen … So ließ sie sich denn bereden und ward die Frau des fremden Mannes …
Als die junge Gemahlin dort ankam, herrschte großer Jubel im ganzen Schloße und auch der König Blaubart war ganz vergnügt. Das gieng etwa vier Wochen lang so fort; da wollte er verreisen und übergab seiner Gemahlin alle Schlüßel des Schloßes und sagte: «Du darfst überall im ganzen Schloße umher gehen und aufschließen und besehen, was Du willst; nur die eine Thür, zu welcher dieser kleine goldene Schlüßel gehört, die darfst Du, so dein Leben Dir lieb ist, nicht aufschließen!» O nein, sie wollte diese Thür auch gewiß nicht öffnen, sagte sie. – Als aber der König eine Weile fort war, hatte sie keine Ruhe mehr und dachte beständig daran, was wohl in der Kammer sein möchte, die er ihr verboten hatte, und war schon im Begriff, sie aufzuschließen; da kam aber ihre Schwester dazu und hielt sie noch davon zurück. Allein am Morgen des vierten Tags konnte sie es nicht mehr über’s Herz bringen und schlich sich heimlich mit dem Schlüßel hin und steckte ihn in das Schloß und öffnete die Thüre. Aber wie entsetzte sie sich da, als das ganze Zimmer voller Leichen lag, und das waren lauter Weiber.
KONRAD KATZMANN mochte zwölf Jahre alt gewesen sein, als er das Märchen vom König Blaubart zum ersten Mal gelesen hatte, aber es sollte sein Denken und Verhalten noch bestimmen, als er schon auf die dreißig zuging – im Fall Dr. Florschütz.
Dr. med. Robert Florschütz, mit weiteren Vornamen Richard und Rodger, war am 27. Juni 1880 in Ortrand zur Welt gekommen, einem Städtchen an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen, das mal zum einen, mal zum anderen Land gehört hatte und 1816 zur preußischen Provinz Sachsen gekommen war. Wie es der Geschichte des Ortes entsprach, kam denn auch Roberts Vater, der Internist und Chefarzt Dr. Richard Florschütz, aus Berlin und seine Mutter aus Leipzig. Sie war Tochter eines Fabrikanten, und beider Welten hatten den Jungen erheblich geprägt: Einerseits wollte er Arzt werden, andererseits aber auch Unternehmer und etwas herstellen und vertreiben. So hatte er in Berlin Medizin studiert und im Krieg auch in diversen Lazaretten gearbeitet, dann aber, als Prothesen und Glasaugen in großer Zahl gebraucht wurden, in Pirna eine Fabrik für Sanitätswaren gegründet. Außerdem betrieb er in Dresden eine Privatklinik zur körperlichen Wiederherstellung von Kriegsopfern und war dabei, in verschiedenen deutschen Städten weitere Geschäfte für Sanitätswaren zu eröffnen. Den Titel «Sanitätsrat», der immer etwas hermachte, hatten ihm seine politischen Freunde verschafft, und er führte ihn immer noch, obwohl es ihn offiziell gar nicht mehr gab.
Von Figur und Aura her war Dr. Florschütz ein gestandenes Mannsbild. Theodor Fontane hätte ihn als «Damenmann» bezeichnet, als jemanden, der auf Frauen eine magische Anziehungskraft ausübte. Dr. Robert Florschütz wies auch eine gewisse Ähnlichkeit mit zwei Männern auf, die gerade dabei waren, als Schauspieler Furore zu machen: mit Emil Jannings und Heinrich George.
So stand es in den Akten diverser Behörden und einigen Zeitungsartikeln, und so sahen ihn die Angehörigen der Firma TOM Pirna. Die drei Buchstaben standen für Technik, für Orthopädie und für Medizin. Verwaltung und Produktionsstätten befanden sich am westlichen Ende der Dresdener Straße.
Hier, in seinem «kleinen Reich», wie er es nannte, fühlte sich Dr. Florschütz am wohlsten. Wie an jedem Tage wanderte er auch an diesem Sonnabend durch die Werkhalle und den Verwaltungstrakt. Das tat er vor allen Dingen, um nach dem Rechten zu sehen – aber auch, um Ausschau nach jungen Frauen zu halten, die er, so seine Worte, «nicht ohne zwingenden Grund von der Bettkante weisen würde». Am Stammtisch, wenn er mit seinen Parteifreunden unter sich war, sprach er auch von seiner täglichen Hühnerjagd. Heute wollte er Traudl beschnuppern, Edeltraut, die Neue in der Poststelle.
«Da ist für Sie eine Büchse aus London gekommen, Herr Sanitätsrat», begrüßte sie ihn und ging in die Ecke, um ihm das längliche Paket zu holen. Als sie es angehoben hatte, las sie ihm den Absender vor. James Purdey & Sons, Gun & Rifle Makers. Da ihr das Englische fremd war, klangen die Worte überaus putzig. Dr. Florschütz belehrte sie eingehend und stellte sich bei der Annahme des Pakets mit Absicht so ungeschickt an, dass er sie kurz an sich drücken konnte.
«O Pardon …»
Sie schien kein Kind von Traurigkeit zu sein und grinste.
Dr. Florschütz gab sich pikiert. «Hören Sie auf, so zu gucken. Ich bin Ihr Chef!»
Traudl kicherte noch eine Spur lauter. «Packen Sie doch Ihre Büchse aus. Oder meinen Sie, dabei könnte ein Schuss losgehen?» Etwas verwirrt machte er ihr einen entscheidenden Unterschied klar: «Dies hier, Fräulein Edeltraut, ist eine Flinte und keine Büchse.»
«Für mich gibt es da keinen Unterschied.»
«Sie sind ja auch kein Jäger. Bei einer Büchse ist der Lauf gezogen, das heißt, die abgefeuerte Kugel bekommt einen Drall und trifft besser. Pro Schuss verlässt nur eine Kugel den Lauf, und mit der erlegt man Keiler, Rehe und Hirsche. Bei einer Flinte dagegen ist der Lauf glatt, und es wird mit Schrotpatronen geschossen. Pro Schuss sind das etwa fünfhundert kleine Bleikugeln, und man schießt damit auf Ziele, die sich schnell bewegen, also Rebhühner, Fasane, Stockenten – das ganze Wildgeflügel eben.»
«Dann muss ich ja aufpassen, wenn ich bei meiner Oma auf dem Bauernhof wieder mal Hühnerfleisch esse», sagte Traudl, «dass ich da auf keine Schrotkugel beiße.»
«Ich glaube, Ihr Großvater wird seine Hühner nicht erschießen, sondern ihnen beim Schlachten den Kopf auf dem Hauklotz abschlagen.»
«Na, Sie sind ja ein grausamer Mensch!»
So flirteten sie noch eine Weile, und Dr. Florschütz genoss es. Als er ins Bureau zurückkehrte, fand er Besuch in seinem Vorzimmer. Es war ein Kriminaler aus Dresden, ein Herr Kautzsch vom Betrugsdezernat, der ihm etwas verriet, das ihn gar nicht erfreuen konnte.
«Bei unseren Ermittlungen gegen einige Herren der Mitteldeutschen Edelstahlwerke sind wir auch auf einen Ihrer Einkäufer gestoßen, einen Werner Tschernske … Der ist doch bei Ihnen in der Firma?»
«Ja, warum?»
Der Mann vom Betrugsdezernat lächelte. «Sie gucken so entsetzt …»
«Allerdings! Herr Tschernske hat immer ein tadelloses Verhalten an den Tag gelegt.»
«Nun, es steht fest, dass Ihr untadeliger Herr Tschernske mit einem Angestellten der Mitteldeutschen Edelstahlwerke einen überhöhten Kaufpreis ausgehandelt hat. Den haben Sie dann auch gezahlt, und die beiden Herren haben sich daraufhin die Differenz zwischen dem, was bei den Mitteldeutschen Edelstahlwerken verbucht worden ist, und dem, was Sie, Herr Sanitätsrat, gezahlt haben, redlich geteilt.»
Dr. Florschütz fuhr auf. «Das ist doch Betrug und damit ein Grund für eine fristlose Kündigung!»
«Ganz recht», bestätigte ihm der Kriminalbeamte. «Ich hätte dann gern einmal mit Herrn Tschernske gesprochen.»
«Ich lasse ihn rufen.»
Nach einer halben Stunde hatte Kautzsch die Vernehmung Tschernskes beendet und dessen Geständnis zu Protokoll genommen. Bevor er wieder abzog, informierte er Dr. Florschütz über den Tatbestand. Der lief sofort in den Einkauf, um Tschernske zu feuern.
«Packen Sie Ihre Sachen, Sie sind fristlos gekündigt! Verbrecher haben in meiner Firma nichts zu suchen.»
«Bitte haben Sie doch Verständnis!», flehte Tschernske ihn an. «Es tut mir leid, ich will Ihnen den Schaden auch gern ersetzen. Ich habe das Geld doch dringend gebraucht! Meine Kinder hungern, und meine kranke Frau muss sich operieren lassen. Und wie viel Geld habe ich Ihnen schon sparen geholfen, weil ich …»
«Raus hier!»
Der Sanitätsrat war so entrüstet, dass er erst einmal in die Kantine eilte und sich einen doppelten Cognac geben ließ. Alkohol während der Arbeit war zwar verboten – aber nicht für ihn. Dieser Tschernske! Dr. Florschütz brauchte einige Zeit, um alles zu verdauen.
Der nächste Besucher an diesem Vormittag war sein Parteifreund Heinrich Nobitz von der DNVP. Die Deutschnationale Volkspartei war die führende nationalkonservative Partei in der Weimarer Republik und stand für Nationalismus, Antisemitismus und alles Konservative und Völkische. Gern hätte man den Kaiser zurückgeholt, und 1920 hatte man den Kapp-Putsch unterstützt.
Bei einer Tasse Kaffee sprach man über verschiedene politische Themen wie den Dawes-Plan und das neue Reichsbankgesetz, vor allem aber über Adolf Hitler, der nach seinem gescheiterten Putsch vom 8. November 1923 nun in der Landsberger Festung wegen Hochverrats einsaß.
«Erst soll er schwere Depressionen gehabt haben und überzeugt gewesen sein, dass man ihn erschießen würde», erzählte Nobitz.
«Nun aber geht es ihm blendend, denn der Gefängnisdirektor Otto Leybold hegt große Sympathien für ihn, und Landsberg soll einem Hotelaufenthalt ähneln. Unter der Hakenkreuzfahne sitzt man, isst und trinkt, feiert und schmiedet Zukunftspläne. Besuch kann Hitler auch ohne weiteres und jederzeit empfangen, und da gewesen sind schon Ernst Röhm, Erich Ludendorff und Julius Streicher.»
«Da hat er also in Landsberg seine neue Parteizentrale», stellte Dr. Florschütz fest.
Nobitz nickte. «So ist es, und die Landsberger Bürger kommen und machen dem ‹Führer› ihre Aufwartung. Wenn er mal Zeit hat, schreibt er an seinem Buch – Mein Kampf soll es heißen.»
Dr. Florschütz sah besorgt aus. «Was meinst du, wie gefährlich kann er uns werden, wenn er wieder draußen ist?»
«Er wird uns viele Stimmen wegnehmen, aber …» Nobitz schüttelte sich, als würde ihn heftiger Ekel packen. «So dumm wird doch das deutsche Volk nicht sein, dass es diesen hergelaufenen österreichischen Anstreicher und Eiferer als Reichskanzler haben will!»
«Dein Wort in Gottes Ohr!»
Nobitz wechselte das Thema. «Ich habe heute Nachmittag und am frühen Abend keine Verpflichtungen. Kommst du nach Dresden? Wir könnten was zusammen essen und …»
Dr. Florschütz lachte. «Da bin ich immer dabei! Ich gucke nur mal kurz auf meinen Terminkalender …» Er seufzte. «Das geht leider nicht, heute habe ich meine Jagdgesellschaft. Gott, das hätte ich glatt vergessen! Und das, wo ich gerade eine neue Flinte aus London bekommen habe …»
«Dann kann ich ja deine alte haben», sagte Nobitz.
Dr. Florschütz lachte noch schallender als zuvor. «Meine Alte kannst du jederzeit haben!»
«Ich meine deine alte Flinte.»
«Die auch.» Dr. Florschütz rief seine Sekretärin und bat sie, ihn doch bitte zu Oberförster Anton Scharrach ins Kirnitzschtal durchzustellen. Nach ein paar Minuten war der «Mann im grünen Rock» am Apparat.
«Stimmt es, mein Lieber, dass wir heute Nachmittag um vier zur Hühnerjagd verabredet sind?»
«Ganz richtig, Herr Sanitätsrat. Die Jagdsaison für Stockenten und Rebhühner ist Anfang September eröffnet worden, und ich freue mich schon darauf, Sie und Ihre Freunde heute am Forsthaus begrüßen zu dürfen. Ihre Frau wird doch mit von der Partie sein?»
«Ja, das nehme ich an, und im Zweifelsfalle werde ich sie wohl überreden können.»
Gisela Florschütz, geboren 1884 in Leipzig als Tochter eines dort ansässigen Fabrikbesitzers, bezeichnete sich selbst als Flüchtling. Ich bin aus dem Land der Träume in die Villa Elb-Blick geflüchtet. hatte sie einmal in ihr Tagebuch geschrieben, nein, ich bin abgestürzt wie einst Ikarus, wenn auch nicht im Meer ertrunken, sondern nur in die Elbe gefallen. Als höhere Tochter hatte sie im Kaiserreich eine angenehme Prinzessinnenrolle gespielt und hätte sich eigentlich damit begnügen können, ein bisschen Bildung zu erwerben und einige weibliche Künste zu erlernen, so die der gehobenen Konversation und der gezielten Verführung eines Mannes der höheren Stände, möglichst einen aus den Reihen des Adels. Doch sie hatte hoch hinausgewollt und sich gewünscht, ihren Namen in den Zeitungen, den Lexika und den Annalen der Film- und Schauspielkunst zu finden. Früh hatte sie Schauspielunterricht genommen und war dann auf den Bühnen einiger Provinztheater aufgetreten. Ihr großes Vorbild war Mia May gewesen – auch sie war Jahrgang 1884 und mit Die Herrin der Welt. Das indische Grabmal und Tragödie der Liebe eine der ersten Diven des deutschen Films –, doch außer einer kleinen Rolle in Das Kabinett des Dr. Caligari von Robert Wiene hatte Gisela Culitzsch, wie sie mit Mädchennamen hieß, nichts erreichen können. Aber nach dem Tod ihres Vaters hatte sie eine Menge Geld geerbt und sich schnell damit abgefunden, dass es für sie nur eine Rolle gab: die der Ehefrau und Mutter. Sie hatte den erstbesten Mann geheiratet, der ihr über den Weg gelaufen war – und das war Sanitätsrat Dr. Florschütz. Bei einem Wohltätigkeitsball in Leipzig hatte er sie zu einem Walzer aufgefordert. Liebe war es nicht gewesen, Gott, da hatte sie ganz andere Liebhaber gehabt – und hatte auch jetzt noch einen –, aber er machte als Mann wie als Arzt, Fabrikant und Politiker etwas her, und das Leben an seiner Seite war keinen Tag langweilig. Und man wusste ja nie, wie in der Politik die Würfel fielen – vielleicht wurde er eines Tages noch Minister. Dass er seine Amouren und Affären hatte, wusste sie, störte sie aber nicht. Wegzulaufen drohte er ihr nicht: Da er einen großen Teil seiner Unternehmungen nur mit ihrem Geld finanzieren konnte, hatte sie ihn fest in der Hand.
Es war Zeit, sich für die Jagd umzuziehen. Gisela Florschütz ging zu ihren Kleiderschränken, um zu sehen, ob ihr der alte Lodenmantel noch passte.
Von Pirna ins Kirnitzschtal brauchte man mit einem Kraftfahrzeug kaum mehr als eine halbe Stunde, und da die sechsköpfige Jagdgesellschaft über einen Audi Typ K und einen Mercedes-Benz Viano verfügte, war das Ganze kein Problem. Auf die Minute pünktlich hielten sie vor dem Forsthaus: der Hotelier und Gastwirt Gerhard Pöhlau, der Gymnasialdirektor Ludwig Hölzel, der DNVP-Politiker Heinrich Nobitz, der Apotheker Meinhard Müschen und Dr. Florschütz mit seiner Frau Gisela. Oberförster Anton Scharrach hatte sich schon am Straßenrand aufgestellt, um sie in Empfang zu nehmen.
«Waidmannsheil, die Dame, die Herren!», rief er und fuhr mit der rechten Handkante hoch zum Hut.
Dr. Florschütz lachte beim Aussteigen. «Noch danken wir nicht, noch haben wir ja nichts geschossen.»
Das Wetter war nicht berauschend, vorwiegend war es wolkig, nur ab und an kam die Sonne hervor – wenigstens aber gab es keinen Regen. Hölzel hatte sein Jagdhorn mitgebracht und blies ein Stück von Karl Stiegler. Daraufhin kam die Frau des Oberförsters und reichte allen eine kleine Erfrischung.
«Ah, da ist unser Zielwasser!», merkte Heinrich Nobitz an. Auch Gerhard Pöhlau war in heiterer Stimmung ins Kirnitzschtal gekommen und begrüßte Gisela Florschütz mit einem Handkuss. «We are pleased to welcome the daughter of the U.S. president in our hunting party.»
«Wieso sollte meine Frau die Tochter des amerikanischen Präsidenten sein?», fragte Dr. Florschütz.
«Na, sie ist doch eine geborene Culitzsch!» John Calvin Coolidge, Jr. war im letzten Jahr der dreißigste Präsident der USA geworden.
Fröhlich und beschwingt machte sich die Jagdgesellschaft auf den Weg ins Revier der Wildhühner. Auf breiteren Wegen ging man plaudernd nebeneinander, auf schmalen Pfaden sicherheitshalber hintereinander. Es gab Felder und Wiesen im steten Wechsel, und ab und an kreuzte man ein stilles Wäldchen. Fliegenpilze leuchteten rot aus dem Gras, Schmetterlinge aller Farben und Arten erfreuten Auge und Sinne, es roch immer wieder nach frisch gemähtem Gras. Es war eine Idylle, wie sie im Buche stand.
Langsam näherten sie sich dem Gebiet, das viel Wildgeflügel versprach. An der Spitze der Gruppe – an der Tete, wie man es nannte – ging Meinhard Müschen, der die Namen aller Pflanzen kannte und die anderen gern belehrte. Ihm folgten Ludwig Hölzel, Gerhard Pöhlau und Heinrich Nobitz. Die letzten drei waren Gisela Florschütz, der Sanitätsrat und der Oberförster, der gern alles im Auge hatte.
Plötzlich krachte ein Schuss. Und ein zweiter. Nahezu zeitgleich mit dem ersten.
Als Heinrich Nobitz herumfuhr, sah er Gisela Florschütz zu Boden sinken.
«Der Sanitätsrat hat seine Frau erschossen!», rief der Oberförster.
«Ich bin auf meine Schnürsenkel getreten», stammelte Dr. Florschütz. «Die sind offen … Ich bin gestolpert … Und da muss sich versehentlich der Schuss gelöst haben.»
Der Apotheker hatte sich neben Gisela Florschütz gekniet. «Mein Gott, sie stirbt!»