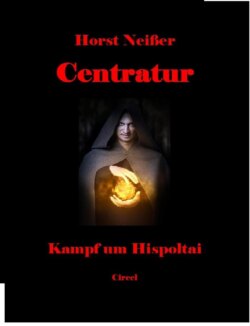Читать книгу Centratur I - Horst Neisser - Страница 6
ОглавлениеDie Geschichte vom Kampf um Hispoltai
Osten
Marc, Mogs Sohn, wandert nach Waldmar zum Schloss seines Paten. Er soll dort warnen und um Hilfe bitten. Doch er kommt zu spät. In dem Land jenseits des großen Flusses erwartet ihn furchtbares Elend. Zusammen mit der Grafentochter Akandra flieht er vor den Orokòr. Sie gelangen in eine seltsame Welt und erhalten einen wichtigen Auftrag.
Die Reise nach Waldmar
Marc kam er rasch voran. Am frühen Vormittag befand er sich schon jenseits der Oststraße, die er unbemerkt überquert hatte. Auf seinem Weg war er bisher niemandem begegnet und fühlte sich einsam. Gegen Mittag setzte er sich in den Schatten einiger Bäume und aß mit gutem Appetit von dem mitgebrachten Proviant. Der junge Erit genoss es, außerhalb der Enge des Elternhauses durch die Welt zu ziehen. Nun, nachdem die Mahnungen und Ratschläge von Mutter und Vater verstummt waren, fiel ein Druck von ihm ab. Er streckte sich und atmete tief durch. Marc bereit für das Abenteuer.
Noch immer war die Gegend wie ausgestorben. Dies verwirrte ihn. Wenn hier er früher gewandert war, hatte er Holzfäller, Jäger und Bauern getroffen, die mit ihren Ochsenfuhrwerken auf die Felder fuhren. Schließlich erreichte der junge Erit das Ende des Waldes im Osten. Von hier fiel der Weg steil ab. Die ausgefahrenen Spuren des Weges schlängelten sich in kurzen Serpentinen hinunter zur Mooraue.
Als Marc einmal stehen blieb und nach Osten blickte, sah er in der Ferne schwarzen Rauch wie von großen Bränden. Er konnte sich keinen rechten Reim darauf machen und kümmerte sich nicht weiter darum. Weit nach Mittag erreichte er die Ebene. Er war inzwischen fußwund. Aber irgendetwas trieb ihn vorwärts, gönnte ihm keine Ruhe.
Früher als gedacht erreichte er Loidl eine kleine Arbeitersiedlung. Die Gegend um Loidl war sumpfig. Von dieser Unbill der Natur lebte die Bevölkerung des Ortes. Die Männer gruben lange, tiefe Entwässerungsgräben und stachen mit besonderen Werkzeugen den Torf. Der getrocknete Torf wurde zu Ballen verpackt und im ganzen Heimland verkauft. Reichtümer waren mit diesem Geschäft zwar nicht zu gewinnen, aber die Leute hatten ihr Auskommen.
Die Straße führte am Ort vorbei. Arbeitshütten säumten den Weg. Immer wenn Marc früher in dieser Gegend war, hatte er dort stets fleißige Männer gesehen. Heute war alles leer und verlassen. Nur Torfziegel lagen in langen Reihen zum Trocknen ausgebreitet. Verwirrt blieb er stehen und sah sich um. In dem trüben Licht des verhangenen Tages sah alles so trostlos und gespenstisch aus. Niederes Gesträuch und dunkle Weiden gaukelten gefährliche Tieren vor. Fliegen und Stechmücken hatten sich zu Schwärmen über den Wassertümpeln vereint. Marc machte, dass er weiterkam.
Als es dann dunkel wurde suchte er sich ein Lager zwischen Büschen. Seine Kleider waren klamm und er schlief schlecht. Deshalb war er über den neuen Tag froh und machte sich schon bei den ersten Sonnenstrahlen auf den Weg.
Am späten Nachmittag erreichte er endlich Moordorf. Vor Stunden hatte Nieselregen eingesetzt, und Nebel war aufgezogen. Der Wanderer war nass und erschöpft. Voller Hoffnung auf eine trockene Unterkunft lief er die Dorfstraße entlang. Er hatte Hunger wie ein Bär und freute sich auf das weit gerühmte Bier, das hier gebraut wurde. In Moordorf, so hatte sich Marc vorgenommen, wollte er übernachten, um am nächsten Morgen nach Waldmar überzusetzen.
Allzu große Eile schien ihm noch immer nicht geboten. Sicher, dem Heimland drohten Gefahren, und seine Aufgabe war es auch, die Grafenfamilie zu warnen. Aber Waldmar war durch den Wilden Wald auf der einen Seite und den Großen Fluss auf der anderen gut geschützt. Die Menschen dort galten zudem als kampferprobt und gelassen im Umgang mit Gefahren. Bisher hatten sie noch jedes Unheil abzuwenden vermocht.
Wie er so zwischen den Häusern hindurch schritt, fiel ihm die seltsame Ruhe auf, die über Moordorf lag. Straßen und Gassen waren leer. Niemand ließ sich sehen. Auf den Höfen der Bauern pickten keine Hühner und schnüffelten keine Schweine. Alle Fenster und Türen waren geschlossen und manche sogar verrammelt. Eine vergessene Forke steckte in einem Misthaufen.
Auch der Gasthof sah verlassen aus und seine Fenster waren mit festen Holzläden verschlossen. Hungrig und müde klopfte er dennoch an das grün gestrichene Tor. Da niemand antwortete, pochte er stärker und begann zu rufen. Es konnte doch nicht sein, dass das ganze Dorf verwaist war. Seine Hand tat ihm schon weh, als er hinter der Tür etwas hörte.
Er solle nicht solch einen Lärm machen, rief eine ärgerliche Männerstimme. Ob er denn nicht merke, dass der Gasthof geschlossen sei. Er solle schleunigst weitergehen. Fremde seien in Moordorf zurzeit unerwünscht. Wenn er diesem Rat nicht umgehend Folge leiste, so werde man es ihm mit Knüppeln beibringen.
Marc versuchte zu erklären, dass er eine weite Wanderung hinter sich habe und Verpflegung und Ruhe brauche. Die Stimme hinter der Tür wurde immer wütender. Doch erst das Gebell von zwei Hunden, mit denen, zumindest dem Kläffen nach, nicht zu spaßen war, schreckte den Wanderer vollends ab. Hinkend und enttäuscht machte er sich wieder auf den Weg. Mit eingezogenem Kopf durchquerte er den trostlosen Ort. Trotz der Nebelschwaden, die mehr und mehr die Häuser und Höfe verhüllten, fühlte er die Blicke, die aus allen Ritzen und Läden auf ihn gerichtet waren.
Er ließ Mooraue hinter sich und erreichte nach einer Viertelstunde den Tabakweg. Der Begriff ‘Weg’ war irreführend. Es handelte sich dabei um eine breite Straße, die im Norden von der Oststraße abzweigte und nach einem eleganten Schwung am Erfstrom entlang nach Süden führte. Der Nebel war nun so dicht, dass der junge Erit kaum noch seine Hand vor den Augen sehen konnte. Brandgeruch hing in der nassen Luft, aber er konnte nicht ausmachen, woher er kam.
Beinahe wäre Marc in die Falle gelaufen, denn plötzlich hörte er ganz nahe Stimmen und sah den Schein eines flackernden Feuers.
„Wie lange sollen wir in dieser Waschküche noch hocken?" beschwerte sich eine schrille Stimme. „Wir müssen die Straße bewachen, während sich die andern beim Plündern die besten Stücke unter den Nagel reißen. Unsere Wache hier ist völlig unnötig. Es kommt doch niemand vorbei."
Marc blieb starr im Nebel stehen. Zu gern hätte er gewusst, mit wem er es zu tun hatte. Aber er wagte sich nicht näher heran. Stattdessen versuchte er, das Zittern seiner Hände unter Kontrolle zu bekommen. Schließlich konnte er wieder ruhig atmen und kehrte nach kurzer Überlegung nach Moordorf zurück. Er verstand nun die Menschen und ihre Angst. Im Ort klopfte er doch noch einmal an die eine oder andere Tür. Er hoffte noch immer auf ein wenig Wärme und Nahrung. Aber wie beim ersten Mal hatte er keinen Erfolg, sondern wurde mit Flüchen und Verwünschungen verscheucht.
Er machte sich nun doch große Sorgen um die Familie seines Paten. Besonders Akandra, dessen Tochter, ging ihm nicht aus dem Sinn. Ganz deutlich hatte er ihr Gesicht vor Augen, die braunen Augen und die Stupsnase.
‚Ich muss nach Waldmar’, dachte er, ‚koste es, was es wolle. Wenn ich hier nicht an den Fluss komme, weil die Straße bewacht ist, dann pirsche ich mich eben über die Felder. Das ist zwar ein Umweg, aber es bleibt mir wohl nichts Anderes übrig. ’
Er bog in der Mitte des Ortes, dort wo der Brunnen stand, nach Westen ab. Ein schmaler Weg führte zwischen zwei Bauernhöfen hindurch und hinaus auf die Felder. Das letzte Haus, an dem er vorbeikam, war klein und grau, der Vorgarten mit dünnen Stecken eingezäunt. Auch hier waren die Läden geschlossen. Aus dem Inneren hörte man Hühner und Enten.
Marc entschloss sich zu einem letzten Versuch und klopfte. Einsam stand er vor der Tür und wartete, während der milchige Nebel ihn umfing. Endlich hörte er Geräusche über sich und schöpfte Hoffnung. Zuerst öffneten sich ein Laden und dann das Fenster. Er sah hinauf und wollte schon freundlich grüßen, als ein eiskalter Schwall Wasser auf ihn niederging. Jemand hatte einen Kübel über ihm ausgekippt und riegelte nun geräuschvoll das Haus wieder ab. Der junge Erit war nun zu allem Überfluss auch noch nass bis auf die Haut.
Bald taumelte er nur noch in einer Art Halbschlaf dahin. Seine letzte Wegzehrung hatte er längst gegessen, den letzten Tropfen Wasser getrunken. Endlich, als er bereits überlegte, ob er sich nicht einfach in das nasse Gras am Wegrand werfen sollte, lichtete sich der Nebel. Zuerst konnte er nur wenige Meter weit sehen. Dann erkannte er Felder zur Linken und zur Rechten. Er sah abgeerntete Apfelbäume auf den Wiesen. Aus ihren Früchten wurde der in ganz Centratur berühmte Apfelwein gebraut. Direkt vor Marc aber türmten sich große schwarze Blöcke auf. Neugierig trat er näher. Der Geruch von verbranntem Holz wurde stärker. Darunter mischte sich ein Gestank, den er nicht kannte. Der Wanderer sah näher hin und stellte mit Schrecken fest, dass er vor den Trümmern eines Bauernhofs stand.
Das Bild, das sich ihm bot, war trostlos. Die Dächer der Häuser waren eingebrochen und verbrannt. Einige der dicken Balken rauchten noch. Die hohe Umfassungsmauer des Gehöftes war eingerissen, das schwere Tor hing schief in den Angeln. Voller Entsetzen sah Marc in der Haustür eine zusammengesunkene Gestalt und auf dem verwüsteten Hof die Kadaver von großen Hunden liegen. Alle waren sie von schwarzen Pfeilen durchbohrt. Nun wurde ihm schlagartig bewusst, wo er war. Dies war einstmals der Hof vom Bauer Sturm gewesen. Ein freundlicher Bauer, den sein Vater auf seinen Wanderungen oft besucht hatte. Einmal hatte ihn Marc dabei begleiten dürfen. Der Bauer war damals schon alt gewesen und inzwischen längst gestorben. Seine Söhne hatten die Wirtschaft übernommen und weiterhin dafür gesorgt, dass lichtscheues Gesindel um den Sturmhof stets einen Bogen machte.
Nun gab es den Hof nicht mehr. Seine Bewohner waren tot und ihre scharfen Hunde ermordet. Marc schauderte. Wer hatte dieses Verbrechen begangen? Gab es gegen diesen Feind überhaupt eine Chance? Angst krampfte sich um sein Herz. Er wusste, dass er keine Zeit verlieren durfte, wenn er die Waldmarer noch rechtzeitig warnen wollte. Wahrscheinlich war bereits alles zu spät und seine Mission gescheitert. Wieder dachte er an Akandra, die Tochter des Grafen Marrham. Sicher, sie war eine hochmütige junge Dame, aber sie durfte auf keinen Fall in die Hände der Bestien fallen, die das hier angerichtet hatten.
Der Gedanke an Akandra gab seinem müden Körper wieder Kraft. Er richtete sich auf und zwang sich zur Ruhe. So leise er konnte, ging Marc weiter. Dabei spähte er aufmerksam nach allen Seiten. Aber die Vorsicht war unnötig. Weit und breit war außer ihm kein Wesen zu entdecken. Wahrscheinlich hatte das schlechte Wetter alle Angreifer in einen Unterschlupf getrieben. Ungehindert bog Marc nach zwei Stunden auf den Pfad zum Fluss ein.
In der letzten halben Stunde hatte der Brandgeruch wieder zugenommen. Die Nacht hatte sich inzwischen herabgesenkt. Regenwolken verdeckten das trübe Mondlicht. Es war so dunkel, dass man die Hand nicht mehr vor den Augen sehen konnte. Endlich war er am Ziel und stand auf einem Anlegesteg am Ufer des Erfstrom, den er mehr ahnte als wahrnahm. Der Brandgeruch war nun beinahe unerträglich. Marc stieg die drei Holzstufen zum Wasser hinunter. Aber nirgendwo lag ein Kahn, mit dem er den Fluss hätte überqueren können.
Müde, enttäuscht und ratlos ließ er sich unter einem Busch am Ufer nieder. Vor ihm rauschte und gurgelte der große Fluss. Nieselregen kam auf und drang durch seine Kleider. Trotzdem wäre er beinahe eingeschlafen, als er plötzlich in der Ferne das Getrappel von Pferdehufen hörte. So klangen keine Ponys, dies war der schwere Gang eisenbeschlagener großer Pferde.
Einem plötzlichen Impuls folgend erhob sich Marc, lief zur Uferböschung und zog seinen dunklen Mantel eng um sich. Es dauerte nicht lange, und die Pferde kamen näher. Marc hielt den Atem an. An der Abzweigung zum Landungssteg blieben die Reiter stehen. In diesem Augenblick kam der Mond hinter den Wolken hervor. In seinem fahlen Lichtschein konnte Marc silberne Rüstungen und hohe Helme erkennen.
„Wir kommen zu spät“, sagte der eine Reiter. „Dem Geruch nach zu urteilen, ist dort keine Hilfe mehr nötig."
„Hier kommen wir nicht über den Fluss. Ich kann kein Gefährt entdecken. Weiter unten aber sind die Orokòr."
„Armes Heimland! Es bräuchte so dringend Hilfe, aber wir sind zu schwach."
Marc wollte schon aufspringen und die Fremden grüßen. Sie schienen Freunde zu sein. Er wollte sie fragen, was geschehen sei, wollte sie um Rat und Hilfe bitten. Aber sie waren schon weiter geritten, und er sah nur noch ganz fern ihre Rüstungen blitzen.
Während er noch über die Reiter nachdachte, rissen die Wolken gänzlich auf und im fahlen Licht des Mondes sah der Erit flussabwärts ein kleines Boot. Es war abgetrieben und hatte sich in den Ästen einer Weide verfangen, die tief über dem Wasser hingen.
Marc schlich am Ufer entlang und kletterte vorsichtig hinein. Unversehens stand er bis zu den Knöcheln im Wasser. Das Schiffchen leckte. Mit so einem morschen Kahn den großen Strom zu überqueren, war ein waghalsiges Unterfangen. Doch Marc zauderte keinen Moment. Die Sorge um Akandra trieb ihn vorwärts. So setzte er sich auf die Ruderbank und nach kurzer Zeit sah er um sich nur noch Wasser.
Mit aller Kraft legte er sich in die Ruder. Doch so sehr er sich auch sich auch abmühte, der alte Kahn wurde mehr und mehr von der starken Strömung abgetrieben. Das Ufer, zu dem er wollte, kam und kam nicht näher. Angst breitete sich in seinem Kopf aus. Mit einem Mal wurde ihm klar, in welcher großen Gefahr er sich befand. Doch einer Eingebung folgend hörte er auf gegen den Fluss zu kämpfen. Er hatte die Hoffnung aufgegeben bei dem Anlegesteg unterhalb des Schlosses anzukommen. Stattdessen ließ er sich treiben und ruderte nur noch Meter um Meter auf das andere Ufer zu. Diese Taktik ging auf. Endlich legte der Kahn weit entfernt vom Schloss an Land an. Er hatte inzwischen so viel Wasser aufgenommen, dass es bis an die Knie des Erits reichte. Hätte die Überfahrt noch länger gedauert, so wäre das Boot wahrscheinlich gesunken. Erleichtert sprang Marc ans Ufer und atmete tief durch.
Vor vielen Generationen waren die Vorfahren der Familien in Waldmar über den Erfstrom gerudert und hatten dort das Land urbar gemacht. Keiner weiß mehr, was sie dazu veranlasst hatte. War es der Wunsch, ein eigenes Reich zu gründen oder einfach nur Ärger mit den Nachbarn im Heimland? Wie auch immer, sie nahmen das Land an der Stelle in Besitz, wo der Wilde Wald nicht bis zum Flussufer reichte. Es handelte sich um ein recht ansehnliches Areal. Der Wilde Wald akzeptierte die neuen Nachbarn, und noch heute fragte man sich im Heimland, welcher Pakt damals mit den Bäumen geschlossen worden war.
Es entstanden neue Ortschaften ‘Heuhof’ und ‘Wiesloch’. Dazwischen lagen Felder und Wiesen und auch Mühlen, denn die Leute in Waldmar waren fleißig und brachten es bald zu beträchtlichem Reichtum. Die Bauern in der Mooraue standen freundschaftlich mit den Leuten aus Waldmar. Man konnte mit ihnen gute Geschäfte machen, und dies war auch so geblieben, nachdem der König Marrham zum Graf ernannt hatte. Im Grunde war alles unter seiner Regentschaft gleich geblieben, man fühlte sich nur noch ein wenig vornehmer als früher. Dies alles ging Marc durch den Kopf, als er die Böschung hinaufkletterte und eilends zu der mit Bäumen gesäumten Chaussee eilte.
Das Massaker
Seinen Marsch durch das verbrannte Land und die rauchenden Ruinen würde Marc wohl nie vergessen. Bald begann es zu dämmern, und das bleiche Tageslicht enthüllte ein furchtbares Grauen. Wo früher heimelige Häuser gestanden hatten, sah der junge Erit jetzt nur noch Trümmer und glimmende Balken. Die Orokòr hatten keinen Stein auf dem anderen gelassen. Das Schlimmste aber waren die Leichen. Sie hingen aus ausgebrannten Fensteröffnungen, lagen zusammengesunken in den Vorgärten oder waren auf der Flucht mit schwarzen Pfeilen im Rücken zusammengebrochen. Viele der Toten waren verstümmelt und grausam gefoltert worden. Selbst die Kinder hatten die Bestien nicht am Leben gelassen.
Nun erkannte der Wanderer auch, woher dieser süßliche Geruch gekommen war, den er schon auf der anderen Seite des Erfstrom bemerkt hatte. Es war der Gestank verwesender Leichen. Marc wurde es schlecht. Er erbrach sich würgend. So etwas Entsetzliches hatte er noch nie in seinem Leben gesehen und sich bisher nicht einmal vorzustellen vermocht. Ein ungeheurer Hass auf die Orokòr erfüllte sein Herz. Sie sollten für ihre Verbrechen büßen, dafür wollte er, Marc, Mogs Sohn, sorgen. Er dachte an die Familie seines Paten und ganz besonders an Akandra. Er wusste, dass er zu spät kam. Dafür trug er die Schuld, er hatte auf dem Weg zu sehr getrödelt. Aber hätte er das Gemetzel tatsächlich verhindern können, wenn er rechtzeitig da gewesen wäre? Wahrscheinlich wäre er auch umgebracht worden! Was suchte er noch in diesem Chaos? War es nicht höchste Zeit, zurück nach Heckendorf zu eilen? Er musste dort von den Verbrechen, die hier verübt worden waren, berichten. Alle Erits mussten umgehend gewarnt werden. Die Morde in Waldmar waren sicher erst der Anfang. Bald würde das ganze Heimland überfallen und das Töten weitergehen. Grausame, mitleidlose Mörder waren in seine Heimat eingedrungen. Dieser Wahrheit musste man ins Auge sehen, und es gab niemanden, der Schutz hätte bieten können.
Die Sonne stand noch nicht an ihrem höchsten Punkt, als Marc endlich das Schloss erreichte. Auch der einst so stolze Sitz des Grafen lag in Schutt und Asche. Die Blumenrabatten um das Herrschaftsgebäude waren zertrampelt. Von der ganzen Pracht, dem Stolz der Waldmarer, war nichts mehr übriggeblieben. Die Fensterhöhlungen glotzten leer und rußgeschwärzt, die Türen waren eingetreten und zersplittert. Auf ihrer Suche nach Schätzen hatten sich die Orokòr wenig Zeit gelassen und waren rücksichtslos vorgegangen. Überall lagen Leichen.
‚Akandra? Wo ist Akandra? ’ fragte sich der einsame Erit immer besorgter.
Sie durfte nicht tot sein. Zwischen ihnen war noch etwas, das ausgetragen werden musste. Diesem Mädchen wollte er noch etwas beweisen. Wie vom Schlag getroffen wurde ihm plötzlich klar, dass er Akandra gern hatte.
Nun gab es für Marc kein Halten mehr. Er stürmte ins Schloss und rannte keuchend durch die langen Gänge und zerstörten Räume. Immer wieder musste er über tote Waldmarer steigen. Der Leichengestank war kaum zu ertragen. Zerbrochene Möbel versperrten seinen Weg. Er räumte sie mühsam beiseite. Türen hingen schief in den Angeln oder waren verklemmt. Einige der Erits hatten versucht, sich zu verbarrikadieren; andere hatten aus den Fenstern fliehen wollen und waren hinterrücks erstochen worden. Wie viel Leid und Schrecken hatten sich hier abgespielt! Verzweifelt fragte sich Marc, wie es möglich war, dass lebende Wesen so grausam sein konnten. Wenn es eine höhere Ordnung in der Welt gab, warum wurden dann derartige Verbrechen zugelassen? Wo war die Macht des Guten gewesen, als hier das Böse gewütet hatte?
Mutlos, aber noch immer verbissen suchte er im ganzen Schloss nach der Tochter seines Paten. Tränen liefen ihm über das Gesicht, als er unter die umgeworfenen Tische und in die zerbrochenen Schränke sah. Er wäre schon glücklich gewesen, wenn er wenigstens die tote Akandra gefunden hätte. Die Ungewissheit über ihr Schicksal marterte ihn. Bald gab es im Schloss keinen Raum mehr, den er nicht untersucht hatte. Aber außer Verwüstung und einer Unzahl unbekannter Toten hatte er nichts entdeckt. Mit hängenden Schultern verließ er die zerstörte Wohnstatt und streifte ziellos durch das verheerte Land. Irgendwann gelangte er auch zum Wilden Wald.
Gedankenverloren starrte er auf die Bäume. Plötzlich hatte er eine Idee, und dieser Gedanke machte ihm Hoffnung. Sein Körper straffte sich, er erwachte aus seinem Dämmerzustand. Vorsichtig ging er am Waldsaum entlang, bis er eine Lichtung fand. Und wirklich saß dort, mitten im Gras zwischen den hohen Bäumen, Akandra. Sie war unversehrt, aber so verstört, dass sie ihn nicht erkannte. Sie hatte rechtzeitig fliehen können und sich an den einzigen Ort gerettet, an den ihr die Orokòr nicht zu folgen wagten. Der Wilde Wald rief gerade bei den bösen Geschöpfen Furcht und Entsetzen hervor.
Marc ging langsam auf das geistesabwesende Mädchen zu und redete begütigend auf sie ein. Dann half er ihr vorsichtig auf die Füße, nahm ihre Hand, und sie wehrte sich nicht. Ihre Augen waren trocken und stumpf. Vorsichtig legte er seinen Arm um ihre Schulter, doch sie schüttelte ihn unwirsch ab. Marc sagte nichts, sondern blieb ruhig neben ihr. Lange standen sie stumm und unbeweglich im Wilden Wald, bis die Sonne tief am Himmel stand und ein kühler Wind aufkam. Da endlich bäumte sich der Körper des Mädchens auf. Sie zitterte wie im Fieber. Tränen liefen ihr über die Wangen, und mit einem verzweifelten Schluchzen warf sie sich an die Brust des Jungen. Irgendwann hatte sie sich ausgeweint, löste sich von ihm und trocknete ihre Augen. Dann, ganz überraschend, sagte sie ruhig, als wäre nichts geschehen: „Es wird Zeit, dass wir zurückkehren und nach dem Rechten sehen!“
Schweigend machten sie sich auf den Rückweg in das furchtbare Chaos. Akandra trug einen zerfetzten, mit Dreck und Blut beschmierten weißen Rock und einen langen dunklen Umhang. Sie war einen Kopf kleiner als Marc, hatte einen energischen Mund und eine zierliche Figur. Sie wirkte so zerbrechlich, dass der junge Erit an sich halten musste, um nicht beschützend den Arm um sie zu legen.
Die junge Gräfin steuerte wortlos auf Waldlust zu. Es war der Sommersitz ihrer Familie gewesen. Graf Marrham hatte dort vom Regieren ausgeruht und seine Bücher geschrieben. In Waldlust hatten sie alle glückliche Tage und Wochen verbracht. Hier mussten sie nicht repräsentieren, waren privat und unbeobachtet gewesen. Auch dieses Anwesen mit all seinen Anbauten war verwüstet, geplündert und gebrandschatzt worden. Doch der traurige Anblick hielt Akandra nicht zurück. Sie eilte rasch auf das Haus zu und ließ Marc zurück. Als er sie in der großen Eingangshalle eingeholt hatte, blieb er versteinert stehen. Vor ihnen auf dem Boden lag Akandras Mutter, die Gräfin. Sie hatte sich Waldlust, diesen Platz der Heiterkeit und des Frohsinns, als Fluchtort ausgesucht, und Waldlust war ihr zum Verhängnis geworden. Ihre zerrissenen Kleider waren überall verstreut. Sie selbst lag verstümmelt in ihrem Blut.
Marc versuchte, Akandra sanft aus dem Haus zu ziehen. Aber sie riss sich von ihm los, lief zu der Leiche und fiel vor ihrer toten Mutter auf die Knie. Dort stammelte sie immer und immer wieder: „Meine schöne Mutter, meine schöne Mutter, was haben sie dir angetan!“
Dabei streichelte sie das blutverkrustete Haar der Gräfin. Endlich stand die Grafentochter auf, und ihr Gesicht war hart.
„Ich werde alles tun, um sie zu rächen“, sagte sie dumpf und entschieden.
Marc wusste, sie würde nicht ruhen, bis sie ihr Versprechen wahrgemacht hatte. Dann durchsuchte Akandra ruhig das verwüstete Haus und schnürte aus dem, was sie an Brauchbarem fand, ein Bündel. Marc wartete auf dem zertrampelten Rasen vor dem Eingang. Später kam das Mädchen heraus und legte die Habseligkeiten bei dem Jungen ab. Dann kehrte sie noch einmal zurück, und schlug mit einem Stein Feuer. Rasch waren die Vorhänge in der Halle in Brand gesetzt. Sie flammten sogleich lichterloh auf. Dann griff das Feuer auf die alten hölzernen Deckenbalken über. Eine Zeit lang standen die beiden jungen Leute vor dem einst so prächtigen Gebäude und sahen dem Brand zu. Schließlich wandten sie sich ab und verließen die Stätte des Grauens. Das Mädchen sah sich nicht einmal um.
„Wir können uns auf den Weg machen“, sagte sie, „hier gibt es nichts mehr zu tun."
Die hoch in den Himmel züngelnden Flammen beleuchteten ihren Weg.
„Wohin gehen wir eigentlich?" fragte Akandra.
„Wir müssen uns nach Heckendorf durchschlagen. Dort sind meine Familie und ein Freund, dessen Namen ich hier nicht nennen darf. Wir müssen alle warnen. Von Heckendorf aus können wir den Widerstand gegen diese Bestien organisieren."
„Und wie willst du dort hinkommen?" fragte sie spöttisch. „Alle Straßen und Brücken sind doch sicher bewacht."
„Da magst du Recht haben. Dennoch will ich es im Osten versuchen. Vielleicht haben wir Glück, und die Orokòr sind bereits abgezogen, weil sie hier kein lebendes Wesen mehr erwarten."
„Ich muss sagen, du hast mir einen bis in die kleinste Einzelheit durchdachten Plan unterbreitet. Wenn wir ihn befolgen, kann einfach nichts mehr schiefgehen." Das Mädchen sprach mit triefender Ironie.
„Hast du einen besseren Vorschlag?"
Wildes Geschrei unterbrach den Disput. Von Westen und Süden sahen sie Orokòr herbei stürmen. Die schwarzen Feinde hatten die Flammen des Hauses gesehen und rannten nun, um nach den Brandstiftern zu fahnden.
„Ein besseres Leuchtzeichen hätten wir nicht setzen können, um auf uns aufmerksam zu machen."
Aber Akandra sagte nur: „Dieses Begräbnis war ich meiner Mutter schuldig."
„Und wohin sollen wir uns nun wenden? Bisher hatten wir wenigstens eine kleine Hoffnung, nun sehe ich keine Chance mehr für uns zu entkommen."
Sie hatte sich bereits wortlos umgewandt und rannte ohne auf ihn zu warten nach Süden. Es war klar, sie wollte zurück in den Wilden Wald. Doch die Orokòr hatten sie inzwischen gesehen und jagten ihnen mit Geheul nach. Orokòr sind ausdauernde und schnelle Läufer, und der Vorsprung, den das Mädchen und der Junge hatten, verringerte sich rasch. Marc hatte das Gefühl seine Lungen würden gleich platzen, aber das Stakkato der eisenbeschlagenen Stiefel hinter ihm spornte ihn an, das Letzte aus seinem Körper herauszuholen. Er lief nun auf gleicher Höhe mit Akandra und sah, wie sie taumelte. Sie war am Ende ihrer Kräfte, und der Wald war noch vierzig Fuß entfernt. Mit festem Griff fasste er sie unter dem Oberarm und zog sie mit sich. Auch die Orokòr hatten gesehen, dass ihre Opfer am Zusammenbrechen waren, und stießen triumphierende Schreie aus. Nun waren es noch zwanzig Fuß bis zu den Bäumen, und die Verfolger hatten sie beinahe eingeholt.
„Ich kann nicht mehr“, stöhnte das Mädchen.
„Du musst! Denk an deine Mutter!"
Die Angst gab ihnen einen letzten Antrieb. Sie stürmten durch Büsche und Bäume. Im Wald war es kühl und so dunkel, dass sie nicht einmal die Hand vor den Augen sehen konnten. Noch immer stützte Marc das Mädchen. Akandra warf sich plötzlich auf den Boden und blieb keuchend liegen. Auch der Junge sank auf die Knie und schnappte nach Luft. Ihm war schwindlig, und er hatte entsetzliches Seitenstechen. Doch sie konnten sich keine Ruhe gönnen, denn sie hörten die Orokòr lärmend näherkommen. Diesmal hielt sie die Angst vor dem Zauberwald nicht zurück. Der Jagdtrieb ließ die schwarzen Gestalten alle Vorsicht vergessen. Sie brachen Äste von den Bäumen und steckten sie in Brand. Im Nu war die ganze Lichtung hell erleuchtet. Die Erits rafften sich auf und schleppten sich weiter.
„Der Wald mag Feuer nicht“, raunte Akandra. „Ich hoffe, den Orokòr wird das Fürchten beigebracht."
„Was können Bäume diesen schwer bewaffneten und gepanzerten Schurken schon anhaben?"
„Der Wald ist mächtiger, als du dir vorstellen kannst."
Sie zwängten sich vorsichtig und so lautlos wie möglich durch das Unterholz. Dabei achteten sie nicht auf die Richtung, sondern flohen vor dem Licht und dem Lärm. Noch immer hörten sie die Verfolger, die rücksichtslos Sträucher und kleine Bäumchen nieder trampelten. Ihre Fackeln entfachten da und dort kleine Brände. Bald würden sie die Erits einholen. Diese verbargen sich hinter zwei mächtigen Bäumen. An eine weitere Flucht war nicht zu denken. Es blieb ihnen nur noch die Hoffnung, dass die Orokòr an ihnen vorbei stürmen würden, ohne sie zu bemerken. Da hörten sie einen Ruf aus rauer Kehle, der alle Hoffnungen zerstörte: „Hierher, ich kann sie riechen!"
„Mutter, hilf!" flüsterte Akandra, und Marc stöhnte laut auf.
In diesem Augenblick begann ein dumpfes Dröhnen. Der Boden unter ihren Füßen vibrierte. Die Bäume bogen sich schwingend hin und her. Über das Brummen und Dröhnen erhob sich nun ein schrilles Pfeifen. Die Erits umarmten sich in Panik, ihr Herz schlug ihnen bis zum Hals. Auch die Orokòr wurden von Furcht gepackt und heulten und schrien wild durcheinander. Einige ließen ihre Fackeln fallen, und das dürre Laub des Bodens entzündete sich. Das Vibrieren wurde noch stärker, und das Brummen und Dröhnen war nun so durchdringend, dass alle das Gefühl hatten, der Kopf müsse ihnen bersten.
Neben Marc war ein riesiger Orokòr aufgetaucht. Er hatte die Augen weit aufgerissen und die Arme erhoben. Gerade als er mit seinen Klauen zuschlagen wollte, stürzte ein mächtiger Ast von einem Baum und erschlug den schwarzen Angreifer. Nun brachen von vielen Bäumen Äste, und jeder Ast traf einen Orokòr. Sie klagten und wimmerten. Plötzlich erwachten auch die Schlingpflanzen, die überall herum hingen, zu eigenem Leben. Sie schlängelten sich von den Bäumen und vom Boden, sie umklammerten hier einen Fuß in groben Lederstiefeln und dort einen Hals und zogen sich mit unwiderstehlicher Gewalt zusammen. Die erdrosselten Orokòr konnten nicht mehr schreien. Sie stöhnten dumpf und brachen dann zusammen.
Noch immer nahm das Brummen und Dröhnen zu. Die Fackeln der nachströmenden Orokòr entfachten mehr und mehr Brände. Es war zu spüren, dass der Wald immer wütender wurde. Holzstücke durchbohrten die Orokòr trotz ihrer Rüstung. Schwarzes Blut spritzte auf Laub und Stämme. Doch das Grausamste kam zuletzt. Kleine unscheinbare Dornen schossen als Pfeile durch die Luft. Sie bohrten sich in Gesichter, in das nackte Fleisch der Arme und die Hälse. Die Dornen taten nicht besonders weh, aber sie hatten eine furchtbare Wirkung. Sie waren vergiftet, und wer von ihnen getroffen wurde, konnte sich von diesem Moment an nicht mehr rühren. Er erstarrte bei vollem Bewusstsein.
Bald war von den Orokòr kein Ton mehr zu hören. Auch die Brände erloschen einer nach dem anderen. Dann war es wieder ganz dunkel und still im Wald. Akandra und Marc sanken zu Boden, unfähig einen Gedanken zu fassen, unfähig etwas zu sagen, noch immer von dem furchtbaren Grauen ergriffen. Beide schluchzten und klammerten sich aneinander. So fielen sie in den Schlaf und erwachten erst, als der neue Tag schon weit fortgeschritten war.
Verwundert blickten sie sich um. Die Ereignisse der Nacht erschienen ihnen im hellen Licht des Tages wie ein böser Traum. Als sie aber die alten Bäume drohend über sich aufragen sahen, schlich sich wieder Furcht in ihre Herzen. Vorsichtig richteten sie sich auf und gewahrten sogleich die erstarrten Orokòr. Mit einem Aufschrei rannten sie los und wagten es nicht sich umzusehen. Blindlings stürmten sie durch die Büsche, bis sie zerkratzt, erschöpft und außer Atem gemeinsam wieder zu Boden sanken. Mühsam bezähmten sie ihre Angst.
„Wo sind wir?" flüsterte Marc.
„Ich weiß es nicht."
„Ob die Orokòr wohl noch hinter uns her sind?"
„Ich glaube, sie sind alle tot."
„Das war eine furchtbare Nacht."
Akandra nickte.
„Wie kommen wir nur wieder aus diesem Wald heraus. Weißt du, wo wir sind?"
Akandra schüttelte den Kopf.
„Du bist nicht sehr gesprächig."
Akandra nickte.
„Aber was sollen wir tun? Wir können hier doch nicht ewig sitzen bleiben."
Akandra zuckte mit den Schultern. Nun war es Marc leid.
„Akandra“, sagte er wütend. „Du sitzt genauso in der Tinte wie ich. Ich nehme nicht an, dass du hier in diesem grauenhaften Wald deinen Lebensabend verbringen willst. Oder verlangst du etwa von mir, dass ich ein paar Bäume fälle und dir eine Hütte baue?"
„Pst“, flüsterte sie erschreckt. „Sag’ so etwas nicht an diesem Ort, nicht einmal im Spaß. Der Wald hört alles, und er kann sehr wütend werden, wie du gestern selbst erlebt hast."
„So erzähl mir doch endlich etwas über diesen seltsamen Wald. Du musst doch etwas über ihn wissen."
Akandra lehnte sich vorsichtig gegen einen Stamm und schloss versonnen die Augen.
„Der Wilde Wald“, begann sie, „existierte schon als die Erde noch ganz jung war. Geschöpfe haben ihn gepflanzt, deren Namen längst vergessen sind. Zuerst waren die Bäume noch unbeholfen und offen. Sie liebten alle Lebewesen und sie ließen sich hegen. Die Tiere des Waldes durften an ihren Trieben nagen, und die Menschen und Achajer sogar hie und da einen Stamm fällen. Aber die Bäume erlebten auch mit Schrecken und Verachtung die Kriege, auf die sich die Menschen später einließen. Sie sahen, dass alle zweibeinigen Lebewesen, wenn es um ihren Vorteil geht, brutal und grausam sind."
„Einige“, warf Marc ein. „Einige, doch nicht alle!"
„Das weiß ich besser und habe deshalb eine andere Meinung als du. Aber lassen wir das! Während sich die Bäume anderer Wälder durch die Zeiten domestizieren ließen, wurde der Wilde Wald durch die Äonen immer mächtiger und weiser, aber auch tückischer. Die Bäume wollten von all den Geschöpfen, die auf dieser Erde leben, nichts mehr wissen. Sie kapselten sich ab und wehe, wenn sich seit dieser Zeit jemand zwischen ihre Stämme verirrt. Nur wenige haben bisher den Wald lebend wieder verlassen. Ich glaube, der Wilde Wald verachtet uns alle."
„Du meinst, die Bäume sind seit Menschengedenken ganz allein unter sich. Keine Tiere, keine Menschen durchstreifen diesen Forst?"
„Du hast Recht. Niemand wird hier geduldet außer Vögeln und..."
„Und...?"
„Und ROM."
„ROM?"
„Nun eben ROM."
„So lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!"
„Ich sollte hier im Wald nicht so viel reden. Unser Aufenthalt ist schon gefährlich genug. Ich habe dir doch gesagt, hier haben die Bäume Ohren."
„Ich will es aber jetzt wissen. Wer oder was ist ROM? Vielleicht kann er uns helfen?"
„Nun gut, damit du Ruhe gibst, erzähl ich dir ein wenig. Viel weiß ich nicht. Also, ROM war schon immer da. So lange Lebewesen sich erinnern können, gibt es ROM. ROM ist der Herr der Wälder. Ihm gehorcht der Wald, und von ihm wird der Wald gehütet und gepflegt. ROM ist unbegreiflich mächtig. Er könnte uns natürlich mit Leichtigkeit helfen. Wenn er wollte, hätten alle Orokòr dieser Welt ausgespielt. Aber er hat ebenso wie sein Wald das Interesse an den Menschen, den Orokòr und sogar an den Achajern verloren."
„Wir müssen diesen seltsamen ROM für uns gewinnen“, sagte Marc rasch und eifrig.
„Wenn das nur so einfach wäre! Er zeigt sich keinen Zweibeinern, und wenn er neben dir stünde, so würdest du ihn nicht bemerken."
„Dann ist dieser ROM also eiskalt und gefühllos?"
„Still! Sage so etwas nie wieder“, Akandra war erschrocken.
„Aber mein Urteil ist doch nicht falsch, wenn er all dem Leid auf der Welt zusieht, obgleich er helfen könnte! Wenn er uns hier in diesem Wald umkommen lässt! Wenn er zulässt, dass das ganze Heimland vernichtet wird!"
„ROM ist sicher nicht gefühllos. Er ist uns nur so fremd. Er ist mit nichts vergleichbar, was wir kennen. Mein Vater sagte immer: ROM ist der ganz Andere."
Da dröhnte der Wald von einem tiefen, durchdringenden Lachen. Das Lachen wechselte ständig seine Richtung. Mal kam es von rechts, dann wieder von links und dann wieder von einer anderen Seite. Die Erits drehten sich verwirrt und verschreckt um sich selbst und versuchten, die Quelle dieses Lachens zu entdecken. Aber es war nichts zu sehen außer Bäumen, Sträuchern und ein paar Fliegenpilzen. Endlich, es war ihnen schon ganz schwindlig, tippte ihnen jemand von hinten auf die Schulter. Sie fuhren beide gleichzeitig herum, und da stand vor ihnen ein Mensch, nicht groß aber sehr stämmig. Auf dem Kopf trug er einen Schmuck aus Federn, um die Schultern hatte er einen blauen Mantel gelegt, und seine Füße steckten in alten Stiefeln. Das Gesicht war umrahmt von einem langen, braunen Bart und zerknittert von hundert Lachfalten.
„Wer bist du?" stammelte Marc.
„Ich bin der, von dem ihr die ganze Zeit geredet habt“, lachte die Gestalt. „Es ist wirklich interessant, was ihr über mich zu sagen wisst."
Marc sich nicht mehr zurückhalten. Er platzte heraus: „Wenn du so mächtig bist, wie Akandra sagt, dann musst du uns helfen!"
„Euch helfen?" ROMs Stimme klang verwundert.
„Ja, das Heimland ist in Gefahr. Orokòr haben uns überfallen, und sie haben alle Erits in Waldmar bestialisch umgebracht. Und sogar den Hof von Bauer Sturm haben sie überfallen und alle getötet. Es muss sofort etwas geschehen, sonst sind alle Erits verloren."
„Ja“, sagte ROM ernst, „ich habe gesehen, was geschehen ist. Es war furchtbar. Ihr tut mir leid."
„Von deinem Mitleid haben wir nichts“, entgegnete Marc erbittert, „was wir brauchen, das ist Hilfe."
„Damit kann ich euch leider nicht dienen. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen könnte. Doch nun lasst uns von etwas Anderem reden. Der Tag ist so schön, und das Laub der Bäume so grün."
ROM lachte wieder, und sein Lachen übertönte sogar das Zwitschern in den Ästen.
„Mein Gott, bist du gefühllos“, sagte Marc erbittert. „Aber so kommst du mir nicht davon. Eine alte Weisheit sagt, wer nicht hilft, obgleich er könnte, macht sich genauso schuldig wie der Täter."
ROM lachte noch immer. „Das ist nicht nett, was du mir sagst. Ich weiß wirklich nicht, was ich für euch tun könnte. Ihr überschätzt mich! Meine Macht ist begrenzt. Ich habe überhaupt keine Macht, um die Welt zu verändern. Auf der Erde geschieht nämlich nichts, was nicht geschehen soll. Selbst wenn ein Schmetterling stirbt, so gehört dies zum großen Plan. Wie könnte ich da so vermessen sein und eingreifen wollen?"
„ROM, der Fatalist und sein Wald“, warf Marc spöttisch ein. „Leider haben wir Erits keinen Wald, in dem wir uns verkriechen können."
„Weil ihr euren Wald verbraucht habt. Weil ihr jeden Wald, der euch auf Dauer schützen könnte, vernichtet. Weil ihr immer nur von dem augenblicklichen Nutzen ausgeht und nicht an die Zukunft denkt. Wenn dann die Not groß ist, lamentiert ihr und fordert von den Leuten, die sich ihren Wald bewahrt haben, Hilfe.
Nein, ich bin kein Fatalist. Aber ich verstehe mehr von dieser Welt als du, denn ich habe mehr gesehen und erlebt, als du dir vorstellen kannst. Du kannst mir glauben, ich war vor langer Zeit ebenso töricht wie du. Ich wollte die Welt verändern und gestalten. Aber ich habe bald eingesehen, dass dies eitle Versuche waren, weil der große Plan dennoch seinen Lauf nahm."
„Dass man etwas tut, statt nichts zu tun, das ist nicht Eitelkeit, heißt es in einem alten Gedicht. Sicher, wir sind dumm, wir sind sterblich, wir sind schwach. Aber wir tun wenigstens etwas gegen das Böse in der Welt, gegen die Gemeinheiten. Auch wenn es vergeblich ist, und wir in diesem Kampf immer verlieren werden. Doch unser fruchtloses Mühen ist auf jeden Fall besser als dein albernes Lachen. Ich kann deine Ausflüchte nicht mehr hören."
„Marc sei still! So kannst du nicht mit Meister ROM reden!" mischte sich Akandra ein. Und zu ROM gewandt: "Bitte nehmt es ihm nicht übel. Er weiß nicht was er sagt. Er meint es nicht so. Er ist nur sehr verzweifelt."
„Ich weiß genau, was ich sage." In Marcs Stimme lag Trotz.
ROM lachte noch immer. „Ich nehme es ihm nicht übel. Dein Freund gefällt mir. Es macht Spaß mit ihm zu streiten." Dann wandte er sich wieder an den jungen Erit. „Nehmen wir an, ich wäre so mächtig, wie du sagst. Wenn ich in das Geschehen dieser Erde eingriffe, wenn ich Streitereien schlichten, Kämpfe verhindern und schlimme Herrscher absetzen würde. Was glaubst du, würde sich ändern? Die Welt würde um keinen Deut besser. Mit einem einmaligen Eingreifen wäre es doch nicht getan. Ich müsste immer wieder aufs Neue, ja ich müsste täglich, stündlich meine Kraft anwenden und ordnen und schlichten. Da, wo ich es nicht täte, würde man mich verfluchen und mir die Schuld am Elend geben. Irgendwann würde ich ganz allein die ganze Welt lenken. Ich wäre der Herr der Welt. Wie könnte ich so größenwahnsinnig sein wollen! Im Übrigen wäre ich ein schlechter Herrscher, denn das Recht ist nur selten eindeutig auf einer Seite. Wenn zwei Parteien sich gegenseitig bis aufs Blut bekämpfen und tyrannisieren, glaubt doch jede fest, im Recht zu sein und sich nur gegen die Gemeinheiten der anderen zu wehren. Wie könnte ich Schiedsrichter spielen und für eine Gruppe Partei ergreifen?"
„Deshalb lässt du also die Orokòr gewähren? Mit dieser fadenscheinigen Begründung siehst du dem Unheil ruhig zu?"
„Nein, ich sehe nicht ruhig zu, aber gelassen. ‚Mitleidend bleibt das ewige Herz doch fest', steht in einem alten Buch geschrieben. Doch nun haben wir genug disputiert. Es ist inzwischen Mittag geworden, und es wird Zeit, dass wir gemeinsam etwas essen."
Lachend und singend nahm er einen großen ledernen Beutel von der Schulter, setzte ihn auf den Boden und schnürte ihn auf. Dann packte er Köstlichkeiten aus, wie Ziegenkäse, Brot, Salz, Butter und Quark mit frischen Kräutern. Dies alles breitete er auf einer bunten, wollenen Decke aus und lud die jungen Leute zum Sitzen ein. Die bemerkten erst jetzt, wie hungrig sie waren. Beide hatten sie seit langem nichts mehr gegessen. Sie machten sich mit Appetit über all die guten Sachen her und auch ROM hielt kräftig mit.
Endlich waren sie gesättigt, lagen faul auf dem Rücken und blinzelten in die Sonne. Es war schön, wie sie dalagen, und es war friedlich, so friedlich wie auf Gutruh in den guten Zeiten.
Vor Marcs geistigem Auge tauchte ein anderes Bild auf. Gutruh verbrannt, geschunden und besudelt. Seine Mutter und sein Vater tot. Schwarze Horden zertrampeln triumphierend den sorgfältig gepflegten Garten.
Er sprang auf und rief: „Wir haben kein Recht, hier zu liegen. Inzwischen kann das Verderben schon in Heckendorf angelangt sein. Wir müssen weiter. Wirst du uns nun helfen, ROM?"
Auch Akandra war aufgestanden. Nur der Hüter des Waldes lag noch im Moos.
„Fängst du schon wieder an?" fragte er schläfrig. „Noch ist in Heckendorf nichts geschehen, und es ist dort noch ein paar Tage sicher. Ich habe dir schon gesagt, dass ich euch nicht helfen kann. Was glaubt ihr, wie viel Leid und Schmerz ich all die Jahrhunderte und Jahrtausende miterleben musste, ohne dass ich eingreifen oder etwas verhindern hätte können? Glaubt ihr, das ist spurlos an mir vorübergegangen? Ich habe keine Tränen mehr und ich habe gelernt alles neu zu sehen. Seit ich verstehe, kann ich damit leben. Und ich weiß, irgendwann werdet auch ihr verstehen. Doch in einem hast du recht, Marc, ihr müsst jetzt aufbrechen."
Er richtete sich auf und war mit einem Sprung auf den Beinen.
„Geht in diese Richtung. Ihr werdet nach einer knappen Wegstunde auf ein Tor stoßen. Dort habt ihr die Wahl. Ihr könnt durch das Tor treten. Damit setzt ihr euch großen Gefahren aus, aber ihr gewinnt vielleicht Hilfe für euren Kampf. Oder ihr geht rechts am Tor vorbei. Ihr findet einen Pfad, der euch über kurz oder lang zur Oststraße führen wird. Bevor ihr euch aber für das Tor entscheidet, bedenkt, ihr werdet es vielleicht nicht überleben."
Die jungen Leute sahen sich überrascht an, und bevor sie sich versahen, hatte ROM alles zusammengepackt und war lachend und singend verschwunden. Sie hatten nicht einmal Zeit gehabt sich zu verabschieden. Dort aber, wo er hingedeutet hatte, sahen sie einen schmalen Weg zwischen den Bäumen, dem sie sogleich folgten.
Nach einer Weile fragte das Mädchen vorwurfsvoll: „Warum hast du so mit ROM geredet?"
„Warum hast du mich nicht unterstützt, als ich ihn bewegen wollte, uns zu helfen?" entgegnete der Junge mit dem gleichen Tadel in der Stimme. „Wir sind in einer Lage, die es uns nicht erlaubt, höflich zu sein. Gerade du müsstest dies doch am besten wissen, nach allem, was du mitgemacht hast. Der Verzweifelte ist von der Pflicht befreit, nett zu sein."
Akandra antwortete nicht, und als Marc aus den Augenwinkeln zu ihr hinüberblickte, liefen ihr Tränen über das Gesicht. Doch sie hatte sich rasch wieder gefangen.
Mit fester Stimme erklärte sie: „Meine Eltern haben mir beigebracht, Haltung zu bewahren und auch in schlimmen Situationen die Regeln der Höflichkeit zu beachten. ROM gebührt Ehrfurcht. Wenn er sich uns verweigert, so hat er seine guten Gründe. Seine Einsicht geht weiter als unser Begriffsvermögen. Dies hat mich mein Vater gelehrt, und ich bin auf keinen Fall bereit, meine gute Erziehung über Bord zu werfen."
Nach einer Weile fügte sie noch abfällig hinzu: „Selbstdisziplin ist die Grundlage eines jeden Sieges. Aber dies wirst du bei deiner Erziehung nie verstehen. Es gibt eben so mancherlei Unterschied zwischen uns."
Marc wusste darauf nichts zu erwidern und schwieg. Aber er ärgerte sich, dass ihm nichts eingefallen war, womit er dieser Arroganz hätte begegnen können.
Sie waren auf dem bequemen Weg rasch vorwärtsgekommen. Bald erreichten sie eine kleine Lichtung, die von riesigen Bäumen gesäumt war. Die Bäume sahen hier besonders alt und hoch aus. In der Mitte der Lichtung glitzerte im grellen Schein der Nachmittagssonne ein bronzenes Tor. Es war flankiert von zwei runden Säulen mit blumengeschmückten Kapitellen. Um die Säulen rankte sich Efeu. Dieses künstliche Bauwerk, das vor langen Zeiten von geheimnisvollen Wesen geschaffen worden war, nahm sich in diesem Urwald seltsam aus. Es war hier zwischen den Bäumen, den Blumen und dem Gras ein Fremdkörper. Das gehämmerte Metall der Torflügel glänzte noch immer, und man sah, dass die Erbauer große Baumeister gewesen waren.
Vorsichtig und staunend gingen die Erits um das seltsame Tor herum. Das Bauwerk bestand aus großen, rechteckig behauenen Steinen, die ohne Mörtel aufeinander ruhten. Sie waren so vollkommen bearbeitet, dass man in ihre Fugen nicht ein Haar hätte schieben können. Wie ROM versprochen hatte, setzte sich der Pfad auf der anderen Seite der Lichtung in Richtung Oststraße fort.
„Was sollen wir tun?" fragte Marc. „Du erinnerst dich sicher an die Warnung von ROM."
„Was wir tun, weiß ich nicht“, antwortete sie ohne eine Sekunde zu zögern. „Ich kann nur für mich selbst sprechen. Ich werde das Tor durchschreiten. Wenn es eine Möglichkeit gibt, die Orokòr zu vernichten, und sei sie noch so gering und noch so gefahrvoll, so werde ich sie nutzen. Das bin ich meiner Mutter schuldig."
„Aber vielleicht ist es besser, die Leute in Heckendorf zu warnen. Wenn uns hier etwas zustößt, wird sie niemand auf das drohende Unheil hinweisen. Dürfen wir uns unter diesen Umständen in Gefahr begeben?"
„Was sollen deine Warnungen nützen?" sagte Akandra abfällig. „Glaubst du denn wirklich, dass sich Erits der rohen Gewalt der Orokòr widersetzen können? Den Heimländern bleibt als einzige Zukunft, sich in den großen Strom der Flüchtlinge einzureihen und heimatlos, gehasst und verachtet von Stadt zu Stadt und von Land zu Land zu ziehen. So lange bis ganz Centratur unterjocht ist, und die dunkle Macht sie dort, wo sie sich dann gerade aufhalten, eingeholt hat. Nein danke, da ziehe ich den Untergang vor! Gegenüber diesem Schicksal haben die Waldmarer beinahe noch Glück gehabt."
Ihre Worte waren hart und bitter, und sie wandte sich ab, ohne auf eine Antwort von Marc zu warten. Sie ging auf das Tor zu und rüttelte an ihm. Vielleicht war es verschlossen, verklemmt, vielleicht waren seine Angeln auch im Lauf der Jahre eingerostet, es bewegte sich nicht einen Zoll. Zögernd kam ihr Marc zu Hilfe. Doch auch zu zweit hatten sie keinen Erfolg. Sie drückten und zogen vergeblich mit aller Kraft, die sie aufbringen konnten. Schließlich sanken sie erschöpft zu Boden.
Die Treppe
Die Niederlage ließ Marc keine Ruhe. Nach kurzer Verschnaufpause erhob er sich und begann zwischen den Bäumen nach einem Werkzeug zu suchen. Mit einem großen Holzprügel kam er zurück. So fest er konnte, schlug er damit gegen das Tor. Wie Glockenschläge hallte es dumpf über die Lichtung. Aber alle Anstrengungen waren fruchtlos. Es zeigte sich nicht einmal ein Kratzer in dem Metall. Nur die geduldige Natur hatte im Lauf der Jahrtausende den Schimmer ein wenig zu trüben vermocht.
„Was können wir noch tun?" klagte der junge Mann, als er endlich kraftlos den Stock fallen ließ.
„Ich habe in alten Büchern von geheimnisvollen Türen gelesen. Jede hat einen anderen Öffnungsmechanismus, reagiert auf ein anderes Zauberwort. Keine gleicht der anderen." Akandras Stimme klang resigniert.
„Willst du damit sagen, dass wir die Tür nicht aus eigener Kraft aufbekommen?"
„Wenn der Zufall uns nicht zu Hilfe kommt, sind alle unsere Anstrengungen umsonst."
„Aber ROM hat doch gesagt, wir würden den Eingang finden. Sollen wir ihn vielleicht rufen?"
„Auf keinen Fall werden wir noch einmal ROM belästigen. Wenn er uns helfen will, kommt er von selbst, wenn er nicht kommt, hat dies seine Gründe."
„Wenn es um ROM geht, zeigst du eine seltsame Nachsicht, die ich nicht verstehe."
„Du verstehst vieles nicht, Marc. Ich habe dir schon einmal gesagt, dass dies wohl an deiner Erziehung liegt. Ich weiß nicht, ob sich das jemals ändern wird, ob sich irgendwann dein Horizont erweitert. Bisher ist dieser Zeitpunkt jedenfalls nicht abzusehen."
„Ach, spiel dich doch nicht so auf. Dein blasiertes Gerede macht mich schon seit Jahren wütend."
„Und warum bist du dann immer wieder nach Waldmar gekommen, um dir mein Gerede anzuhören? Warum hast du mich und meine Familie Jahr für Jahr belästigt?"
„Weil ich kommen musste. Dein Vater, als mein Pate, hat darauf bestanden. Ja, glaubst du denn, es hat mir Spaß gemacht, mich von euch allen als einen Menschen zweiter Klasse behandeln zu lassen und mir die blöden Ratschläge von deinem Vater anzuhören?"
„Meinen Vater lasse ich nicht beleidigen“, herrschte ihn Akandra an, „und schon gar nicht von so einem Tölpel wie dir. Du hast nicht einmal das Recht, ihm die Hand zu geben. Schließlich hat er das Heimland und sogar Centratur gerettet."
„Vielleicht geholfen, aber nicht gerettet! Du vergisst meinen Vater! Weißt du überhaupt, was mein Vater getan hat? Was glaubst du, hätten alle Bemühungen deines Vaters genutzt, wenn mein Vater nicht ins Lager von Ormor gezogen wäre? Ohne meinen Vater wäre dein Vater nicht einmal Graf geworden."
Akandra sprang auf, lief empört zu Marc und schlug ihm mit aller Kraft ins Gesicht. Blut spritzte aus seiner Nase, und dieses Blut brachte sie wieder zu sich.
„Es tut mir leid“, sagte das Mädchen einlenkend. „Es bringt uns nicht weiter, wenn wir uns streiten. Mit Hader öffnen wir dieses Tor nicht und wir retten auch nicht die Heimländer."
Sie setzten sich wieder ins Gras, und Marc tupfte das Blut ab.
„Sieh mal, wie schön das Tor in der Nachmittagssonne glänzt“, sagte Akandra. „Man muss es einfach anfassen."
Sie ging hinüber und strich vorsichtig mit den Handflächen über das glatte Metall. Dann legte sie, einer plötzlichen Eingebung folgend, ihre Wange dagegen und küsste die Tür. Erschreckt sprang sie zurück, als die Flügel daraufhin lautlos nach innen schwangen und eine schwarze Höhlung freigaben. Auf ihren Schrei hin eilte Marc herbei. Gemeinsam starrten sie ins Dunkel. Im schwächer werdenden Licht des Tages konnten sie Treppenstufen sehen, die in undurchdringliche Finsternis führten.
„Sollen wir etwa da hinein?" fragte der Junge bestürzt.
Das Mädchen nickte schwach und mit bleichem Gesicht.
„Aber wir sehen doch nichts. Wir haben keine Lampen und keine Kerzen. Wer weiß, was da drinnen auf uns lauert!"
„Verdammt noch mal“, sagte sie mit verzweifeltem Zorn, „die ganze Zeit redest du davon, dass wir etwas zur Rettung des Heimlands unternehmen müssen. Du beleidigst sogar ROM. Und nun willst du kneifen? Aber du kannst draußen bleiben. Ich werde ohne dich hinuntersteigen."
Als Marc unschlüssig stehen blieb und sich nicht bewegte, schrie sie ihn an: „So geh doch endlich! Ich kann dich nicht mehr sehen. Verschwinde! Mach dich aus dem Staub! Lass mich allein! Ich muss mich schließlich vorbereiten."
„Was willst du denn vorbereiten?"
„Was weiß ich! Fackeln sammeln und so..."
„Glaubst du nicht, es wäre besser, wir würden zusammenhalten, als uns ständig zu streiten?"
Sie antwortete nicht, aber beide gingen sie und suchten nach Holz. Dann untersuchte Marc seinen Rucksack. Er fand noch einen Kanten Brot und ein paar weiche, zerdrückte Äpfel. Zuunterst entdeckte er sein Messer, das er nun befriedigt in den Gürtel steckte. Akandra hatte ihre Habseligkeiten, die sie aus Waldlust gerettet hatte, bei der Flucht vor den Orokòr weggeworfen. Sie besaß nichts mehr, außer dem, was sie auf dem Leib trug.
„Für eine schwierige und gefährliche Expedition sind wir nicht gerade gut ausgerüstet“, spottete der junge Erit. „Aber was soll's? Was uns fehlt, machen wir mit Unbekümmertheit, Missachtung der Gefahren und gutem Willen wett. Damit müsste es gehen. Komm jetzt! Es dunkelt schon. Wenn wir noch länger warten, können wir keinen Unterschied mehr zwischen drinnen und draußen erkennen. Zögern verbessert unsere Lage auch nicht."
Sie sah ihn erstaunt an und fragte verwundert: „Du kommst also mit?"
„Was dachtest du denn? Ich hatte nie vor, dich allein zu lassen. Aber man darf doch noch an die Gefahr erinnern, in die man sich begibt."
Akandra kniff den Mund zu einem schmalen Spalt zusammen, aber man sah ihr an, dass sie sehr erleichtert war.
Beiden schlug das Herz bis zum Hals, als sie sich an der Hand nahmen und gemeinsam in die furchtbare Dunkelheit schritten. Die Stufen waren aus Stein, drei Hand breit und eine Hand hoch. Vorsichtig mit den Füßen tastend stiegen die jungen Leute Stufe für Stufe nach unten. Noch verband sie der matte Lichtschein, der durch das Tor fiel, mit der Welt, die sie soeben verlassen hatten. Doch ganz plötzlich, ohne ersichtlichen Grund, schwangen die beiden Türflügel lautlos zu. Nun erleuchtete nicht einmal mehr ein Lichtschimmer ihren Weg. Tiefste Dunkelheit umgab die Eindringlinge.
Hastig riss Marc Feuerstein und Zunder aus seiner Hosentasche und schlug Funken. Bald brannte einer der Äste, die sie mitgebracht hatten. Die Treppe hatte sich nach beiden Seiten erweitert, so dass sie ihre Begrenzung links und rechts nicht mehr sehen konnten. Als das Holz beinahe verbrannt war, warf es der Junge, soweit er konnte von sich. Die Fackel flog tiefer und tiefer, bis sie irgendwann weit unten erlosch.
„Die Treppe hört ja nie auf“, keuchte das Mädchen und setzte sich auf die Stufen. „Wenn wir hier ausgleiten und stürzten, fallen wir ins Bodenlose."
„Wir können nicht zurück, sondern müssen vorsichtig weitergehen. Es wird uns schon nichts passieren."
Er setzte sich neben sie und legte seinen Arm um ihre Schultern. Sie zitterte am ganzen Körper.
„Du brauchst keine Angst zu haben. Gemeinsam stehen wir das durch!"
Marc versuchte, tapfer zu sein und seine Angst nicht zu zeigen, um Akandra nicht noch mehr zu beunruhigen. Aber auch er zitterte, und seine Hände waren nass von Schweiß. Nach einer Weile machten sie sich wieder auf den Weg und waren nun noch vorsichtiger als bisher.
„Ich glaube, bei Licht könnte man diese Treppe gar nicht hinuntersteigen. Wenn man sie in ihrer vollen Länge sehen könnte, würde einem schwindelig, und man hätte viel zu viel Angst." Akandra hatte sich wieder in der Gewalt und übernahm die Führung.
Sie stiegen und stiegen. Bald begannen ihre Beine zu schmerzen. Marc bekam einen Wadenkrampf. Aufschreiend ließ er sich nieder. Eilig massierte Akandra die schmerzenden Muskeln, bis sich der Krampf gelöst hatte. Stöhnend lag ihr Begleiter quer auf den Stufen und versuchte sich zu entspannen. Das Mädchen barg sein Gesicht in stummer Verzweiflung in den Händen.
„Wie lange sind wir schon gestiegen? Ob es draußen wohl schon wieder Tag ist?"
„Bitte“, sagte sie, „zünde eine Fackel an. Ich muss unbedingt Licht haben."
„Du weißt, wir haben nur wenig Holz. Wir werden später noch Feuer brauchen."
Flehend bat sie: „Bitte!"
Da richtete er sich auf und entzündete einen der wenigen Äste. Der schwache Lichtschein erleuchtete ihre bleichen Gesichter. Die Treppenstufen aus Stein leuchteten matt, aber sie konnten weder oben, noch unten, noch an den Seiten ein Ende erkennen. Als die Flamme verglommen war, leuchtete sie noch eine Weile in ihren Augen nach. Der plötzliche Verlust des Lichtes war schlimmer als die Dunkelheit zuvor. Um die Freundin zu trösten kramte Marc in seinen spärlichen Vorräten, und sie aßen, langsam und genussvoll kauend, trockenes Brot.
Dann erhoben sie sich und stiegen weiter. Marcs Fuß war wieder in Ordnung. Sie hielten sich von nun an fest an der Hand. So gaben sie sich gegenseitig ein Gefühl der Sicherheit. Wenn einer stürzte, so würde ihn der andere halten. Sie nahmen eine Stufe nach der anderen, und auf jede Stufe folgte eine neue Stufe. Zu Beginn hatten sie noch versucht, sie zu zählen, aber bald aufgegeben. Sie sahen bei den seltenen Gelegenheiten, wenn sie sich Feuer gönnten, niemals die Decke dieses monumentalen Treppenhauses. Stattdessen spürten sie um sich herum eine ungeheure Weite, die ihnen das Gefühl des Ausgeliefertseins und der Hilflosigkeit gab. Gesprochen wurde wenig. Zum einen weil das Treppensteigen sehr anstrengend war, zum anderen weil jeder Laut hier unten einen seltsamen Klang hatte. In der Totenstille hallten ihre Worte nicht, sondern sie verloren sich einfach.
Einmal fragte Marc: „Wie bist du auf die Idee gekommen, das Tor zu küssen?"
„Ich weiß es nicht. Das Metall erschien mir auf einmal so schön, und die Berührung mit den Händen war so angenehm, dass ich es einfach tun musste."
„Die Erbauer dieser seltsamen Anlage haben sich mit dieser Geste etwas Treffliches ausgedacht. Ein Kuss öffnet schließlich auch die Herzen der Menschen. Und so haben sie beschlossen, dass er auch den Zugang zu ihrem Herzen öffnen solle. Was mag das nur für ein Herz sein?"
„Mit einem Kuss sind Leute aber auch schon verraten worden. Ein Kuss kann ein völlig falsches Signal setzen. Ich hoffe nur, dass unser Abenteuer gut endet. Je länger dieser Abstieg dauert, desto skeptischer werde ich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir hier je wieder herauskommen. Nicht nur, dass wir nicht wissen, wie das Tor von innen geöffnet werden kann. Ich bezweifle, dass wir in der Lage sind, all die Stufen wieder hinauf zu klettern. Wenn wir es versuchen, brechen wir unterwegs zusammen. Außerdem fehlt uns jeglicher Proviant, und auf eine Gaststätte werden wir hier wohl nicht stoßen. Wir sind in eine Falle getappt und werden dieses dunkle Loch nicht mehr lebend verlassen."
Marc wusste darauf nichts zu sagen, aber er drückte ihre Hand fester, und sie stiegen verbissen weiter. Immer häufiger wurden sie nun von Wadenkrämpfen überfallen und krümmten sich vor Schmerzen, obgleich sie in immer kürzeren Abständen Pausen einlegten. Ab und zu schliefen sie auch, wobei immer einer Wache hielt und aufpasste, dass der andere im Schlaf nicht die Treppe hinunterrollte. Dieses Wachen war furchtbar. In der Dunkelheit ging die Zeit nicht vorüber. Sie mussten sich mühsam wachhalten und kamen dabei immer wieder ins Grübeln. Ihre Lage erschien ihnen dann in einem so düsteren Licht, dass den Erits manchmal sogar die Tränen über das Gesicht liefen, und sie vor Verzweiflung schluchzten.
Zum Glück hatte ROM Marcs Wasserflasche mit einem stärkenden Trank aufgefüllt, so dass sie bisher keinen Durst zu leiden hatten. Aber obwohl sie die kostbare Flüssigkeit rationierten, ging sie bald zur Neige.
„Ich habe Durst“, stöhnte Marc.
„Wir werden hier jämmerlich umkommen“, klagte Akandra. „Es tut mir leid, dass ich dich in dieses Abenteuer gegen deinen Willen gezwungen habe."
„Du hast mich nicht gezwungen. Ich wäre sicher auch ohne dein Drängen hier eingestiegen. Wir hatten gar keine andere Wahl. Dem Heimland droht der Untergang, und wir hätten uns bis zu unserem Ende Vorwürfe gemacht, wenn wir dem Tor ausgewichen wären. Vielleicht, so hätten wir uns immer wieder gesagt, wäre dort Hilfe gewesen. Nein, wir mussten diesen Weg ins Dunkel wählen. Ich bin froh, dass wir es gemeinsam gemacht haben. Du warst bisher sehr tapfer, Akandra."
„Das warst du auch, Marc. Entschuldige, dass ich so überheblich war und ständig meine vornehme Abstammung herausgekehrt habe. Das war töricht und eitel von mir."
„Ach, ich habe es gar nicht so ernst genommen."
Dann kam der Augenblick, an dem ihre tastenden Füße keine neuen Stufen mehr fanden. Sie schienen, festen Boden erreicht zu haben. Glücklich fielen sich die beiden Erits in die Arme. Sogleich entzündete Marc einen der kostbaren Äste. Doch wie enttäuscht waren sie, als sie im flackernden Licht sahen, dass es nach zehn Schritten erneut in die Tiefe ging. Sie hatten lediglich einen Treppenabsatz erreicht.
Entmutigt sanken Marc und Akandra zu Boden und starrten apathisch ins Dunkel. Ein Geräusch ließ sie auffahren. War es schon immer da gewesen? Hatten sie bisher nur nicht darauf geachtet? Leise hörten sie etwas plätschern. Sie tasteten sich in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Zitternd steckte Marc einen der letzten Äste in Brand. Da sahen sie eine runde Vertiefung. Es war ein Wasserbecken, aus dem köstliches Nass als Fontäne sprühte.
„Ob man es trinken kann?" flüsterte Akandra und, ohne lange zu überlegen, schöpfte sie mit der hohlen Hand und kostete. Auch ihr Begleiter hielt sich nicht zurück. Beide löschten sie in tiefen Zügen ihren Durst. Es war kein gewöhnliches Wasser. Der Trank schmeckte süß und vertrieb den Hunger.
„Was ist, wenn der Brunnen vergiftet ist?" fragte er.
„Oder gar verzaubert“, fügte sie furchtsam hinzu.
„Ach, was soll's“, sagte Marc. „Wir haben keine andere Wahl. Entweder sterben wir durch das Wasser oder verdursten ohne das Wasser. Im Übrigen fühle ich mich schon viel wohler."
In der Tat strömte neue Kraft durch ihre gemarterten Körper. Sie füllten die Feldflasche bis zum Rand und setzten sich bequem und zufrieden auf den Boden. Schläfrig nickten sie ein. Keiner musste wachen, denn es bestand keine Gefahr, im Schlaf die Treppe hinunterzurollen. Seit langem schliefen sie wieder ohne Angst. Es wurde ein langer Schlaf, und sie erwachten frohgemut, naschten noch einmal aus der Quelle und machten sich dann gesättigt und ohne Durst auf den Weg. Die Müdigkeit, die bleischwer auf ihnen gelastet hatte, war wie weggeblasen. Energie und Hoffnung begleiteten sie auf dem weiteren Abstieg.
Aber schon nach einer Stunde kamen ihnen wieder Zweifel und Fragen. Welchem Zweck konnte eine derartige Treppe dienen? Wer waren die Erbauer? Wohin führte sie? Was erwartete sie an ihrem Ende? Gab es überhaupt ein Ende? Würden sie jemals wieder das Tageslicht sehen? Diese Stufen führten unter die Wurzeln der Gebirge, sie führten tiefer, als es sich lebende Wesen vorstellen konnten.
In endloser Gleichförmigkeit setzten sie Fuß vor Fuß und hielten sich an den Händen, die feucht und glitschig wurden. Immer schwieriger wurde es, den anderen festzuhalten. Die Kleider klebten ihnen am Leib. Schweiß lief ihnen über Gesicht und Arme.
Akandra sprach es zuerst aus: „Ich glaube, es wird wärmer."
„Ich habe auch das Gefühl."
„Was aber, wenn es so heiß wird, dass wir verbrennen?"
„Das glaube ich nicht. Die Erbauer dieser Treppe mussten schon zu ihrem eigenen Schutz Vorkehrungen gegen die Hitze getroffen haben."
Bald hielten sie es nicht mehr aus. Sie zogen sich nackt aus und stopften ihre Kleider in Marcs Rucksack.
„Nun bin ich doch recht froh, dass es dunkel ist“, kicherte das Mädchen.
„Ich kann es kaum erwarten, den nächsten Ast anzuzünden“, Marc nahm den Scherz auf.
Lachend stiegen sie weiter, bis die Stufen wiederum endeten. Sie hatten den nächsten Treppenabsatz erreicht. Sogleich suchten sie nach einem Brunnen. Tatsächlich, auch hier fanden sie ein Becken, aus dem köstliches Nass sprudelte. Sie labten sich und fielen bald darauf in einen tiefen Schlaf. Erfrischt und ohne Hast machten sie sich später wieder auf den Weg. Nach einigen Stunden weiteren Abstiegs begannen sie zu frösteln. Sie spürten einen kühlen Wind. Gänsehaut überzog ihre nackten Körper. Sie setzten sich und tasteten nach ihren Kleidern. Es war nicht einfach, sie in der Dunkelheit zu sortieren und überzustreifen.
„Nun habe ich doch vergessen, eine Fackel anzuzünden“, lachte Marc, als sie wieder angezogen waren.
„Wenn wir hier je wieder lebend herauskommen, werde ich für dich ganz nackt in der strahlenden Sonne tanzen“, entgegnete sie, und es war Ernst in ihrer Stimme.
„An dieses Versprechen werde ich dich erinnern. Jetzt habe ich einen guten Grund, mich wieder ans Tageslicht zu wünschen."
Sie waren beide in besserer Laune, und diese Stimmung hielt auch noch an, als sie den dritten Treppenabsatz erreichten. Hier war der Luftzug, den sie bisher nur schwach gespürt hatten, schon recht stark. Es schien, als ob zwei Türen offen standen. Der Wind wehte schräg über die Treppe.
„Es muss hier Öffnungen, wenn nicht sogar einen Ausgang geben!" rief Marc.
Beide liefen sie quer über die Treppe dem Wind entgegen. Akandra war schneller, und der Junge hörte ihre Schritte vor sich. Sie war nicht einzuholen.
Er rief: „Warte auf mich! Lass mich nicht zurück!"
Sie blieb stehen und tastete nach seiner Hand. Gemeinsam gingen sie weiter, bis ihre Füße gegen ein Hindernis stießen. Doch wie groß war ihre Enttäuschung, als sie feststellten, dass es eine neue Treppe war. Eine Treppe an der Seite, die nach oben führte. Von dort oben kam der Luftzug. Die ganze Anlage musste zumindest halbrund sein.
„Was sollen wir nun tun?" fragte Marc. „Weiter nach unten gehen oder hier nach oben steigen? Beides will mir nicht so recht gefallen."
„Ich glaube, unser Schicksal liegt unten und nicht oben. Die Worte von ROM gehen mir durch den Kopf. 'Ihr setzt euch großen Gefahren aus, aber ihr gewinnt vielleicht Hilfe', hat er gesagt. Im Übrigen, wenn wir jetzt einen Weg nach oben suchen würden, wäre alles, was wir bisher durchgemacht haben, umsonst gewesen."
„Du hast Recht. Noch sind wir der Rettung des Heimlands keinen Schritt nähergekommen. Wir haben eine Aufgabe, und wir werden zu ihr stehen!"
„Tapferer Marc!" sagte sie leise.
„Liebe, liebe Akandra!" antwortete er.
Wieder stiegen sie in tiefster Dunkelheit ungezählte Stufen nach unten. Ihre Füße tasteten sich inzwischen automatisch von Tritt zu Tritt. Ihre Muskeln hatten sich an die Bewegung gewöhnt und die schmerzhaften Krämpfe waren ausgeblieben. Zwar hielten sie sich noch immer an den Händen, wie es ihre Gewohnheit geworden war, aber mit lockerem Griff. Es war ihnen, als wären sie schon ihr ganzes Leben diese unheimliche, riesige Treppe hinunter geklettert, und als würden sie, so lange sie lebten, weiterhin Stufe um Stufe steigen. Ihre Gedanken schweiften nach oben zum Licht, an das sie sich nur noch vage erinnerten. Marc dachte darüber nach, wie das Belüftungs- und Kühlsystem dieser Anlage wohl beschaffen sein mochte und bewunderte die Erbauer für ihre technische Leistung. Akandra hingegen versuchte wieder und wieder, den Sinn der Treppe herauszufinden.
Sie hatten, wer weiß zum wievielten Mal, geschlafen, sich auf vielen Treppenabsätzen gestärkt, sie waren ausgeruht. Flott und leichtfüßig sprangen sie von Tritt zu Tritt. Da geschah es! Marc stolperte, glitt aus und fiel. Er schrie auf. Akandra wollte ihn halten, aber seine Hand rutschte aus der ihren. Bei dem Versuch, den Fallenden noch zu fassen, verlor sie selbst das Gleichgewicht, und so stürzten beide in die unendliche Tiefe. Hart schlugen sie auf die Kanten der steinernen Stufen, suchten krampfhaft nach Halt und rollten weiter. Sie schrien nicht mehr, sie gaben keinen Laut von sich, sie hatten mit dem Leben abgeschlossen.
Ihr Fall war nur kurz, denn nach wenigen Stufen schlugen sie auf einem neuen Treppenabsatz auf. Ihre Körper schmerzten. Stammelnd riefen sie und waren erleichtert, als sie die Stimme des anderen hörten. Zum Glück waren sie unverletzt geblieben. Ein gebrochenes Bein wäre in dieser Situation das Todesurteil gewesen. Keuchend und stöhnend lagen sie nebeneinander. Das Zittern ihrer Körper ließ langsam nach, und auch ihre Herzen schlugen wieder ruhiger.
„Das war knapp“, sagte Akandra.
„Wo bist du?" fragte Marc, und seine Hand tastete zu der ihren.
Später tranken und wuschen sie sich im Brunnen des Treppenabsatzes. Das seltsame Wasser linderte die Schmerzen der Prellungen.
Bei ihrem weiteren Abstieg war die Angst wieder ihr Begleiter. Ganz langsam bewegten sie sich und tasteten erst mit dem Fuß nach der nächsten Stufe, bevor sie einen Schritt endgültig wagten. So kamen sie nur mehr langsam voran, doch einen zweiten Absturz hätten sie nicht überlebt.
In ihr dumpfes Brüten drangen plötzlich Trommeln, so als würden Pauken langsam und pianissimo geschlagen. Sie konnten nicht ausmachen, woher der Schall kam, aber mit jeder Stufe nahmen die Paukenschläge an Stärke und an Geschwindigkeit zu. Schließlich dröhnten sie so laut in ihren Ohren, dass es schmerzte. Und mit einem Mal war da auch eine Stimme. Sie vernahmen sie nicht mit den Ohren, sondern klar und deutlich im Kopf selbst.
Die Stimme flüsterte: „Kehrt um, ihr könnt nicht weiter. Kehrt um, dies ist ein verbotener Weg! Kehrt um, ihr dürft nicht weiter!"
Angstvoll raunte Marc: „Was sollen wir tun?"
„Weitergehen!" Akandra ließ keinen Widerspruch zu und zog ihn mit sich.
Die Warnung wurde mit den gleichen Worten wiederholt, diesmal jedoch lauter und energischer. Beiden lief kalter Schweiß über den Körper. Ihre Herzen schlugen bis zum Hals. Dennoch setzten sie tapfer einen Fuß vor den anderen. Die Stimme schrie nun in ihrem Kopf, und sie krümmten sich vor Schmerzen. Aber sie quälten sich vorwärts. Und endlich sahen sie einen Lichtschimmer weit unten. Er war noch schwach, wie ein Stern am Nachthimmel, aber er war da.
Im gleichen Augenblick, in dem sie das Licht sahen, verstummten das Trommeln und die Stimme. Es war wie eine Erlösung. So schwach die Helligkeit auch war, für ihre an absolute Dunkelheit gewöhnten Augen reichte sie aus, um alles um sie herum wahrzunehmen. Hoch über sich erkannten sie die Decke und rechts und links, weit entfernt, die Seitentreppen. Von Stunde zu Stunde wurde das Licht heller und heller. Sie wandten sich einander zu. Zwei bleiche, hohlwangige Gestalten starrten sich an und erschraken über ihren Anblick. Die Stufen der Treppe glänzten so hell, als wären sie aus Marmor, und als das Licht greller wurde, spiegelte es sich auf ihnen und blendeten die Besucher. Das Licht strahlte aus zwei nebeneinanderstehenden Säulen.
Endlich nach Tagen, Wochen oder Jahren erreichten die Erits die letzte Stufe der langen Treppe. Das Material, auf dem sie nun standen, war das gleiche, wie das der Stufen: weiß und glänzend und unglaublich hart. Zögernd gingen sie auf die Säulen zu. Das Licht, das ihnen entgegen quoll, war so hell, dass sie die Augen zusammenkneifen und mit den Händen schützen mussten. Quer vor den Säulen sahen sie einen roten Strich auf der Erde. Das Rot leuchtete, und der weiße Boden dahinter leuchtete auch. Vorsichtig überschritten Akandra und Marc die rote Linie und zuckten sofort entsetzt zurück. Eine furchtbare Stimme hatte in ihrem Kopf gedonnert: „Weicht zurück!"
„Hast du das gehört?" stammelte das Mädchen.
Der Junge nickte verschüchtert.
„Was nun? Wir müssen weiter!"
Sie nahm ihren Begleiter an der Hand und überschritt entschlossen erneut die rote Linie. Wieder donnerte die Stimme: „Weicht zurück!"
Gleichzeitig krampften sich ihre beiden Körper unter einem heftigen Schmerz zusammen. Es war, als würden alle Nerven gleichzeitig geschunden. Marc heulte auf, riss sich los und rannte zurück zur Treppe. Akandra folgte ihm. Auf der untersten Stufe ließen sich beide gequält nieder, bis der Schmerz nachließ. Ihre Gesichter waren tränennass.
„Dahin gehe ich nicht mehr“, stammelte Marc. „Das halte ich nicht noch einmal aus."
Er begann auf mit Händen und Füßen langsam und wie verloren die Treppe hinauf zu kriechen. Akandra eilte ihm nach. Sie hielt ihn fest und umarmte ihn.
„Lieber“, sagte sie, „wir müssen dort hindurch. Wir werden auch das durchstehen. Alle Schmerzen gehen einmal vorüber, und sei es durch den Tod."
„Nein!" antwortete er und barg sein Gesicht an ihrer Brust. „Ich bin zu feige. Lieber will ich auf der Treppe sterben."
„Lieber“, wiederholte sie, „du bist nicht feige. Der Schmerz ist wirklich fürchterlich. Aber gemeinsam können wir ihn ertragen. Wir haben keine andere Wahl."
Marc nickte tapfer und folgte geduckt dem Mädchen, so als erwartete er jeden Augenblick neue Schläge. Langsam und furchtsam schritten sie auf die rote Linie zu. Akandra überquerte sie ohne Innehalten und schrie auf. Auch Marc hob ein Bein, blieb dann aber stehen. Seine Muskeln waren gelähmt, sein Körper unterwarf sich seinem Geist nicht mehr. Akandra blickte sich um und eilte zurück. Sie ergriff seine ausgestreckte Hand und zog ihn in das Leiden. Sofort peitschte der Schmerz auf ihn ein, und die Stimme brüllte in seinem Kopf: „Weicht zurück! Ihr seid im Licht, und das Licht wird euch verwandeln. Weicht zurück!"
Schritt für Schritt, sich gegen ein unsichtbares Hindernis stemmend, quälten sie sich auf das Lichttor zu, bis sie zusammenbrachen. Akandra gab nicht auf und kroch weiter. Schon hatte sich halb zwischen den Säulen hindurch geschleppt, da bemerkte sie, dass ihr Begleiter draußen geblieben war. Halb von Sinnen kämpfte sie sich zu ihm zurück, fasste seine Hand und zog ihn, der sich ohnmächtig in Schmerzen wandte, mit sich. Er versuchte, sie zu unterstützen. Seine Füße glitten kraft- und haltlos über den glatten Boden. Zoll um Zoll näherten sie sich unter unsäglichen Anstrengungen und Leiden dem Ziel. Die Stimme war so unerträglich laut, dass ihnen die Augen aus den Höhlungen traten. Zu dem Schrei in ihrem Kopf und dem Schmerz gesellte sich nun auch noch das Trommeln, das sie schon kannten. Ein nicht enden wollender Paukenwirbel warf ihre Leiber in Zuckungen hin und her.
Die Kräfte Akandras schienen unerschöpflich. Trotz aller Pein gab sie nicht auf. Sie schleppte sich und Marc durch das Tor. Schlagartig verstummten die Stimme und das Trommeln und das Licht wurde schwächer. Die Schmerzen verebbten. Sie blieben liegen, wo sie waren, und verfielen in einen erschöpften Dämmerzustand.