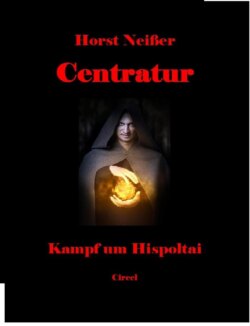Читать книгу Centratur I - Horst Neisser - Страница 7
ОглавлениеDie Älteren
Lange lagen sie so ohne Bewusstsein. Es schien, als wollte es ihnen fernbleiben, damit sie nicht an die überstandene Tortur erinnert würden. Endlich nahmen die durchgestandenen Qualen die Form eines bösen Traumes an, und sie konnten es wagen, die Augen zu öffnen und ihre Köpfe vorsichtig zu heben.
„Ich glaube, wir haben es geschafft“, flüsterte Akandra.
„Du hast es geschafft“, berichtigte sie Marc.
„Wir sind beide hier, das allein zählt."
Gedämpftes Licht, das den Augen wohltat, dessen Ursprung sie aber nicht erkennen konnten, erleuchtete einen kreisrunden Raum, aus dem sieben Türen abzweigten. Eine Flöte spielte eine einfache, aber wundersame Melodie. Sie war so schön, dass es den Erits bei ihrem Klang wohl wurde. Sie ließ die überstandenen Schmerzen und Leiden verheilen. Die Töne drangen aus der mittleren Tür. Ohne nachzudenken gingen sie darauf zu und öffneten sie.
Ein Saal mit einem spitz zulaufenden Gewölbe tat sich auf. Aus hohen Säulen wuchsen schlanke Rippen. Sie trugen die Decke. Die Säulenkapitelle waren als Blumenornamente geformt. Durch spitzbogige Fenster an beiden Seiten der Halle flutete Licht. Dennoch brannten Kerzen auf eisernen Leuchtern, die im Kreis aufgestellt waren. Dort saßen sechs Leute ganz aufrecht auf Stühlen mit hohen Lehnen. Ruhig betrachteten sie die jungen Leute.
„Mutter“, sagte Akandra erstaunt.
„Mutter, du hier?" rief Marc.
„Vater, wo kommst du her?" die junge Frau war ganz aufgeregt.
Auch der junge Erit sah seinen Vater. Die beiden wollten auf die vertrauten Eltern zugehen, sich ihnen zu Füßen werfen, aber sie wurden von einer unsichtbaren Kraft zurückgehalten. Eine Stimme, die von allen sechs Personen gleichzeitig kam, sprach: „Willkommen im Herzen der Welt. Der Weg zu uns ist weit und er ist eine Prüfung. Nur wenigen ist es seit langer Zeit gelungen, zu uns vorzudringen. Ihr musstet sterben, um geboren zu werden."
Marc fragte mit großem Ernst: „Weshalb ist uns gelungen, was so vielen misslang?"
„Es war euer aufrechter Wunsch zu helfen, der euch die Treppe bestehen ließ."
Nun konnte Akandra nicht mehr länger an sich halten. „Aber liebe, schöne Mutter, lieber Vater, wie kommt ihr hierher?"
Eine der Frauen antwortete: „Ich bin nicht deine Mutter, und doch bin ich deine Mutter." Und einer der Männer antwortete: „Ich bin nicht dein Vater, und doch bin ich dein Vater."
Verständnislos sahen die jungen Leute sich an.
Da sprach der Mann, der ganz außen saß und bisher geschwiegen hatte: „Ich bin euer aller Vater und Mutter. Wisset, hier ist die Wiege und das Ende der Welt."
Dann sprach die Frau, die bisher geschwiegen hatte und außen saß: „Weil wenig Zeit ist, und es so vieles zu bereden gilt, müssen wir uns Zeit lassen. Deshalb werdet ihr erst einmal schlafen und essen."
Sie stand auf, schritt auf die Besucher zu und ergriff deren Hände. Gemeinsam durchmaßen sie die Halle in ihrer ganzen Länge und schritten durch eine niedere Tür. Dahinter verbarg sich ein kleines Zimmer.
„Das ist ja beinahe wie in Gutruh“, rief Marc aus.
Und Akandra sagte: „Nein, es erinnert mich an Waldlust!"
„Ihr sollt euch wohl fühlen“, lächelte die Frau und verließ sie.
Akandra und Marc sahen sich um. Da standen weiche Betten, so wie Erits sie gerne haben, eine Kommode, ein Schrank, Tisch und Stühle. An den Wänden hingen Bilder, die Bäume, Sträucher und eine wunderschöne untergehende Sonne zeigten. Müde ließen sie sich auf die Betten fallen und waren schon nach wenigen Sekunden eingeschlafen.
Als Marc nach vielen Stunden wiedererwachte, blickte er auf das Bild über seinem Bett, das vor dem Einschlafen eine untergehende Sonne gezeigt hatte. Nun erkannte er, dass er sich geirrt hatte. Nicht die Sonne, die der Nacht weicht, war dargestellt, sondern der Zeitpunkt des Sonnenaufgangs. Auch Akandra reckte sich, gähnte und rieb sich die Augen. Helles Licht fiel durch die runden Fenster des Zimmers. In der Ecke standen eine Schüssel und ein Krug mit Wasser. Dort wuschen sie sich. Auf dem Tisch fanden sie eine Kanne mit dampfendem Tee, Brot, Butter und Früchten. Ausgehungert ließen sie sich das Frühstück schmecken. Als sie sich endlich satt zurücklehnten, öffnete sich die Tür, und zwei Frauen traten herein.
„Mutter?" riefen die jungen Leute gleichzeitig.
Die Frauen lächelten nur, nahmen sie an der Hand und führten sie zurück in die hohe Halle. Dort waren zwei bequeme Stühle für sie bereitgestellt. Wieder bildeten die Alten einen Halbkreis um ihre jungen Gäste. Die alten Frauen und Männer sprachen abwechselnd, aber wie mit einer Stimme.
„Nun ist die Zeit für Fragen und die Zeit für Erklärungen. Stellt nicht zu viele Fragen, aber stellt die richtigen."
Sofort fragte Akandra: „Wer seid Ihr? Ihr seht aus wie unsere Eltern, aber ihr seid es nicht."
„Ich bin eure Eltern, und ich bin es nicht. Ich bin alle und keiner."
„So nennt wenigstens Eure Namen!" forderte Marc.
„Ich habe keine Namen mehr."
„Hattet ihr einmal Namen?"
„Alles wurde einmal benannt."
„Wenn schon jeder einzelne von euch keinen Namen hat, wie heißt ihr alle zusammen?"
„Ich bin der oder die Ältere."
„Was ist eure Aufgabe?" wollte Akandra wissen.
„Ich bin! Und ich wache!"
„Seid ihr mächtig?"
„Was ist das, Macht?"
„Könnt ihr uns, die wir da oben leben, helfen?"
„Ja und nein. Ihr seid hier, weil wir helfen und ihr werdet gehen, weil wir nicht helfen können."
„Ihr sprecht in Rätseln“, rief Marc ärgerlich.
„Ich sage die Wahrheit. Sie klingt immer rätselhaft. Klar erscheint meist nur die Dummheit, die Halbwahrheit oder die Lüge."
„Ich verstehe nichts“, Marc klang ungehalten.
„Ruhig, mein Junge! Es gibt keinen Grund für Ärger. Ich werde von der Vergangenheit erzählen, dann werdet ihr mehr verstehen.
Ich bin schon sehr lange in der Welt und habe alles gesehen. Bevor ich kam, war alles Leben im Wasser. Später verließen die Geschöpfe die Ozeane. Die Pflanzen und Tiere trennten sich und wurden verschieden. Dann wurden aus kleinen Lebewesen große, und das Zeitalter der schrecklichen Echsen begann. Nichts war vor ihnen sicher. Manche waren groß wie Berge und fraßen ganze Landstriche kahl. Andere wiederum waren blutgierige Räuber, die alles zerfleischten, was sie zwischen ihre spitzen Zähne bekamen. Es schien, als würden diese Bestien auf immer die Welt beherrschen. Doch nichts ist ewig. Irgendwann überwand die Erde diese Tyrannei, und die Echsen starben aus. Nun war endlich Platz für neue Tiere. Land und Meer wurden überschwemmt von neuen Arten. Dies war der Zeitpunkt, zu dem auch ich geschaffen wurde.
Zuerst war ich nur eine, dann wurde ich viele. Ich wanderte durch die Welt und befruchtete sie. Jahrhunderte war ich nur mit Zeugen beschäftigt. Überall sprossen Kinder von mir empor. Sie waren zuerst noch unvollkommen, hatten lange Arme, mit denen sie sich auf dem Boden abstützten. Auch ihr Gemüt war von schlichter Natur. Doch mit der Zeit wurden meine Kinder vollkommener und klüger. Sie lernten es, Werkzeuge zu schaffen, das Feuer zu zähmen, Häuser zu bauen und den Boden zu bestellen.
Aber einige meiner Nachkommen verbündeten sich mit bösen Mächten, weil sie sich davon Vorteile erhofften. Ich war verzweifelt und versuchte, sie zu warnen, zurückzuhalten. Sie hörten nicht auf mich. Sie begannen, Kriege zu führen und ohne Not zu töten. Am Ende bedrohten sie sogar mich, ihre Eltern. Deshalb schuf ich mir dieses Refugium tief im Herzen der Erde.
Damals gab es den Wilden Wald dort oben noch nicht. Nur ein paar Bäume wuchsen, die mein Sohn ROM pflegte. Das Tor oben stand zu dieser Zeit noch für jedermann offen, und die große Treppe war hell erleuchtet. Ihre Stufen waren zu dieser Zeit niemals leer. Ströme von Menschen, Achajern und anderen Geschöpfen wanderten die Treppe nach unten und nach oben. Sie, die zu mir kamen, hatten noch keine Angst vor dem Fall in die Tiefe. Diese Angst entstand erst, als ihr Geist sich verdunkelte, und sie deshalb an sich selbst zweifeln mussten. Damals herrschte Selbstvertrauen, und der Weg über die Treppe war ein Fest. Meine Kinder waren viele Tage und Wochen unterwegs, und wenn sie die Stufen hinauf- und hinunterstiegen, so sangen sie und waren fröhlich. Am Rand der Treppe, das konntet ihr nicht sehen, gibt es Möglichkeiten, um zu rasten. Dort konnte man sich erquicken und schlafen. Alle, die sich dem Bösen noch nicht verschrieben hatten, gingen im Lauf ihres Lebens mindestens einmal über die Treppe. Sie kamen zu mir, zu Mutter und Vater. Wenn man nämlich zur Erkenntnis über sich selbst gelangen will, muss man zu den Ursprüngen zurück. Ich habe mich über jedes Kind gefreut, das mich besucht hat. Sie bekamen von mir alles, was ich hatte, und sie brachten mir Geschenke, die ich noch heute hüte.
Derweil wuchs der Wald unter der Fürsorge von ROM. Damals waren die Bäume noch nicht böse und verbittert. Sie ließen prächtige Wege für meine Besucher offen und nährten sie. Doch in den Jahrhunderten nahm die Macht des Bösen zu. Sie schlug immer mehr von meinen Kindern in ihren Bann. Dies ging langsam und schleichend vor sich. Doch damit die Geschöpfe der Welt der finsteren Macht völlig ausgeliefert waren, mussten sie ihre Herkunft vergessen. Erst wenn meine Nachkommen nichts mehr von mir wussten, hatten meine Gegner ihr Ziel erreicht. Schließlich war das Furchtbare vollbracht, meine Kinder hatten mich vergessen. Sie waren damit verloren und wussten es nicht.
Die Besuche bei mir wurden immer seltener. Ich blieb allein zurück. Das Licht auf der großen Treppe erlosch. Zwischen dem Wilden Wald und den Menschen brach Feindschaft aus. Die Bäume sollten nun gegen deren Willen genutzt werden. Das bedeutete Rodung, Ausbeutung, Versklavung, und schließlich Vernichtung. Die Menschen gingen auch mit sich selbst nicht freundlich um und noch weniger mit den Bäumen. So wie der Mensch im anderen Menschen nur noch ein Ding sah, das ihm nützlich oder weniger nützlich sein konnte, so sah er in den Bäumen keine Lebewesen mehr, sondern nur noch Bau- oder Brennholz. ROM und sein Wald begannen sich zur Wehr zu setzen, und sie haben mit meiner Unterstützung den Kampf bis jetzt gewonnen. Seit damals schützt der Wilde Wald auch den Zugang zu mir. Nur sehr selten, alle paar Jahrhunderte einmal, lässt ROM jemand zu dem Tor vordringen. Ihr gehört zu den Wenigen, die der Wald seit langer Zeit akzeptiert hat.
Aber wenn ihr glaubt, dass ich, seit ich in Vergessenheit geraten bin, geruht hätte, so irrt ihr euch. Viele meiner Teile sandte ich immer wieder in die Welt, in der Hoffnung etwas zu retten. Leider bewirkten sie nur wenig und starben. Dadurch wurde ich schwächer und nahm mehr und mehr ab. Zwar bin ich nach euren Maßstäben noch immer mächtig und kann so manches Geschick im Verborgenen lenken. Aber den eingeschlagenen Weg meiner Kinder kann ich nicht korrigieren. Ich kann ihnen nicht mehr helfen, sie nicht vor dem Bösen retten. Einer ist heute des Anderen Feind. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mich dieser Kampf, diese Bosheiten, diese Gemeinheiten unter meinen Kindern erbittern und quälen."
„Ihr resigniert also? Ist das der Grund, warum ihr nicht eingreift, um das Böse auf Erden zu verhindert? Soll das etwa die Erklärung dafür sein, warum ihr zulasst, dass brave Erits abgeschlachtet werden?" Marc hatte mit scharfem Ton in der Stimme gefragt.
Sofort fiel ihm Akandra ungehalten ins Wort: „Fängst du schon wieder an? Hat dir der Streit mit ROM nicht gereicht? Immer suchst du nach Mächten, die ihre schützende Hand über dich halten sollen. Und wenn sie nicht so wollen, wie du es erwartest, machst du ihnen Vorwürfe. Unsere Probleme müssen wir zu allererst selbst lösen. Wenn uns dabei jemand unterstützt, so ist dies hilfreich, aber wir können es nicht einklagen. Du bist wie ein Kind, das von seinen Eltern ständig fordert, ihm die Steine aus dem Weg zu räumen. Wir Erits müssen endlich erwachsen werden!"
„Es gibt Probleme, die können wir nicht alleine bewältigen." Auch Marc war nun wütend. Ihre Gastgeber hatten die beiden Erits bei ihrem Streit vergessen. „Bist du etwa nicht vor den Orokòr weggelaufen? Warum hast du dich ihnen nicht gestellt und dein Problem selbst gelöst, so wie du es nun forderst?"
„Flucht ist keine Feigheit. Wenn ich im Augenblick zu schwach bin, um gegen einen übermächtigen Feind anzutreten, heißt dies noch lange nicht, dass ich mich unterwerfe oder auf Hilfe warte."
„Du bist ja größenwahnsinnig, wenn du annimmst, du könntest einen Feind wie die Orokòr bekämpfen. Ich will dir etwas sagen: Du bist deinem Schicksal hilflos ausgeliefert, wenn du nicht jemanden findest, der ebenso mächtig ist wie dein Feind, und der dir zu Hilfe kommt."
„Aus dir spricht eine Mutlosigkeit, über die ich vor Wut schreien möchte. Es gibt doch noch andere Waffen als Körperstärke und Übung im Kriegshandwerk. Vielleicht sind wir kleinen Erits den Orokòr an Schlauheit und Kriegstaktik überlegen? Und wenn wir es nicht sind, so müssen wir diese Fähigkeiten eben entwickeln. Dies erreichen wir jedoch nicht, wenn wir stets und überall um Hilfe betteln."
„Wo waren denn deine ach so tollen Waffen, als die Orokòr Waldmar überfielen? All deine Schlauheit und Taktik haben deiner Mutter nicht geholfen. Warum bist du überhaupt hier, wenn du keine Hilfe suchst?"
Marc war in seinem Zorn zu weit gegangen, das begriff er, als plötzlich dicke Tränen über Akandras Gesicht rollten.
„Ich bin hier“, flüsterte sie, „weil ich Waffen suche, mit denen ich die Orokòr bekämpfen kann. Ich will meine schöne Mutter rächen."
„Ruhig, meine Kinder“, lächelte eine der Alten begütigend. „Ihr habt beide recht. Akandra hat Recht, wenn sie fordert, die Sterblichen sollen ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Niemand entbindet sie nämlich von der Verantwortung für sich selbst. Und Marc hat Recht, wenn er auf ihre Schwächen hinweist. Kein Sterblicher könnte nämlich ohne die Unterstützung der höheren Mächte existieren.
Eure Situation ist so ähnlich, als würdet ihr in einer Kutsche sitzen, deren Pferde durchgegangen sind. Ihr könnt die Pferde nicht bändigen, ihr könnt den Wagen nicht zum Stehen bringen, und ihr könnt den Pferden keine Richtung befehlen. Dies liegt einzig im Willen der Unsterblichen. Was ihr aber könnt, das ist, die Zügel festhalten, die Räder um Unebenheiten der Straße herum lenken und verhindern, dass der Wagen in den Abgrund fährt. Was ihr aber auch könnt, ja, was ihr solltet, das ist, die Mächte des Guten unterstützen, damit die Welt ins rechte Lot gebracht werden kann.
Noch besteht nämlich Hoffnung. Noch ist die Welt nicht völlig in den Klauen des Bösen. Damit sie aber gerettet werden kann, müssen die Lebenden zu ihren Ursprüngen zurückkehren, so wie ihr es getan habt. Das Licht auf der Treppe muss wieder leuchten, und es darf keine Angst herrschen, wenn sie begangen wird. Doch bis dahin ist noch ein weiter Weg."
„Warum sind wir hier?" fragte Akandra, die sich wieder gefasst hatte.
„Weil ich eure Hilfe brauche."
Diese Eröffnung ließ die jungen Leute verstummen. Verständnislos sahen sie sich an.
Rutan und Vespucci
Weiße Lichtstreifen durchschnitten die Luft und ließen die Halle noch höher erscheinen, als die Älteren mit ruhiger Stimme begannen:
„Lasst eure Gedanken in weite Fernen schweifen. Ihr werdet jetzt von Völkern und Geschehnissen hören, von denen in ganz Centratur noch niemand vernommen hat."
„Nicht einmal Aramar?" fiel Marc eifrig ein.
„Nein, auch Aramar weiß nichts davon, und sein Wissen reicht wahrlich weit."
„Wie habt dann ihr davon Kenntnis erlangt?" Akandra hatte mit leiser Stimme gefragt.
„Weil ich überall bin. Aber lasst uns beginnen! Die euch bekannte Welt ist groß. Noch größer aber sind die Gebiete, von denen ihr keine Kunde habt. Sie sind so weit entfernt, dass bei euch nicht einmal ihre Namen bekannt sind. Was liegt jenseits der Wüste Soltai? Wahrscheinlich könnten diese Frage nicht einmal die Zauberer beantworten. Keiner eurer Weisen hat sich je für die Welt jenseits der Grenzen von Centratur interessiert, selbst im Weißen Rat wurde nie über sie gesprochen. Der Ferne Osten ist ein weißer Fleck auf euren Landkarten, und die meisten Atlanten weisen nicht einmal diese Flecken aus.
Natürlich habe ich darüber nachgedacht, weshalb die Leute von Centratur sich nicht um den Osten kümmern. Weshalb für sie hinter Volan die Welt zu Ende ist. Vielleicht gibt es eine ganz einfache Erklärung für eure Unkenntnis. Niemand hat euch bisher von diesen fernen Gegenden berichtet, denn die dort waren, schweigen. Und doch werden vom fernen Osten seit geraumer Zeit die Geschicke in eurer Heimat bestimmt."
Die Älteren sahen die verständnislosen Augen ihrer Besucher und lächelten.
„Die Welt, auf der ihr lebt, ist wie ein runder Ball. Wenn ihr nach Osten lauft, gelangt ihr irgendwann wieder zu der gleichen Stelle zurück, von der ihr losgegangen seid. Das Gleiche geschieht, wenn ihr nach Westen geht. Nun stellt euch vor, ihr beginnt eine lange Wanderung rund um den Erdball. Ihr kommt dabei durch viele Länder und erreicht endlich ein großes Gebiet. Es heißt Gagaia. Dort leben Menschen, die eine eigene Sprache sprechen. Ihr könntet euch mit diesen Leuten nicht verständigen.
Die Natur hat es gut mit diesem Teil der Erde gemeint, denn dort ist es warm und schön. Nie wird es richtig Winter. Die Böden sind fett und fruchtbar. Naturkatastrophen wie Erdbeben oder wilde Stürme hat es dort bisher nicht gegeben. Seit undenklichen Zeiten siedeln auf Gagaia Leute, und es waren alle Voraussetzungen für sie gegeben, glücklich zu werden. Aber nichts ist wirklich vollkommen. Die Geschöpfe von Gagaia haben sich nämlich nicht zu einem großen Volk vereinigt und ihr geschenktes Glück genossen, sondern sich geteilt und voneinander abgesetzt. Es entstanden zwei Reiche: Rutan und Vespucci. Diese unterscheiden sich voneinander wie Feuer und Wasser, Musik und Stille, Tag und Nacht. Ihr könnt euch diesen Unterschied kaum vorstellen, deshalb muss ich ihn näher beschreiben.
Lasst mich von dem ersten Land erzählen. Es heißt Vespucci und seine Bewohner haben große Köpfe und Hände mit langen Fingern, deren Nägel sie nie schneiden. Damit diese Fingernägel nicht abbrechen, sind sie geborgen in Futteralen aus Gold und Silber und verziert mit Edelsteinen. Von Gestalt sind diese Wesen klein mit kurzen Beinen und kurzen Armen. Auf dem Kopf haben sie keine Haare.
Die Völker in diesem fernen Erdteil sind, wie ich schon sagte, sehr alt. Älter vielleicht als alle Geschöpfe in Centratur mit Ausnahme der Achajer und der Zauberer. Die Vorfahren der Vespucci waren die sagenhaften Gulps, die einst tief unter der Oberfläche im Innern der Erde bei den Wurzeln der Gebirge lebten. Sie gruben dort kunstvolle Gänge und Hallen und schufen Schmuck und wundersame Gegenstände."
„So wie die Zwerge?" warf Marc ein.
„Mit den Zwergen kannst du die Vespucci nicht vergleichen. Die Kunst der Zwergenschmiede ist zwar in Centratur unübertroffen, aber sie sind Stümper gegenüber diesem Volk. Obgleich es möglich ist, dass auch die Zwerge von den Gulps abstammen. Doch dafür fehlt bisher jeder Beweis, und die Vespucci hegen keine Zuneigung für die Zwerge. Die Gulps jedenfalls schufen nicht nur wunderbare Welten in der Tiefe, sie konnten dort unten das Dunkel sogar hell erleuchten, so als ob die Sonne schiene. Als die Berge irgendwann von Wind und Wasser und der Zeit abgetragen worden waren, kamen die Gulps ans Tageslicht und wandelten sich im Lauf von Äonen zu den Vespucci.
Die Vespucci sind noch immer große Handwerker und Künstler. Zum Vergnügen formen sie aus Stein die wunderbarsten Bildnisse. Selbst die Häuser, in denen sie wohnen, sind Kunstwerke. Im Lauf der Jahrtausende schufen sie sich ein Reich voller Schönheit und Bequemlichkeit."
„Dann kann die Welt doch viel von ihnen lernen“, wandte Akandra ein.
„Auf den ersten Blick ja. Es geht tatsächlich etwas Verführerisches von diesem Volk aus. Aber dem muss man sich widersetzen. Die Vespucci sind nämlich von ihren eigenen Fertigkeiten so fasziniert, dass sie nur noch das akzeptieren und um sich dulden, was von ihnen selbst geschaffen wurde. Alles andere, auch das, was die Natur hervorbringt, haben sie ausgemerzt. Überall gibt es nur von Vespuccihand Geschaffenes. Ihr ganzes Reich ist angefüllt mit prächtigen Bauwerken, Skulpturen und anderen Produkten ihrer Kunstfertigkeit.
Sogar das Aussehen ihrer Kinder wollen sie selbst bestimmen. Sie sind der Meinung, dass das, was schwangere Frauen sehen und erleben, die Frucht in ihrem Leib formt und gestaltet. Deshalb umgeben sie die Frauen vor der Geburt mit Bildern und Skulpturen in der Art, wie sie sich die Kinder wünschen. Eine Familie, die einen blonden Jungen begehrt, lässt die werdende Mutter nur noch blonde Jungen und Männer sehen. Die anderen wollen ein schlankes, schwarzhaariges Mädchen und verfahren ebenso. Ob diese Methode erfolgreich ist, sei dahingestellt. Aber die Vespucci halten sich streng daran.
Die Kunst spielt in diesem Land überhaupt eine große Rolle. Es werden dort die wunderbarsten Kunstwerke geschaffen. Manche der Bilder oder Figuren sind so schön, dass man den Blick nicht mehr von ihnen abwenden kann. Verweilt man länger als ein paar Minuten, vergisst man die Welt um sich her und verfällt in eine lähmende und nicht zu lösende Verzückungsstarre. Um dem entgegenzuwirken befinden sich die Vespucci ständig in hektischer Betriebsamkeit. Niemand bleibt längere Zeit gelassen an einer Stelle. Es scheint, als haben die Leute Angst vor ihren eigenen kunstvollen Produkten.
Am meisten aber ekeln sie sich vor der Natur. Wenn sich irgendwo ein Grashalm sehen lässt, ein Baum oder ein Strauch zu keimen beginnt, dann wird er sofort ausgerissen. In ihren Augen ist alles Natürliche hässlich und gefährlich. Schließlich beeinträchtigt die sich frei entfaltende Natur die Ordnung, die sie in ihrer Welt geschaffen haben. Es gibt einen eigenen Berufsstand bei ihnen, der ihre Welt vor dem Hervortreten von Natur bewahrt. Er ist organisiert wie ein Soldatenheer. Seine Mitglieder nennen sich Wächter und Verteidiger der Freiheit, und das sind sie auch: Sie bewachen das Land vor der Natur.
Zwar leben die Vespucci in prächtigen marmornen Palästen, aber ihr werdet dort keine blühenden Gärten finden. Überhaupt singen in diesem Land keine Vögel und keine Hasen hoppeln über Felder. Die Tiere könnten auch dann nicht überleben, wenn man sie nicht ausgerottet hätte, denn sie fänden keine Nahrung. Die Erde ist mit einer Schicht aus Stein überzogen. Aber es ist ein besonderer Stein, denn auch er wird, wie könnte es anders sein, künstlich hergestellt. Es ist schwer, euch eine Vorstellung zu geben, wie es dort aussieht. Das Land ist so ganz anders als das Heimland. Keine Hühner laufen auf den Gassen frei herum und scharren im Boden nach Nahrung. Keine Kühe werden morgens auf die Wiesen getrieben, und keine Schweine grunzen hinter den Häusern."
„Aber die Leute müssen doch von etwas leben? Alle Lebewesen müssen essen. Wie kann man leben, ohne Felder zu bebauen und Tiere zu züchten?"
„Oh ja, die Grundbedürfnisse des Lebens wie Essen und Trinken haben sie noch nicht beseitigen können, obgleich sie sich größte Mühe geben. Aber wenn sie schon zu ihrem Kummer noch Essen und Trinken müssen, so wollen sie doch beim Essen nicht daran erinnert werden, dass die Nahrung in ihrem Ursprung natürlich ist. Es kommen keine gebratenen Hühnchen und keine knackigen Äpfel auf den Tisch. Vielmehr bearbeiten sie die Nahrung so lange, bis alle Erinnerung an ihr ehemaliges Aussehen verschwunden ist. Sie wird zu Würfeln oder Kugeln geformt und dann serviert. Wenn die Vespucci dann endlich essen, können sie nicht mehr erkennen, woraus ihre Nahrung einst bestanden hat, und woraus sie hergestellt worden ist.“
„Aber Tiere gibt es doch noch?“
„Ja, aber sie sind in eisernen Käfigen zusammengepfercht und sehen nie das Tageslicht. Sie leben einzig und allein zu dem Zweck geschlachtet zu werden. Und ich glaube, der Tod ist für sie eine Erlösung. Gemüse und Obst pflanzen sie in fremden Ländern an, die sie erobert haben. Sie wollen keine Pflanzen in ihrem Land Vespucci dulden.
Die Vespucci haben, wie ihr seht, große Angst vor dem Natürlichen, aber sie sind wahre Meister im Erfinden. Sie haben zum Beispiel unterschiedliche Metalle zusammengefügt, und der entstandene Stoff ist härter als alles, was ihr euch vorstellen könnt. So leben sie im Wohlstand und müssen sich nicht für ihren Lebensunterhalt mühen. Sie sind umgeben von schönen Dingen und größter Bequemlichkeit. Alles ist ihnen wohlgeraten. Aber ihre Herzen sind ohne Mitleid, und sie sind stets bestrebt, ihr Reich auszudehnen. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die übrige Welt nach dem Vorbild ihres Landes zu formen. In grausamen Kriegen haben sie alle Nachbarn unterworfen. Nur so, wie sie selbst leben, so meinen sie, wäre das Leben lebenswert. Deshalb sagen sie, wenn sie andere Länder versklaven, dass sie ihnen die Freiheit bringen. Die Vespucci versprechen allen Völkern Glück und Reichtum und ein bequemes Leben, wenn sie nur ihre Herrschaft und die Art des Vespucci-Lebens anerkennen.
Ein Land jedoch, und ausgerechnet mit ihm teilen sich die Vespucci eine Grenze, hatte ihnen lange widerstanden. Es liegt noch weiter im Osten und wird von einem König regiert. Seine Bewohner nennen es Rutan. Sie sind hochgewachsen und haben ebenmäßige Züge. Das Land der Rutaner unterscheidet sich von dem der Vespucci wie Feuer von Wasser. Ist dort alles künstlich, so ist hier alles natürlich. Wird dort alles Natürliche vernichtet und umgestaltet, so wird hier die Natur völlig sich selbst überlassen. Menschenwerk gilt als unanständig, ja manchmal sogar als Verbrechen. Alle Pflanzen wuchern, ohne dass menschliche Hände sie zähmen. Ein Eingriff in die Natur oder gar ihre Lenkung ist bei Strafe verboten. Dein Vater, Marc, wäre als Gärtner dort ein großer Verbrecher.
Zusammenfassend kann man sagen: Das eine Volk verehrt die tote Materie und betet sie an. Für die anderen ist das Lebendige heilig und darf nicht beeinträchtigt werden."
„Dann sind die Rutaner also ein sehr friedliches Volk, das im wahrsten Sinne des Wortes keiner Fliege etwas zu leide tut“, ließ sich Akandra vernehmen.
„Täusche dich nicht! Die Fliegen lassen sie sicher in Ruhe, aber bei ihren Feinden sind die Rutaner gefürchtet. Sie gelten als grausam und unbarmherzig im Krieg. Von einem friedlichen Volk kann keine Rede sein."
„Das verstehe ich nicht. Das widerspricht sich doch?"
„Alles Lebendige ist widersprüchlich. Widerspruch ist ein Wesenszug des Lebens. Doch hört weiter. Das Land Rutan ist wie ein riesiger Dschungel voller wilder Tiere. Auch die Pflanzen sind ungebändigt und gefährlich. Aber Tiere und Pflanzen leben mit den Einwohnern in Frieden. Die Rutaner haben nichts von ihnen zu befürchten, obgleich sie sich nicht einmal gegen die Angriffe der Tiere und Pflanzen wehren würden. Aber wehe, wenn jemand von außerhalb die Grenzen überschreitet. Dann fallen alle zusammen, Menschen, Pflanzen und Tiere über ihn her, und er überlebt nicht lange.
Die Rutaner werden von einem König regiert. Dieser König spielt eine ganz besondere Rolle. Alle Rutaner sind nämlich miteinander geistig verbunden. Sie bilden eine große Einheit und der König ist ihr Kristallisationspunkt. So wie der König fühlen und denken mit einer Ausnahme alle Rutaner."
„Wer ist diese Ausnahme?“ fragte Akandra.
„Die Hohepriesterin. Sie ist verantwortlich für das geistige Heil des Volkes und ist gleichzeitig unabhängig von der Welt des Königs. Aber alle anderen sind dem König unterworfen. Es ist eine Welt, in der es keine Einzelwesen gibt, sondern nur ein großes Ganzes.“
„Dort möchte ich nicht leben", sagte Marc.
„Das kann ich dir nicht verdenken", antwortete eine der Älteren. „Aber nur die Rutaner können die Vespucci in Schach halten. Sie haben deren Expansionsdrang lange Zeit widerstanden. Zwar gab es in der Vergangenheit viele kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den beiden Völkern, die mit Härte und Unerbittlichkeit geführt wurden. Aber niemals gab es einen wirklichen Sieger. Am Ende der Kämpfe, nach dem Zählen der Toten, mussten beide Seiten stets feststellen, dass sie verloren hatten. Es waren eben zwei gleich starke Gegner, die sich nicht besiegen konnten. Trotz aller Anstrengungen der Vespucci war diese Situation nicht zu überwinden. Es dauerte lange bis die feindlichen Nachbarn dies eingesehen hatten, und es kostete viel Blut und viel Leid. Erst vor einem Menschenalter haben sie die sinnlosen Kämpfe eingestellt. Dies heißt jedoch nicht, dass die Völker nun auch in Frieden miteinander leben wollten, dazu waren ihre Lebensweisen und Vorstellungen vom Glück viel zu verschieden.
Besonders die Vespucci reizte die Existenz des Erbfeindes jenseits ihrer Grenzen zu immer neuen Wutausbrüchen, die das ganze Volk erfassten. Für ihren Ehrgeiz und ihr Selbstwertgefühl bedeutete die bloße Existenz der Rutaner schon eine Herausforderung. Sie konnten sich mit dem Waffenstillstand nicht zufriedengeben, wollten aber auch keine neuen Blutopfer bringen. Außerdem konnten sie, solange die Rutaner unbezwungen neben ihnen lebten, ihren großen Plan nicht weiterverfolgen."
„Was ist das für ein Plan?" fragte Marc sofort.
„Das werdet ihr noch früh genug erfahren. Hört genau zu, es ist wichtig für euch. Die Vespucci überlegten und berieten Tag und Nacht, wie es wohl möglich wäre, die Rutaner ohne Krieg zu unterwerfen. Alle Frauen, Männer und sogar Kinder konnten an nichts Anderes mehr denken. Schließlich fanden sie nach langem Forschen die richtige, die tödliche Waffe: die Liebe."
„Das kann doch nicht sein!" rief Marc entsetzt. „Die Liebe verhindert doch das Böse. Sie ist die einzige Waffe gegen den Tod in der Welt."
„Wenn du zuhörtest, Marc, dann würdest du dich nicht so erregen." Der sanfte Tadel ließ den jungen Mann verstummen, und die Älteren fuhren fort: „Es war den feindlichen Vespucci klar, dass dem König der Rutaner sein gesamtes Volk folgen würde, wenn er seinen Widerstand aufgäbe. Dieser Herrscher wurde deshalb zum Angriffsziel der Vespucci.
Sie versuchten ihn in die Fänge schöner Frauen zu locken, um ihn gefügig zu machen. Doch diese Unterfangen waren müßig. Wenn es den Frauen nämlich tatsächlich gelang, das feindliche Land der Rutaner zu durchqueren und den König zu sehen, so fand dieser sie so künstlich und so hässlich, dass er sich empört von ihnen abwandte. Dass dieser Plan nicht aufgehen konnte, hätten sich die Angreifer denken können.
Als ihre Tücke nicht gelingen wollte, griffen die Vespucci zu einem ihrer bewährtesten Mittel, nämlich der Kunst. Sie stellten eine Frau künstlich her. Sie wurde das schönste Wesen der Welt. Sie war so schön, dass kein sterblicher Mann sie ansehen konnte, ohne in wahnsinnige Liebe zu ihr zu verfallen. Ihre Schöpfer wagten sich selbst nur mit verbundenen Augen in ihre Nähe."
„Mir könnte so ein Geschöpf nichts anhaben“, dachte sich Marc. „Diese Frau würde mich völlig kalt lassen. Ich verstehe nicht, weshalb sich andere Männer so leicht den Kopf verdrehen lassen."
Aber diese Gedanken sprach er nicht laut aus, sondern hörte dem Bericht gespannt weiter zu. Die alte Frau, die rechts außen saß, schien seine Gedanken erraten zu haben, denn sie lächelte versonnen und schüttelte leicht den Kopf.
„Diese, man könnte beinahe sagen, überirdische Frau schmuggelten die Vespucci heimlich über die Grenze nach Rutan. Sie hatte den Auftrag, sich unbemerkt an den jungen König heranzuschleichen und ihn zu umgarnen. Getreulich führte sie den Befehl ihrer Schöpfer aus. Und so fand sie eines Tages den König der Rutaner auf einer Lichtung im tiefen Wald. Die seltsamsten und buntesten Blumen blühten auf der Wiese und auf den Bäumen um ihn herum. Mächtige Raubkatzen halten die Wache.
Der König schlief im tiefen Gras im Schatten eines goldenen Busches. Pareira, so hieß die schöne Frauengestalt, näherte sich dem Schlafenden, setzte sich zu ihm und strich ihm sanft über das Haar. Sie war nackt, damit sie sich von den Rutanern nicht unterschied. Ihre Schöpfer hatten inzwischen gelernt, dass sie nur mit Anpassung etwas erreichen konnten. Als der König erwachte, beugte sie sich über ihn und sah ihm tief in die Augen. Kein Mensch, kein Zwerg und auch kein Erit hätte diesem Blick widerstehen können. Jeder hätte sich und sein Herz sofort an dieses Weib ausgeliefert."
„Ich nicht!" sagte Marc noch einmal zu sich, und wieder lächelte die Frau.
„Nicht so der Herrscher der Rutaner. Er sprang auf, stieß sie von sich und rief: 'Du bist kein Geschöpf meines Landes. Noch nie habe ich etwas so Künstliches gesehen wie dich. Du befleckst diese reine Lichtung. Dein Anblick beleidigt die Bäume und das Gras, die Tiere und die Vögel.'
Dann ließ er sie fesseln und über die Grenze nach Vespucci zurückbringen."
Die Erzähler machten eine Pause und alle hörten, wie Marc bewundernd zwischen den Zähnen herauspresste: „Was für ein Mann!"
Da lachten die alten Männer und auch die alten Frauen laut und herzlich, und am lautesten lachte Akandra. Sie gluckste immer noch vor Vergnügen, als ein heller Lichtstrahl durch den Raum zog. Dann nahmen die Älteren den Bericht wieder auf.
„Die Vespucci waren über den Misserfolg ihrer Mission wütend und enttäuscht, aber sie gaben nicht auf. Sie versuchten es nun mit der Zauberei. Die weisesten und mächtigsten Männer des Landes zogen sich für ein ganzes Jahr in den Haupttempel im Innern der Hauptstadt zurück. Dort schufen sie unter Einhaltung seltsamer Riten und Zeremonien mit vereinten Kräften eine Halskette. Ja, an einer Halskette aus Perlen und Edelsteinen arbeiteten die besten Männer des Landes ein ganzes Jahr. Aber es war eine besondere Kette. Sie nahm unwiderstehlichen Einfluss auf ihren Träger. Hatte er sie einmal angezogen, so war er unfähig, sie wieder abzulegen und verfiel in tiefste Liebe zu dem ersten weiblichen Wesen, das er erblickte.
Die Weisen der Vespucci übergaben die Kette den besten Kriegern des Landes. Sie sollten sie im Königspalast der Rutaner so auslegen, dass sie der Herrscher finden musste. Mit den Kriegern ging Pareira. Ich kann hier nicht berichten, welche Abenteuer die vier bei der Erfüllung ihres Auftrages erlebten. Es war ein weiter und gefährlicher Weg ins Herz von Rutan. Die Menschen dort und alle Tiere des Landes hatten nämlich inzwischen erkannt, dass die Feinde von jenseits der Grenze ihrem König nachstellten. Sein Schutz war die zentrale Aufgabe eines jeden Einheimischen geworden. Kein Fremder sollte mehr in den Palast eindringen können. Die Abordnung der Vespucci aber meisterte den schweren Gang. So viel ist von ihrer Mission überliefert: Alle Krieger starben auf dem Weg, und nur Pareira und die Kette erreichten das Ziel.
Ich will es kurz machen. Pareira streifte mit einer List die Kette über den Kopf des jungen Königs. Dann fiel sein Blick auf Pareira und wie beabsichtigt war ihr vom gleichen Moment an verfallen. Seit dieser Zeit ist das Reich der Rutaner in der Hand der Vespucci."
„Das ist schade“, sagte Marc enttäuscht. „Gibt es denn keine Rettung für die Rutaner?"
„Die Sage verheißt, dass das Königreich nur gerettet werden kann, wenn es jemandem gelingt, dem König die Kette wieder abzustreifen. Dies ist aber so gut wie unmöglich. Er wird von seinen eigenen Landsleuten und natürlich von den Vespucci streng bewacht, und er tötet jeden ohne Zögern, der seiner Kette zu nahekommt. Außerdem ist da noch Pareira, die mit ihm lebt und ebenfalls aufpasst."
„Eine traurige Geschichte“, meinte Akandra, „doch warum habt ihr sie uns erzählt?"
„Weil ihr davon betroffen seid! Weil deine Mutter wegen dieser Geschichte gestorben ist!"
Ungläubig und verwirrt starrte das Mädchen die alten Leute an, sagte aber nichts. Lange herrschte Schweigen, bis die Älteren fortfuhren: „Die Vespucci sind mit ihrem Sieg über die Rutaner nicht zufrieden. Sie möchten die ganze Welt beherrschen. Schon viele Jahrhunderte blicken sie begehrlich auf andere Länder und Kontinente. Nur ihre Kriege mit den Rutanern hatten sie bis dahin abgehalten, die ganze Welt zu erobern. Nun, nachdem die Nachbarn in ihrer Gewalt sind, hindert sie niemand mehr, ihre Pläne zu verwirklichen."
„Was gehen die Vespucci die anderen Länder an?" fragte Marc erstaunt. „Und was haben wir mit diesem seltsamen Volk zu schaffen?"
„Ich habe schon gesagt, die Vespucci sind der Meinung, dass ihre Art zu leben die einzig richtige ist. Deshalb, so glauben sie, sei es ihre heilige Pflicht, als besonders erwähltes Volk, die Erde zu befreien. Und natürlich wollen sie auch, dies sollte man nicht unerwähnt lassen, den anderen Völkern, wenn sie unterworfen sind, ihre künstlichen Waren verkaufen. Diese geraten dann, um alles bezahlen zu können, in eine Art Sklaverei zu den Vespucci. Dies ist eine völlig neue Form der Weltherrschaft.
Da diese Ziele ihrer Meinung nach große und ehrenvolle Aufgaben sind, dürfen sie auch jedes Mittel dafür einsetzen. Es gibt nichts Verwerfliches, keine Grausamkeit, keine Heimtücke, die sie nicht anwenden würden. Alles rechtfertigen sie mit dem Satz: Es ist im Interesse und dient dem Wohl von Vespucci."
„Diese Vespucci öden mich an!" Akandra stieß die Worte wütend hervor. „Ich will nichts mehr von ihnen hören."
„Du wirst dich aber mit ihnen beschäftigen müssen. Der Einfluss der Vespucci ist überall. Seit vielen Jahren senden sie Agenten rund um den Erdball. Mit ihrer Hilfe lenken sie schon weitgehend die Geschicke der anderen Völker. Ormor ist ein Agent dieses Volkes, und sein Reich eine vorgeschobene Bastion. Dies hat damals im Großen Krieg niemand begriffen. Auch Aramar sah die Wahrheit nicht. Aber wie sollte er auch!"
„Erzählt uns etwas über den Zauberer“, unterbrach Marc an dieser Stelle die Alten. Diese weit ausholende Erzählung begann ihn zu langweilen. Was kümmerten ihn Länder fern von seinem Heimland! Er wollte konkrete Dinge hören, die ihn und seine Heimat betrafen. Für Geschichten war keine Zeit. Dass Vespucci-Agenten die Geschicke in Centratur lenken sollten, schien ihm an den Haaren herbeigezogen.
Die Alten erklärten: „Aramar war lange vor euch und kam lange nach mir. Er weiß viel und weiß doch nichts, aber er weiß wenigstens, wie wenig er weiß. Dies macht ihn weise. Ohne ihn und seine schützende Hand wäre Centratur längst verloren. Er hat sein Leben den guten Wesen dieser Länder gewidmet und nie viel Aufhebens davon gemacht. Ob er euch jetzt retten kann, muss sich erst noch weisen. Alleine wird es ihm sicher nicht gelingen. Bist du zufrieden mit meiner Antwort?"
Enttäuscht schüttelte Marc den Kopf, aber er sagte nichts, und die Gastgeber fuhren fort: „Ormor sollte Centratur für eine Übernahme durch die Vespucci vorbereiten. Aber das wusste er selbst nicht. Er glaubte, seine eigenen Interessen zu verfolgen und war doch nur eine Schachfigur, die andere zogen. Das ferne Volk benutzte ihn und seine Machtgier. Aber, wie ihr wisst, konnte dieser Angriff damals abgeschlagen werden. Ormor verlor damals, weil alle guten und vernünftigen Leute zusammengehalten haben, und weil sich Til und Marcs Vater so wacker geschlagen haben. Mit den kleinen Erits hatten weder die Vespucci noch ihr Diener gerechnet.
Zurzeit machen die Vespucci wieder einen Versuch, in Centratur Fuß zu fassen. Sie haben Ormor wieder befreit, dessen Machtstreben sie hemmungslos benutzen, und er weiß es nicht einmal. Es ist jemand, der alle an Bosheit, Heimtücke und Grausamkeit übertrifft. Er gebietet über Zauberkräfte von großem Ausmaß, und ihm haben sich alle Taugenichtse und finsteren Geschöpfe angeschlossen. Wie Exkremente die Schmeißfliegen so zieht er alles an, was grausam und gemein ist. Die Orokòr habt ihr selbst schon erlebt. Er hat schon den Vorfahren der Menschen und Achajern das Leben schwergemacht.
Immer wieder hat er die Länder mit Krieg überzogen und alle Lebewesen tyrannisiert. Bis er von Erits besiegt und von den Achajern in einen Berg gebannt werden konnte. Man konnte ihn leider nicht töten. Dort wartete er auf seine Zeit. Die Habbas waren mit der Wache des Berges betraut. Derweil saß der furchtbare Alte an einem steinernen Tisch und sein weißer Bart wurde länger und länger. Mit ihm im Fels in völliger Finsternis, halb schlafend, halb wachend, tot und gleichzeitig höchst lebendig, wartete sein gesamtes Heer. Dieses Heer ist das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Wie gesagt, man glaubte diese dunkle und böse Macht in sicherer Verwahrung, und das war sie auch. Doch schon vor vielen Jahren ließ die Wachsamkeit der Habbas nach. Sie wurden alt, die Arme der Krieger schwach und ihr Haar weiß. Keine jungen Leute fanden sich, die ihre Reihen ergänzt hätten. Der Berg war nun zwar nicht ungeschützt, denn noch immer blieben sie im Vergleich mit anderen Menschen mächtige Krieger, aber er wurde anfälliger."
„Wie wurde dieser Mächtige aus dem Berg befreit?" fragte Marc atemlos. „Ich nehme doch an, dass dies geschehen ist."
„Ja, genauso verhält es sich. Während Pareira noch den König der Rutaner umgarnte, waren die Agenten der Vespucci schon unterwegs. Sie suchten die sechs tüchtigsten, aber auch skrupellosesten Kämpfer der Welt und sandten sie zu dem Berg. Die alten Wächter verteidigten sich verbissen und mit großer Tapferkeit, aber sie hatten keine Chance. Zuletzt wurde das Ungeheuer befreit. Als erstes kehrte es auf sein Dunkles Schloss zurück. Dann warf es seine finsteren Netze über Centratur. Damit begann der Untergang."
Die Gesichter der alten Frauen und Männer waren ernst und von tiefer Sorge erfüllt. Auch die jungen Leute schwiegen betroffen. Natürlich hatten sie von dem Zauberkönig gehört. Er war in den alten Sagen vorgekommen. Sein Name rief bei allen Geschöpfen stets tiefes Entsetzen hervor, obgleich jeder seine Existenz bisher für ein schauerliches Märchen gehalten hatte. Diese grauenvolle Gestalt sollte Wirklichkeit sein, sollte hinter dem Überfall auf das Heimland stecken? Die Sage materialisierte zu einem Teil der Gegenwart. Damit mussten die beiden Erits erst einmal fertig werden. Die alten Leute schenkten ihnen ihre Geduld und die dazu nötige Zeit.
Schließlich fasste sich Marc: „Wenn ich euch richtig verstanden habe, so steht hinter dem Zauberkönig ein anderer Wille. Er wurde im Auftrag der Vespucci befreit, damit er Centratur mit Krieg und Unheil überzieht. Später wollen sie, so vermute ich, selbst die Herrschaft übernehmen. Der Zauberkönig ahnt wahrscheinlich gar nicht, dass er nur den Weg bereiten soll. Die eigentlichen Drahtzieher sind demnach die Leute von der anderen Seite der Erde. Kann man ihnen denn nicht Einhalt gebieten?"
„Niemand kann sie aufhalten." Die Stimme des alten Mannes klang dumpf. „Die einzigen, die diesem fürchterlichen Volk bisher ebenbürtig waren, sind die Rutaner. Aber durch Pareira haben die Vespucci sie in ihrer Gewalt. Nun steht niemand mehr zwischen den Vespucci und der Weltherrschaft, und die wird fürchterlich werden."
An dieser Stelle machten die Greise wieder eine lange Pause. Endlich sagte eine der Frauen: „Ich habe lange gesprochen. Nun ist es Zeit zum Essen und zum Ruhen."
„Dazu haben wir keine Zeit“, antwortete Marc hastig. „Wir müssen etwas unternehmen. Es muss etwas geschehen!"
„Es wird etwas geschehen! Doch wisset, alles hat seine Zeit, und jetzt ist die Zeit der Ruhe!"
Die Älteren erhoben sich wie auf einen gemeinsamen Befehl und ihre Gäste taten es ihnen nach. Die Prozession bewegte sich durch die Mitte der hohen Halle. Voraus gingen die Männer, hinterher kamen die Frauen und die Weltkinder liefen in der Mitte. An der Schmalseite des Raumes war ein zweiflügeliges Tor. Es stand offen und gewährte den Blick auf hellen Kerzenschein. Neugierig schritten Akandra und Marc in ein Zimmer mit offenem Kamin. In der Mitte stand ein langer, gedeckter Tisch. Jetzt bemerkten die Erits auch ihren Hunger. Das Frühstück lag schon lang zurück.
Man nahm Platz und alle sprachen dem Wein und den Speisen kräftig zu. Geredet wurde während des Essens wenig. Einmal wollte Marc mit einer Frage das Gespräch aus der großen Halle wiederaufnehmen, aber man gebot ihm Schweigen. Hier werde über diese Dinge nicht gesprochen, sagte man. Die Heiterkeit dieses Ortes dürfe nicht beeinträchtigt werden.
„Ich dachte nicht, dass die Unterwelt heiter sein kann“, warf Akandra ein.
Man entgegnete dem kecken Einwurf mit der ernsten Frage: „Warum sollte sie es nicht sein?"
„Nun, vielleicht wegen all die schlimmen Ereignisse, die oben in der Welt geschehen? Oder seid ihr etwa heiter, weil ihr von all den Gemeinheiten und Grausamkeiten, mit denen wir uns plagen müssen, nicht betroffen seid?" Marcs Stimme war plötzlich wieder voller Vorwürfe.
„Ich sage es dir noch einmal“, wurde ihm geduldig geantwortet, „ich bin kein Zyniker, und natürlich ist das Leid der Lebewesen in der Oberwelt auch mein Leid. Glaubst du, das Elend meiner Kinder würde mich nicht berühren? Ganz besonders schmerzt es mich, dass die Vespucci, die natürlich auch von mir abstammen, sich so weit von meinem Geist entfernt haben. Und selbst wenn es sich nicht um meine Kinder handelte, so wäre ich doch betroffen, denn niemand ist ganz für sich allein. Jeder ist Teil des Ganzen. Wenn deiner Mutter, Akandra, etwas so Furchtbares zustößt, so trifft es auch mich. Es trifft mich mehr, als ihr ahnen könnt. Größe aber liegt darin, die Heiterkeit nicht zu verlieren. Es hat lange gedauert, bis ich so weit war."
Tränen traten Akandra in die Augen, und bitter antwortete ihr Begleiter: „Wenn ich so weit vom Ort des Geschehens entfernt wäre wie ihr, dann könnte ich mir auch eure Abgeklärtheit und Würde leisten."
Stille breitete sich nach diesen bösen Worten über der Tafel aus. Dann sagte die Frau, die rechts neben Marc saß: „Mitleid und feste Gesinnung schließen einander nicht aus."
So etwas Ähnliches, überlegte Akandra, hatte sie vor nicht allzu langer Zeit schon einmal gehört.
Man begab sich in einen Nebenraum, in dem bequeme Stühle standen. Während sich alle niederließen, ergriff einer der Männer eine Flöte. Das klare, helle Lied blieb gleichsam im Raum stehen, und Marc, der Musik hauptsächlich vom Singen und Pfeifen kannte, war ganz ergriffen. Diese Musik klang so ganz anders als die Trompeten und Trommeln, die auf den Volksfesten im Heimland die trunkenen Erits unterhielten.
Plötzlich stand Akandra auf und sang. Sie sang ein einfaches Lied, das ihr Vater sie einst gelehrt hatte. Es war so schlicht, dass sie sich ein wenig schämte, es hier vor den Älteren vorzutragen. Aber irgendetwas drängte sie, und sie gab diesem Drängen nach.
Es war ein Lied aus ihrer Kindheit. Ihr Vater, Marrham von Hagen, hatte es ihr oft vorgesungen. Er selbst hatte die Weise einst in Whyten gehört. Dort hatten die Menschen das Lied in der Nacht vor der großen Schlacht gegen die Heere des Herrschers von Darken angestimmt. Sie hatten damit ihren furchtsamen Herzen Mut gemacht, und Marrham war sein Leben lang von der Macht dieses schlichten Gesangs fasziniert geblieben.
„Die Nacht, sie muss nicht dunkel sein,
der große Schmerz vergeht.
Ist auch mein Mut bis jetzt noch klein,
mein Wille dennoch steht!