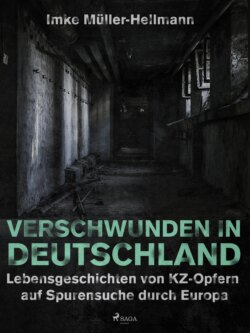Читать книгу Verschwunden in Deutschland - Imke Müller-Hellmann - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Neuengamme
ОглавлениеNeuengamme liegt am Ostrand der Stadt Hamburg an einem Nebenarm der Elbe. Der Zug braucht vom Hauptbahnhof bis Bergedorf zehn Minuten und von da ab fährt ein Bus. Er überquert eine Autobahnbrücke und dann beginnen die Wiesen, von Kanälen durchzogen, die unter einem weiten Himmel liegen, der hellblau ist heute, ohne Wolken.
Der Bus passiert eine Flussbrücke und erreicht das Dorf, das beschaulich wirkt. Links und rechts alte Bauernhöfe, reetgedeckt, grüne Fensterläden, Jahreszahlen und Segenswünsche über den Türen. Gewächshäuser stehen in zweiter Reihe und der Bus überholt einen Traktor, der dafür rechts ranfahren muss. Hinter dem Dorf liegen Äcker, aufgebrochene Erde, grobe Schollen, und am Horizont stehen Windräder, fünf oder sechs an der Zahl, und nur das Windrad ganz rechts dreht sich langsam.
Ich sitze allein im Bus und für einen Tag Anfang März ist es außergewöhnlich warm. Ich krempele die Ärmel des Pullovers hoch und dann sehe ich die langgezogenen Klinkergebäude am Ende des Feldes. Kälte kriecht mir den Rücken hinauf und packt im Nacken fest zu; noch nie habe ich die Gebäude eines ehemaligen KZs besucht. Der Bus biegt ab und hält, ich blicke geradeaus, die Fahrerin dreht sich um. Ob ich nicht zur Gedenkstätte wollte, fragt sie mich, sie hat die Sonnenbrille abgenommen und blickt mich misstrauisch an. Ich nicke, sie macht die Türen auf, ich greife den Rucksack und stehe draußen.
Das Gelände ist groß. Zwei lange Gebäude stehen sich gegenüber und zwischen ihnen sind die einstigen Häftlingsblocks angedeutet: Aufgeschichtete Steine, handhoch, die von niedrigen Zäunen eingefasst sind. Es ist ein weiter Platz und es ist still. Ich setze mich auf eine Stufe, in der Ferne sind die Rufe einer Schar Kraniche zu hören, die Richtung Nordosten ziehen, sehr weit oben. Ein Übersichtsplan zeigt die Lage der ehemaligen Produktionsstätten der Zwangsarbeit: Klinkerwerk und Rüstungshallen, den Stichkanal und das Hafenbecken, dazu SS-Hauptwache und -garagen. Eingezeichnet sind auch die Fundamentreste des Arrestbunkers, ein Mahnmal und das Haus des Gedenkens.
Ich laufe über den Platz, betrete ein Klinkergebäude, »Ehemaliger Waschraum«, steht auf dem Schild an der ersten Tür, der Gang ist lang und alle Fenster stehen weit auf, ein Sommertag mitten im März, ich bin die einzige Besucherin heute. »Da lang«, sagt der Mann im Eingangsbereich und streckt müde einen Arm in eine Richtung aus. Ich laufe an nachgebauten Stockbetten vorbei, an gestreifter Häftlingskleidung und an Bildern, die Szenen des Lageralltags zeigen, die Inhaftierte gemalt haben. Auf großen Stoffbahnen sind Zitate aus Briefen oder Interviews von ehemaligen Häftlingen zu lesen: »Harret die Weile noch aus, bald ist der Kreis wieder rund und der Mensch wieder gut«, zitiert Reinhold Meyer, ein Mitglied des Hamburger Zweigs der »Weißen Rose«, in seinem letzten Brief den Dichter Martin Beheim-Schwarzbach. Auf Tischen liegen kleine rote Ordner, die Einzelbiografien erzählen, lachende und ernste Gesichter schauen von den Umschlagdeckeln. Die Wände der Räume sind weiß, der Boden beige und die Fenster sind ebenso weiß. Ich überfliege die Bilder und Zahlen, auf großen Plakaten wird die Geschichte des Lagers erzählt.
Das KZ wurde 1938 als Außenlager des KZs Sachsenhausen errichtet, 1940 wurde es eigenständig. Das SS-Unternehmen Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH kaufte das 50 Hektar große Gelände mit der stillgelegten Ziegelei der Stadt Hamburg ab und die Stadt unterschrieb einen Vertrag über 20 Millionen Ziegel im Jahr für neue Prachtbauten am Ufer der Elbe.
1938 waren es 100 Häftlinge und 1940 knapp 3000, am Ende des Jahres waren 430 von ihnen tot. Die Häftlinge bauten das Lager, gruben einen Stichkanal zum Elbseitenarm, bauten Ton in den Gruben ab und brannten die Klinkersteine.
1941 kamen für die Arbeit 1002 Häftlinge aus Auschwitz, später dann belgische und niederländische Widerständler und Kommunisten, die schnell verstarben, »Vernichtung durch Arbeit« nannten die Nationalsozialisten das. 1000 sowjetische Kriegsgefangene wurden in separate Baracken gesperrt, sie arbeiteten nicht, sie verhungerten.
Anfang 1942 kam es zu einer Epidemie, der 1000 Menschen erlagen, und dann wurde das »SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt« eingerichtet, das nun darauf drängte, dass die Inhaftierten nicht allzu früh sterben sollten, weil die KZs von wirtschaftlicher Bedeutung seien. Die Häftlinge bekamen mehr Nahrung und mussten Motoren, Torpedos, Zeitzünder, Tarnnetze, Patronenkästen und automatische Gewehre bauen. Ende 1942 waren 10 000 Häftlinge in Neuengamme, von ihnen starben 3140 im Laufe des Jahres, Arbeitsunfähige waren nach Dachau deportiert worden, jüdische Häftlinge nach Auschwitz und sowjetische Häftlinge hatte man mit Gas umgebracht, ebenso wie andere versehrte Kriegsgefangene.
1943 begann man, die Häftlinge außerhalb des Lagers zur Arbeit zu zwingen, wie zum U-Boot-Bunkerbau in Bremen oder zur Trümmerbeseitigung in Hamburg. Im Sommer des Jahres 1943 waren 9500 Menschen inhaftiert, 2700 von ihnen in provisorischen Außenlagern.
1944 erhöhte sich die Anzahl der militärischen Niederlagen der Wehrmacht und die Versorgungslage in Deutschland wurde prekär. Die Lebensbedingungen im KZ verschlimmerten sich und in diesem Jahr wurden 25 000 Menschen aus 28 Nationen in das Lager verschleppt. Tausende von ihnen aus dem KZ Compiègne in Frankreich, das wegen der Landung der Alliierten in der Normandie geräumt worden war, 1030 Männer kamen aus Lettland, 500 aus Bergen-Belsen, die gegen entkräftete Häftlinge »ausgetauscht« worden waren und 589 Männer aus Putten. Putten ist ein Ort in den Niederlanden, der als Vergeltung für einen Anschlag auf ein Auto mit vier deutschen Offizieren, von denen einer starb, von der deutschen Wehrmacht zerstört wurde. Alle 661 männlichen Bewohner wurden in KZs deportiert, sechs starben in Engerhafe, zurück nach Putten kehrten 49. Am Ende des Jahres betrug die Zahl der Häftlinge 48 800, 8000 Menschen waren verstorben, und ein SS-Arzt hatte medizinische Versuche an Kindern und Erwachsenen durchgeführt, danach wurden die Probanden erhängt. Es gab eine Bibliothek mit 800 Büchern – und ein Lagerbordell als »Anreiz für höhere Leistungen«. Heinrich Himmler hatte dies angeordnet, und wer diese Idee in Frage stelle, der würde weltfremd sein, so steht es in der geheimen Verschlusssache zu diesem Befehl.
1945 waren es 49 000 Häftlinge, unter ihnen 10 000 Frauen, und im März begann die Räumung des Lagers, die Häftlinge wurden auf die »Todesmärsche« gezwungen oder in Zügen evakuiert, 20 000 von ihnen nach Bergen-Belsen, Sandbostel und Wöbbelin, viele Tausende verhungerten. Ein Häftlingszug wurde vom britischen Militär bombardiert, 2000 Menschen starben, und 6400 Häftlinge kamen auf den Schiffen Cap Arcona und Thielbek durch englische Bombardements in der Neustädter Bucht ums Leben. Die Akten des Konzentrationslagers wurden vernichtet, um die Spuren zu verwischen, das Lager wurde aufgeräumt und teilweise demontiert.
In einem Raum der Ausstellung sind auf einer großen Europakarte alle KZs eingezeichnet, auch die Vernichtungs- und Außenlager. Im Zentrum ist Deutschland. Es sind kleine farbige Dreiecke, die das ganze Land überziehen, in dem 915 000 Männer in die SS eingetreten waren, 37 000 davon in die »Totenkopfverbände«, das Wachpersonal der KZs.
Einige Räume weiter hängt eine ähnliche Karte, diesmal von Norddeutschland. Es sind Kreise, die für die 86 Außenlager von Neuengamme stehen, und die Namen der Firmen sind aufgelistet, die die Arbeitskraft der Häftlinge in Anspruch nahmen: Hew, Grün & Bilfinger, Wayss & Freytag, Blohm & Voss, die Borgward-Werke, Drägerwerk, Rheinmetall, die Stadt Bremen und viele mehr. 1945 waren es 40 000 Menschen, 28 000 Männer und 12 000 Frauen, die in den provisorischen Barackenlagern und in leer stehenden Gebäuden im ganzen Norden des Landes lebten, in der Rüstungsproduktion und in Industrieanlagen, bei Bauvorhaben, Instandsetzungen und der Trümmerbeseitigung schufteten.
Sechs der 86 Außenlager waren die Panzergraben-Kommandos in Meppen-Versen und Meppen-Dalum, Husum und Ladelund, Hamburg-Wedel und Engerhafe. Tausende von Zivilarbeitern – Schuljungen und nicht wehrpflichtige Männer – hatten nicht ausgereicht, um die Befestigungsarbeit des »Friesenwalls« zu leisten. Im letzten Ausbaubericht für den Seekommandantenbereich Ostfriesland vom 22.12.1944 ist notiert, dass um Aurich herum ein 45,44 km langer Graben und insgesamt 15,8 km Annäherungsgräben ausgehoben, 10 392 Minensperren, 1436 MG-Feuerstellungen, 176 Geschütz- und Flakfeuerstellungen, 10 Unterschlupfe, ein Unterstand und 698 Ringstände angelegt wurden. Ostfriesland galt nach einer Meldung des »Führungsstabs Nordseeküste« an das Oberkommando des Heeres vom 3. Januar 1945 als »bedingt verteidigungsfähig«, die »Rundumverteidigung Aurichs« als 100 Prozent intakt.
In dem Ausstellungsraum, der von den Außenlagern berichtet, sind Fotos zu sehen und Namen zu lesen, von Ortschaften und Betrieben. Eine Zeichnung von Hans Peter Sørensen zeigt viele Menschen mit gelben Kreuzen auf dem Rücken, die mit Spaten in einem Graben stehen und von einem Mann in Uniform und mit einem Knüppel angetrieben werden. Die Zeichnung zeigt den Panzergrabenbau in Hamburg, 150 Dänen sind bei dem Einsatz dabei gewesen, es ist das zehnte Bild von Sørensens Neuengamme-Mappe von 1948. Auch in Engerhafe trugen die Häftlinge gelbe Kreuze auf ihren Rücken, »Gelbkreuzler« wurden sie deshalb genannt. Ich finde eine Mappe über das Außenlager Engerhafe, mit einem Bericht aus der Kirchenchronik von Pfarrer Janßen, der ab Ostern 1944 die ehemals unbesetzte Pfarrstelle übernahm. Er berichtet von der Erweiterung des Kirchhofs um den neuen Friedhofsteil hinter dem Glockenturm und dass sich das Barackenlager, sobald es mit Gefangenen belegt worden war, zu einer »großen Not der Gemeinde« gestaltete. Die Bewachung sei durch nicht voll kriegsverwendungsfähige Marinesoldaten erfolgt und die Aufsicht hätten »Kapos«, deutsche Sicherheitsverwahrte, gehabt. Die 600 Schwächsten der Häftlinge seien nach sechs Wochen wieder abtransportiert und dem Totengräber insgesamt 187 Tote gemeldet worden. Pfarrer Janßen schließt mit den Worten: »Gemeindeglieder beobachteten empört Misshandlungen und nicht zu verantwortende Missstände. Ich darf sagen, dass die ganze Gemeinde« – an dieser Stelle ist das Zitat unterbrochen – »empört war. Im Winter stand das Lager leer.«
187 Tote, schreibt Janßen, seien bekannt. Auf dem Gedenkstein in Engerhafe ist es ein Name mehr. Ich habe die Namen auf einem Zettel in meiner Hosentasche, ich habe sie vorgelesen, auf Lesungen, alle 188 hintereinander, immer war es sehr still im Raum. Nach jedem Vortragen habe ich mich gefragt, was das für Menschen waren, die in Engerhafe ihr Leben ließen, was ihre Lebensgeschichten waren, wer sie vermisste. Die Nachfahren, so dachte ich, müssten doch irgendwo sein, irgendwo ihre Kinder. Ich würde sie gerne treffen und nach ihren Vätern und Großvätern fragen. Doch wo finde ich sie?
Ich verlasse das Ausstellungsgebäude und überquere den Platz. Die Sonne steht tief, Güllegeruch liegt in der Luft, und ich laufe die Straße, auf der auch der Bus gefahren war, ein bis zwei Kilometer hinunter. Sie ist schnurgerade, links trennen Eichen den Asphalt von dem in der Nachmittagssonne liegenden Feld und rechts trennen ein Graben und eine Reihe von Pappeln die Straße vom KZ-Gelände. Ein Wachturm ist erhalten und das alte Klinkerwerk. Auf einer Gedenktafel steht, dass es 106 000 Menschen waren, die das KZ durchliefen, und mindestens 42 900 ließen dabei ihr Leben. Andere Schätzungen sprechen von 55 000. Ein Weg führt zu einer Figur aus Bronze, sie liegt verdreht auf dem Boden, die Rippen schauen hervor und der Kopf liegt auf der Erde. Auf den Knien stützt sie sich ab, ein Arm ist ausgestreckt und die Finger der Hand sind gespreizt. »Der gestürzte Häftling« heißt die Skulptur von Françoise Salmon, eine französische Bildhauerin, die mehrere KZs überlebte. Eine hohe Stele daneben trägt große Lettern: »Euer Leiden, euer Kampf und euer Tod sollen nicht vergebens sein.«
Das Haus des Gedenkens ist ein quadratischer Raum, der eine umlaufende höhere Ebene hat, an deren dunkelrot gestrichenen Wänden meterlange weiße Stoffbahnen hängen. Alle bekannten Namen der Toten sind schwarz und chronologisch nach Todestagen untereinander aufgedruckt. An einigen Stoffen hängen Fotos und Blumen oder Grüße auf Papier. Cinja van Laaten schreibt in Kinderschrift an Johann van Laaten: »Du hast alles richtig gemacht. Ruhe in Frieden. Tod mit 32 Jahren.« Unten im Raum gibt es einen Tisch, auf dem vier in weiß-beiges Leinen gebundene, fotoalbenähnliche, schwere Bücher liegen: Die Totenbücher des KZs Neuengamme. Den Toten I bis IV steht auf den abgegriffenen Einbänden, jedes Buch hat 500 Seiten. Ich ziehe den Zettel aus meiner Hosentasche, ich falte ihn auseinander, setze mich und fange an: Bertulis Veinsberg. Ich finde ihn genauso geschrieben, wie auf dem Stein in Engerhafe, dazu die Information, dass er am 31. August 1903 in Lettland geboren wurde und dass er am 20. Oktober 1944 starb. Der zweite Tote in Engerhafe war Cervil Paul Edjes. Ich finde ihn nicht, vielleicht ein Buchstabendreher, ich überfliege seitenweise Eintragungen mit E, es dauert sehr lange. Edzes, das könnte er sein, Gerrit Paul Edzes, Buchhändler, geboren am 24. Dezember 1913 in Groningen, gestorben am 31. Oktober 1944. Ich notiere alles mit Bleistift auf den Zettel hinter den Namen. Dann der dritte, Chaiw Jorkelski. Ich suche, ich finde ihn nicht, womöglich wieder ein Buchstabendreher, ich überlege, wie man die Buchstaben in welche Richtung verdreht haben könnte, blättere und überfliege, endlich habe ich ihn, Chaim Iskolski, Bäckermeister aus Mir, geboren am 20. Mai 1904. Der Museumsangestellte tippt mir auf die Schulter, es ist Schließzeit. Ich habe drei von 188 Namen gefunden und dafür über eine Stunde gebraucht, ich werde noch Tage an diesen Büchern verbringen. Ich frage ihn: »Gibt es die Namen auch im Netz?« Er schüttelt den Kopf, aber verschwindet in seinem Aufseherhäuschen und kommt mit einer CD-ROM wieder, die ich erwerbe und mit der ich viele Abende zu Hause verbringen werde.
Der Aufseher schließt hinter mir die Tür und ich setze mich auf die Bank in der Bushaltestelle. Die Sonne scheint tief über dem Feld und ein Traktor fährt in der Ferne langsam vor einer Baumreihe entlang. Ich habe die Arme vor der Brust verschränkt, ich sehe der Sonne lang zu, und dann fasse ich einen Entschluss: Ich werde Nachfahren finden, ich werde sie besuchen und sie nach den Lebensgeschichten ihrer Angehörigen fragen.