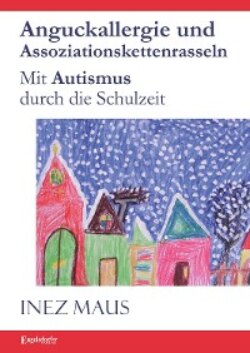Читать книгу Anguckallergie und Assoziationskettenrasseln - Inez Maus - Страница 8
Der, die, das – was?
ОглавлениеDie Weisen sagen: Beurteile niemand, bis du an seiner Stelle gestanden hast.
Johann Wolfgang von Goethe
Benjamins Vorschullehrerin, die wir für immer in guter Erinnerung behalten werden, hatte recht gehabt. Unser Sohn nahm an der Schulaufführung für die diesjährigen Schulanfänger teil und das machte uns sehr stolz, obwohl wir uns diese Darbietung aus Platzgründen nicht anschauen durften. Er spielte einen Hahn in einem Waldmärchen und ich hatte für ihn ein Kostüm aus weichem Baumwollstoff genäht, sodass seine Erzieherin sogar „Recht vielen Dank für das wunderschöne Kostüm!“ in sein Mitteilungsheft schrieb. Es war Benjamins bisher größter Auftritt, wobei er schauspielern und einige Male „Kikeriki!“ rufen musste. Noch vor einem Jahr war dies für uns nahezu unvorstellbar gewesen.
Anabel, ein Mädchen aus Benjamins Klasse, bescherte unserem Sohn seine allererste Einladung zu einem Kindergeburtstag. Ich rief daraufhin Anabels Mutter an, um mit ihr über meinen Sohn zu reden und um ihr zu verstehen zu geben, dass Benjamin nicht allein auf der Party bleiben wird. Sie erwiderte, dass Anabel eine Einzelfallhelferin habe, die bei der Kinderbetreuung auf der Feier helfen würde, und so vereinbarten wir, dass ich dann operativ entscheiden werde, ob ich bleibe oder gehe. Dies war wieder eine neue Herausforderung für uns, obwohl Benjamin schon viele Geburtstagspartys seiner Brüder mehr oder weniger durchlitten hatte. Solche Feiern zu Hause mit fremden Kindern ließen sich nur durchführen, wenn Leon anwesend war, weil Benjamin an derartigen Tagen eine Person für sich zum Abschirmen, Aushalten oder auch manchmal zum Mitmachen benötigte, wie beispielsweise bei LEGO-Bauwettbewerben oder beim Puzzeln auf Zeit. Anabel, ein spastisch gelähmtes Mädchen im Rollstuhl, hatte eine gesunde Zwillingsschwester. Die Mutter der beiden Mädchen war alleinerziehend. Während Anabel nur Benjamin eingeladen hatte, freute sich ihre Schwester Isabel auf vier Gäste. Wir würden also auf sechs unbekannte Personen treffen und mit diesen den Nachmittag verbringen, das war eine enorme Herausforderung.
Unterwegs versetzte mich mein Sohn in Erstaunen, weil er für jedes Mädchen eine einzelne Rose kaufen wollte. Woher hatte er nur solche Ideen? Vielleicht aus einem Trickfilm? Anabel war über diese Rose hocherfreut, sie sagte, dass wäre ihr schönstes Geburtstagsgeschenk, und ihre Mutter zeigte sich erleichtert über meine Anwesenheit, da die Einzelfallhelferin plötzlich erkrankt war. Beim Essen des selbst gebackenen Geburtstagskuchens fiel Benjamin wie immer durch sein enormes Esstempo und die verzehrte Menge auf, aber ich konnte ihn nur am Tisch halten, wenn er aß, denn sonst würde er zum Fernseher laufen, einen Videofilm aus dem kleinen Regal darunter ziehen und damit gegen den Fernseher klopfen, so wie er es schon kurz nach der Begrüßung getan hatte. Isabels Gäste witzelten über Benjamins Tischmanieren, aber mein Sohn reagierte darauf nicht und ich war unschlüssig, wie ich mich jetzt verhalten sollte. Noch ehe ich einen Entschluss fassen konnte, wechselten sie das Thema und begannen, sich haarsträubende Witze über Behinderte zu erzählen. Ich fand das völlig unangemessen und wäre am liebsten explodiert, aber sowohl Anabel als auch ihre Mutter blieben ganz ruhig und warteten ab, bis das Thema zu den Pokémons gewechselt wurde. Also verhielt ich mich auch ruhig, schließlich war es nicht Benjamins Party. Die nachfolgenden Spiele lehnte mein Sohn konsequent ab, da aber Anabels Mutter ihm ihrerseits den Fernseher verweigerte und ihm stattdessen Isabels leicht chaotisches Zimmer zum Spielen anbot, waren alle damit zufrieden. Später gab es zu Benjamins Freude dann doch noch einen kurzen Trickfilm und ein lustiges Spiel, welches er mochte. Bei diesem Spiel lagen verschiedene Süßigkeiten auf dem Tisch und ein Kind musste den Raum verlassen, während die verbleibenden Kinder eine Süßigkeit auswählten. Dann wurde das Kind wieder hereingerufen und durfte so lange Süßigkeiten vom Tisch nehmen, bis es auf die ausgewählte Süßigkeit zeigte und damit das nächste Kind an der Reihe war. Die Regeln hatte Benjamin verstanden, da er aber glaubte, dass es ein bestimmtes Abräumprinzip gibt, testete er verschiedene Varianten: Er versuchte rasend schnell zu sein, er entfernte eine Sorte nach der anderen und in der dritten Runde probierte er eine farbliche Abfolge. Es frustrierte ihn, dass er das Prinzip nicht verstand, weil er keine gültige Regel finden und das Zufallsprinzip nicht akzeptieren konnte. Die gerade fertig gewordenen Pommes frites verhinderten glücklicherweise, dass die Situation eskalierte. Anabels Mutter dankte mir für meine Hilfe und fragte beim Verabschieden, ob Benjamin denn einmal zu Anabel zum Übernachten kommen wolle, weil doch alles sehr gut gelaufen sei. Ich war so überrascht von diesem unerwarteten Angebot, dass ich schnell erwiderte, ich müsse erst in Ruhe mit Benjamin darüber reden. Sie wandte sich meinem Sohn zu: „Und Benjamin, hat es dir bei uns gefallen?“ „Gut“, war seine Antwort.
Wenige Wochen später kam tatsächlich ein gemeinsames Wochenende von Benjamin und Anabel zustande. Nicht nur unser Sohn war furchtbar aufgeregt, sondern auch Anabel, die Benjamin mittlerweile als „meinen Freund“ bezeichnete, denn bevor wir losgingen, rief ihre Mutter an und fragte nach, ob wir etwas eher kommen könnten. Voller Optimismus verteilten wir unsere Randkinder auf die Großeltern, denn wenn alles klappte, dann hätten wir unseren ersten gemeinsamen freien Abend seit Benjamins Geburt. Nachdem wir mit Anabels Mutter noch eine Tasse Kaffee getrunken hatten, drängte uns Benjamin zur Tür und wir fragten uns, ob er sich wirklich der ganzen Tragweite seiner Handlungen bewusst war. Bis zum frühen Abend warteten wir ängstlich und angespannt auf einen Anruf, der uns auffordern würde, dass wir Benjamin wieder abholen sollten, weil er nach Hause wollte oder weil er Anabels Mutter überforderte. Aber das Telefon blieb stumm und wir fühlten uns wie im siebenten Himmel, denn wir hatten so viel nachzuholen und jede Stunde war kostbar. Wir fuhren in die Stadt, um Freunde zu besuchen und mit ihnen gemeinsam zu speisen. Am Sonntagmorgen zerriss kein Kind und kein Wecker unseren Schlaf und nachdem wir von selbst irgendwann aufgewacht waren, frühstückten wir im Bett. Dieser eine freie Abend füllte unsere Batterien wieder auf und ließ uns abermals mutig in die Zukunft schauen.
Am Sonntag nach dem Mittagessen sollte Benjamin wieder abgeholt werden und als ich vor der sandfarbenen Wohnungstür stand, hörte ich die Mädchen zufrieden kichern, sonst nichts. Zu meinem großen Erstaunen wollte Benjamin nicht sofort nach Hause gehen und so beschlossen wir, noch einen ausgedehnten Spaziergang zu unternehmen. Anabels Mutter erzählte, dass es keine wesentlichen Probleme gegeben hatte. Sie war ein bisschen traurig, weil Isabel Benjamin immer wieder in ihr Zimmer gelockt hatte, um mit ihm zu spielen. Damit Benjamin auch bei Anabel blieb, hatte sie zwischendurch einige Male einen kurzen Trickfilm gezeigt. Das Einschlafen war äußerst problematisch verlaufen, was ich ihr aber vorher bereits angekündigt hatte. Da Anabel in der Nacht mehrmals gedreht werden musste und Benjamin davon immer wieder aufgewacht war, hatte sie unseren Sohn den Rest der Nacht in Isabels Zimmer schlafen lassen. Beim Durchqueren einer Kleingartenanlage schüttete Anabels Mutter völlig unerwartet ihr ganzes Herz vor mir aus. Auf diesem Spaziergang freundeten wir uns miteinander an und stellten fest, dass uns mehr verband als nur unsere problembelasteten Kinder. Beide Mädchen wünschten sich einen weiteren Besuch von Benjamin und so erkundigte sich Anabels Mutter beim Abschied: „Benjamin, möchtest du uns wieder einmal besuchen?“ Ohne nachzudenken, verkündete mein Sohn: „Später!“
Nach diesen Erfolgserlebnissen hielt ich die Zeit für gekommen, auch Benjamins Geburtstag mit „richtigen“ Gästen zu feiern. Also fragte ich meinen Sohn erwartungsfroh und ohne Umschweife: „Benjamin, welches Kind aus deiner Klasse möchtest du zu deinem Geburtstag einladen?“ Ich hielt es für sinnvoll, mit einer kleinen, überschaubaren Party zu beginnen, und erwartete, dass er „Anabel“ antworten würde. Stattdessen schleuderte er mir „Alle!“ entgegen. Jetzt hatte ich ein Problem, denn fünf der sieben Kinder seiner Klasse waren so schwer behindert, dass sie ständige Hilfe benötigten und nicht allein auf einer Geburtstagsparty bleiben konnten. Außerdem war unser Haus alles andere als behindertengerecht. Ich musste also eine andere Lösung finden. Nach einer Weile kam mir die vermeintlich rettende Idee: Wir könnten doch nachmittags in der Schule feiern, da wäre dann auch für die angemessene Betreuung gesorgt. Ich vereinbarte einen Gesprächstermin mit Benjamins Erzieherin und erfuhr dabei, dass es nicht möglich war, am Nachmittag in der Schule zu feiern, weil einige Kinder in dieser Zeit Therapiestunden oder Nachhilfeunterricht erhielten. Sie bot mir aber die Sportstunde für kleine Spiele und die darauffolgende Hofpause für das Essen an. Ich nahm den Vorschlag dankbar an, denn Benjamin hatte auf meine Frage, wo er denn feiern möchte, „Nich Hause“ geantwortet.
Die Vorbereitung dieser Geburtstagsfeier stellte eine echte Herausforderung für mich dar, denn ich musste mir eine Menge interessanter Spiele für Kinder ausdenken, welche die verschiedensten Handicaps hatten. Benjamins absolute Lieblingspartyspiele, nämlich der LEGO-Bauwettbewerb und das Wettpuzzeln, schieden leider schon aus. An Benjamins achtem Geburtstag erschien ich zur vereinbarten Stunde in seiner Schule mit einer Fülle hoffentlich guter Ideen, mit Preisen, mit herzhaftem sowie süßem Essen und mit Pascal. Mein jüngster Sohn besuchte zwar seit wenigen Wochen die Vorschule, aber da ich nicht rechtzeitig fertig sein würde, um ihn pünktlich abzuholen, hatte ich ihn für diesen Tag entschuldigt. Mein erstes Spiel war eine Schatzsuche, wo ich vorab ein Kind hinausschickte, um den Schatz von den anderen Kindern verstecken zu lassen. Dann wurde der Schatz nicht wie üblich durch Herumlaufen und Kriechen gesucht, sondern durch gezielte Fragen, welche die Mitspieler mit „heiß“, „warm“ oder „kalt“ beantworteten. Des Weiteren hatte ich einige interessante Geschichten mit Fehlern geschrieben, wo die Kinder bei jeder Ungereimtheit „Halt“ rufen sollten, ein spannendes Quiz … Die Stunde verging schneller, als ich erwartet hatte, und alle schienen ihren Spaß zu haben. Bei dem Spiel „Klappe auf“, wo es darum geht, anhand von sukzessive aufgeklappten Bildausschnitten das Gesamtbild zu erraten, war Benjamin unschlagbar, was nach den ersten zehn Bildern zu einer leichten, aber unverkennbaren Frustration bei seinen Mitstreitern führte. Kurzerhand übertrug ich meinem Sohn die Spielleitung, was ihn sichtlich mit Stolz erfüllte und den anderen Kindern eine Chance einräumte. Je besser die Stunde lief, desto mehr legte sich meine eigene Nervosität, denn schließlich befand ich mich unter den wachsamen Augen von Frau Ferros und Benjamins Erzieherin. Nachdem das letzte Würstchen verzehrt und der letzte Keks vertilgt war, nahte der Beginn der Deutschstunde, sodass ich hektisch begann, meine Sachen zusammenzupacken. Plötzlich fragte mich Frau Ferros: „Haben Sie noch mehr Spiele?“ Natürlich hatte ich noch mehr Spiele vorbereitet, da ich nicht wusste, wie lange die einzelnen Spiele dauern und welche Spiele überhaupt angenommen werden. Frau Ferros meinte daraufhin, dass die Kinder dann weiterspielen dürften. Sie kam überhaupt nicht auf die Idee, mich zu fragen, ob ich eigentlich noch Zeit oder Lust hatte, aber da alle Kinder außer Benjamin jubelten, konnte ich mich dem nicht widersetzen. Mein Sohn schien eher verwirrt von der Änderung des Ablaufes. Da jedoch die Deutschstunde die letzte Stunde des Tages war, versprach ich ihm, dass ich ihn gleich danach nach Hause mitnehmen werde, was seine Wirkung nicht verfehlte.
Diese Geburtstagsfeier beurteilte ich als vollen Erfolg, obwohl ich von Benjamin nicht zweifelsfrei in Erfahrung bringen konnte, ob es ihm gefallen hatte. Richtig glücklich wirkte unser Sohn erst, als er am Nachmittag sein obligatorisches Stück Torte verputzt hatte und damit begann, seine neue LEGO-Welt, dieses Mal eine ägyptische Pyramide, zusammenzubauen. Als wir abends bei unserer täglichen Gute-Nacht-Geschichte dicht gedrängt zusammensaßen, offenbarte mir Benjamin Folgendes: „Mami, ie liebe dir so gerne.“ Ich war von dieser völlig unerwarteten Liebeserklärung so gerührt, dass mir die Tränen literweise in die Augen schossen. Meine Stimme versagte, aber gleichzeitig breitete sich ein wohliges, warmes Empfinden in meiner Brust aus. Pascal und Benjamin umarmend ließ ich meinen Gefühlen einfach freien Lauf, denn viel zu lange hatte ich auf diesen wunderschönen Augenblick warten müssen. Pascal gab mir ein bereits benutztes Taschentuch aus seiner Hosentasche und verkündete selbstbewusst: „Und ich liebe dich auch ganz doll.“ In den folgenden Jahren von Benjamins Grundschulzeit sind wir zu seinen Geburtstagen auf seinen Wunsch hin immer ins IMAX-Kino und danach zu McDonald’s gegangen. Das hatte den Vorteil, dass er Mitschüler einladen konnte, aber sich nur begrenzt um sie kümmern musste, sodass alle auf ihre Kosten kamen.
Mit Beginn des neuen Schuljahres wurde Benjamin in die Arbeitsgemeinschaft Fußball integriert. Einmal pro Woche trainierten die Schüler aller Altersstufen gemeinsam, aber unser Sohn hatte schon Probleme damit, die Mannschaften auseinanderzuhalten, denn die Mitglieder wechselten ständig und unterschieden sich nur dadurch, dass eine Mannschaft die T-Shirts in der Hose trug, die andere darüber. Während des Spiels konnte sich Benjamin weder merken, ob er sein Hemd drinnen oder draußen trug, noch wer zu seiner Mannschaft gehörte. Er ergatterte zwar oft den Ball, aber war dann nicht in der Lage, ihn wieder abzugeben, und verwendete all seine Energie darauf, den Ball zu behalten. Ihm wurde mangelnde Teamfähigkeit vorgeworfen, wir waren uns jedoch nicht sicher, ob er verstand, was da von ihm verlangt wurde. Später kam uns der Gedanke, dass eine alte Fußballweisheit, welche unseren anderen beiden Jungen mehrfach im Sportunterricht mitgeteilt wurde, Benjamins Spielverhalten wahrscheinlich beeinflusste. „Wenn man selbst den Ball hat, kann der Gegner kein Tor schießen“, bedeutete in seiner Logik, den Ball unbedingt behalten zu müssen.
Die Seiten in Benjamins Mitteilungsheft wurden auch im neuen Schuljahr regelmäßig von schwarzen Wolken verdunkelt, was uns nicht weiter gestört hätte, wenn unser Sohn weniger darunter gelitten hätte. Mittlerweile konnte er uns erzählen, dass er diese Unwetterwarnungen bekam, weil er in der Schule die Lehrerin einmal überhört oder des Öfteren nicht still gesessen hatte, und er stellte resigniert fest: „Weil ie das nich kann“. Benjamins Ergotherapeutin bestätigte uns, dass er bedingt durch seinen schwachen Muskeltonus nicht in der Lage sei, längere Zeit still zu sitzen, oder aber dafür so viel Energie aufwenden müsse, dass er zum Schreiben, Lesen, Zeichnen … keine Kraft mehr besitzt. Sie empfahl uns dringend die zumindest zeitweise Benutzung einer Sitzpallone (luftgefüllter Ballstuhl), da rhythmische Auf- und Abbewegungen, die das Kind zwingen, ständig seine Balance neu zu finden, nachgewiesenermaßen das Lernvermögen positiv beeinflussen. Frau Ferros hatte dafür kein Einsehen und wir benötigten fast ein Jahr, um dieses Anliegen in die Tat umzusetzen. Trotzdem reglementierte Frau Ferros die Benutzung der Pallone streng, sodass sie in der Schule die meiste Zeit ungenutzt herumstand. Zu Hause dagegen machten wir äußerst positive Erfahrungen mit dieser Sitzgelegenheit, sowohl am Schreibtisch als auch am Computer.
Genau eine Woche stand Benjamin und seinen Mitschülern zur Verfügung, um ein nettes, kleines Herbstgedicht auswendig zu lernen, für unseren Sohn war dies sein erstes Gedicht. Die anderen Kinder hatten schon früher im Kindergarten oder in der Vorschule kurze Reime auswendig gelernt, aber Benjamin war dazu aufgrund seiner arg verzögerten Sprachentwicklung nicht in der Lage gewesen. Mit viel Geduld, Fleiß und Zeitaufwand trichterten wir unserem Sohn die folgenden Zeilen ein:
(Hermann Siegmann)1
Herbsträtsel
Ein Igel saß auf einem Blatt,
das wie die Hand fünf Finger hat,
auf einem Baum.
Du glaubst es kaum!
Der grüne Igel, stachelspitz,
fiel auf den Kopf dem kleinen Fritz,
von seiner Mütze
in die Pfütze.
Da war es mit dem Igel aus.
Er platzte, und was sprang heraus
mit einem Hops?
Ein brauner Mops!
Die erste Hürde, die es dabei zu nehmen gab, bestand darin, Benjamin zu erklären, dass dieses Gedicht nicht von einem Igel handelte. Er konnte einfach nicht verstehen, warum der Igel auf einem Baum saß und warum er grün und nicht graubraun sein sollte. Nachdem unser Sohn mithilfe von Leons Erklärungskünsten und einer Reihe Zeichnungen, die ich zur visuellen Unterstützung angefertigt hatte, akzeptierte, dass der grüne Igel eine poetische Umschreibung für eine stachelige Kastanie darstellte, folgte in der Mitte des Gedichtes die komplette Verwirrung. Warum wandelte sich denn nun die Kastanie, die als grüner Igel umschrieben wurde, plötzlich in einen braunen Mops und was war überhaupt ein brauner Mops? Und wer war der kleine Fritz und wo kam der eigentlich plötzlich her? Fragen über Fragen und am Ende unseres Erklärungsmarathons wussten wir nicht, wie viel Benjamin nun wirklich verinnerlicht hatte und zu wie viel Prozent er sich einfach in sein Schicksal fügte und dieses Wortwirrwarr zu behalten versuchte. Aufgrund seiner schwerwiegenden Artikulationsprobleme waren Worte wie „stachelspitz“, „Fritz“, „Mütze“ und „Pfütze“ für unseren Sohn nahezu unaussprechbar. Schließlich vermochte er aber dank seines Ehrgeizes das gesamte Gedicht einigermaßen verständlich zu rezitieren und wir waren wieder einmal stolz auf Benjamin. Pascal, der häufig um uns wuselte, wenn wir mit Benjamin irgendetwas übten, zeichnete nicht nur seinen eigenen, entzückenden Bilderzyklus zu den Versen, sondern lernte das gesamte Gedicht fehlerfrei einfach so nebenbei. Frau Ferros beurteilte Benjamins Leistung deutlich weniger euphorisch als wir, wertete seinen Vortrag mit einem „ganz gut“, bemängelte seine Undeutlichkeiten und trug ihm deshalb auf, das Gedicht abermals zu lernen. Für uns alle war dies ein herber Rückschlag, welcher sich noch zweimal wiederholte und im Mitteilungsheft wie folgt kommentiert wurde: „Benjamin hat Schwierigkeiten, das Z zu sprechen. Er verwechselt es mit sch oder ch. Bitte achten Sie auch zu Hause auf die korrekte Aussprache.“ Vielleicht waren wir inzwischen ein wenig dünnhäutig und überempfindlich geworden, aber bei all den Hinweisen oder auch Anweisungen, die uns Frau Ferros gab, beschlich uns das unangenehme Gefühl, dass sie uns für faule Eltern hielt und dass sie glaubte, unsere scheinbaren Versäumnisse oder unsere angebliche Inkonsequenz oder unser vermeintliches Desinteresse würden Benjamins Schwierigkeiten verursachen.
Anderes Lehrpersonal schätzte unseren Sohn und seine Leistungen völlig anders ein. Eine Vertretungslehrerin, welche die Klasse während einer zweiwöchigen Krankheit von Frau Ferros unterrichtete, lobte Benjamin in den höchsten Tönen und verlor kein negatives Wort über unseren Sohn. Und auch Benjamins Sprachtherapeutin hob immer wieder hervor, dass sich unser kleiner Schüler in ihren Therapiestunden sehr viel Mühe gebe. Die Sprachtherapeutin nutzte sehr geschickt Benjamins Interessen aus, um ihm kleine Erfolge abzutrotzen. Sie ließ ihn zu Beginn jeder Stunde erzählen, was er wollte, völlig egal, ob er dabei nur von LEGO-Bausätzen oder von Computerspielen redete. Manchmal berichtete Benjamin aber auch von anderen Dingen wie beispielsweise unseren Ferienbildern. In den vergangenen Sommerferien hatte ich die Idee gehabt, unsere Kinder Bilder von wichtigen Ereignissen zeichnen zu lassen und am Ende der Ferien eine kleine Galerie zu gestalten, um die besten Kunstwerke zu prämieren. Das half vor allem Benjamin dabei, sich an seine Ferienerlebnisse zu erinnern, und es gab den weniger angefüllten Tagen eine Struktur. Diese Idee kam bei meinen Kindern so gut an, dass sich das Zeichnen von Ferienbildern zu einer langjährigen Tradition entwickelte und von meinen Söhnen immer weiter ausgebaut wurde, was die verwendeten Techniken und die Themenwahl betraf. Nachdem Benjamin seiner Sprachtherapeutin mit Begeisterung von seinen Zeichnungen berichtet hatte, bat sie ihn, die Bilder zur Therapie mitzubringen. Alle Blätter waren auf der Rückseite mit Datum, Ort und eventuellen Anmerkungen zum besseren Verständnis des Dargestellten versehen und boten somit eine ideale Kommunikationsgrundlage. Da die Sprachtherapeutin direkt an Benjamins Interessen anknüpfte und ihn damit fast unmerklich auf Dinge lenkte, die sie mit ihm üben wollte oder musste, hatte sie bedeutend mehr Erfolg in der Förderung unseres Sohnes als Frau Ferros. So arbeitete sie in wochenlanger Kleinarbeit einen kurzen Vortrag über unseren spannenden Besuch im Filmpark Babelsberg aus, welchen Benjamin dann vor seiner Klasse hielt.
Die Sprachtherapeutin schien unsere Sorgen und Benjamins Probleme bedeutend besser zu verstehen als Frau Ferros und so fragte ich sie in einem Elterngespräch nach einer alternativen Fibel und anderem Übungsmaterial für den Deutschunterricht. Ich hatte beobachtet, dass Benjamin eine tiefe Abneigung gegen seine Fibel hegte und sich nur Seiten gern anschaute, auf denen keine Menschen, sondern lediglich Pflanzen, Tiere, Häuser, Landschaften … abgebildet waren. Unserer Meinung nach benötigte Benjamin Lernmaterial, was ihn mehr ansprach, denn Geschichten wie „Wo ist Moni?“, „Moni und Nina sind am Ofen.“ sagten ihm gar nichts und er konnte damit nichts anfangen. Die Sprachtherapeutin bestätigte meine Beobachtung aus ihrer eigenen Erfahrung mit unserem Sohn, konnte uns aber nicht helfen und gab mein Anliegen an Frau Ferros weiter. Frau Ferros’ Reaktion darauf bestand in einem Sturm der Entrüstung, den sie über mir toben ließ: Benjamin sei nur zu faul zum Üben und zu träge zum Lesen. Und Frau Ferros war verärgert, weil ich mit der Sprachtherapeutin und nicht zuerst mit ihr über Benjamins Deutschleistungen geredet hatte, was aber so nicht stimmte, denn ich hatte schon unzählige Male versucht, mit ihr über alle möglichen Schwierigkeiten unseres Sohnes zu diskutieren. Trotzdem gab sie mir als Zeichen des guten Willens eine zweite, etwas ältere Fibel, welche aber genauso aufgebaut war wie die, die unser Sohn bereits benutzen musste.
Ein weiteres Problem beim Erlernen des Lesens und Schreibens bestand darin, dass Benjamin unerschütterlich daran glaubte, dass er erst sämtliche Buchstaben des Alphabets erlernen musste oder wollte, bevor er dieses Wissen zur Anwendung bringen konnte. Er war bereit, alle Buchstaben hintereinander in der „richtigen“ Reihenfolge zu erlernen, aber Frau Ferros verbot den Kindern eindringlich, sich Buchstaben anzueignen, die sie in der Schule noch nicht durchgenommen hatte. Da nach mehr als einem Jahr des Schulbesuchs noch keine Einigung mit Frau Ferros betreffs ihrer konventionellen Lehrmethoden zustande gekommen war, beschlossen wir, selber zu handeln. Nach langem Suchen fanden wir Lernmaterial für den Deutschunterricht der ersten und zweiten Klasse, wo eine Maus namens „Mimi“ durch das gesamte Übungsmaterial führte und fast alle Seiten mit Mäusegeschichten angefüllt waren. Dazu gab es noch eine Handpuppe, die sich bestens zur Gesprächsanbahnung eignete, und verschiedene Stempel, die ich zur Bewertung benutzte. Das alles kam prima bei Benjamin an und im Laufe eines halben Jahres lernte er so zu Hause das komplette Alphabet in Schreib- und Druckschrift sowie einfache Texte zu schreiben und zu lesen. Wenige Wochen nach Übungsbeginn hatte er bereits seine Klassenkameraden weit überholt, aber trotzdem verweigerte er weiterhin in der Schule das Lesen gelegter Wörter. Er setzte auch keine Wörter mit Silbenkärtchen von dem Wortmaterial der Fibel zusammen, obwohl er zu Hause aus einer hübschen Fühlbox mit Meeresmotiven Moosgummi-Buchstaben richtig heraussuchte und daraus die geforderten Wörter zusammensetzte oder Wörter in den fast weißen, feinkörnigen Sand der Sandwanne schrieb. Unsere häuslichen Übungen waren allerdings sehr zeitaufwendig, da ich immer neben meinem Sohn sitzen und öfter meine Hand auf seinen linken Arm oder seine Schulter legen musste, damit er arbeiten konnte. Damals wusste ich noch nicht, dass ich ihm damit einen Impuls zum Arbeitsbeginn oder zum Weiterarbeiten gab, ich spürte nur, dass mein Sohn diese Unterstützung brauchte. Jahre später, als ich immer noch bei vielen Schulaufgaben neben Benjamin sitzen oder in der Nähe sein musste, fragte ich ihn einmal nach dem Grund dafür, und er antwortete mir: „Das ist deine gute Energie, die mir sonst fehlt.“
Benjamins häusliche Fortschritte betreffs des Erlernens des Alphabets weckten den Wunsch in ihm, Computerspiele auszuprobieren, für die er eigentlich noch zu jung war, weil er dazu Lesen und Schreiben gut beherrschen musste. Leon sah darin kein Problem und vertrat die Meinung, dass diese Herausforderung seine Lese- und Schreibfähigkeiten sogar verbessern wird. Ich war zwar eher skeptisch, ließ es aber dennoch auf einen Versuch ankommen. Ein Computerspiel, bei dem der Spieler als lustiger, vegetarischer Außerirdischer von der Erde aus zu seinem Heimatplaneten zurückgelangen musste und wo die Fortbewegung von einem Himmelskörper zum nächsten durch das Lösen von Deutsch-, Mathematik- und Konzentrations- sowie Merkaufgaben ermöglicht wurde, war für Grundschüler der dritten und vierten Klasse konzipiert worden und befand sich in Conrads Besitz. Benjamin fühlte sich von diesem Programm so in den Bann gezogen, dass er mit großer Energie daran arbeitete, dieses Spiel testen zu dürfen. In den ersten vier Wochen benötigte Benjamin ständig meine oder Conrads Hilfe, um mit den Aufgaben des Spiels zurechtzukommen. Aber dann wurde er von Woche zu Woche ausdauernder und frustrationstoleranter. Er arbeitete dieses Spiel, welches eigentlich ein klug verpacktes Lernprogramm war, so oft durch, bis ihm ein kompletter Durchlauf ohne fremde Hilfe gelang. Danach versuchte er sich an schwierigen Simulationen, mit denen er ebenfalls gut zurechtkam. Conrad gelang es sogar, seinen Bruder dazu zu überreden, Teile eines Computer-Strategiespiels aus Papier nachzubauen und dann tagelang mit ihm und ausgewählten Plüschtieren alle möglichen Optionen durchzutesten.
Da Benjamin im verhassten Morgenkreis, der jeden Montagmorgen in der Schule abgehalten wurde, immer nur „Computer gespielt“ als Wochenendbeschäftigung von sich gab, fühlte sich Frau Ferros verpflichtet, uns mitzuteilen, wie falsch unser Handeln sei, wenn wir unserem Sohn derartige Spiele erlaubten, bevor er gewillt ist, seine Silbenkärtchen in der Schule richtig zu legen. Das erinnerte mich sofort an die Aussage seiner früheren Spieltherapeutin, welche mir verbieten wollte, Spiele mit Benjamin zu Hause zu spielen, die er in der Therapiestunde verweigert hatte. Frau Ferros hatte allerdings ein generelles Problem mit der Benutzung von Computern, denn sie verkündete einmal auf einem Elternabend Folgendes über die Deutschunterrichtsstunden: „Eine Stunde davon gehen wir an den Computer, da lernen wir zwar auch etwas, aber die Stunde ist verloren.“ Für Benjamin zählten die Unterrichtsstunden am Computer mit Sicherheit zu den effektivsten. Im Gegensatz zu Frau Ferros zeigte seine Sprachtherapeutin Interesse an Benjamins Computerspielen und schaute sich mit ihm gemeinsam Demoversionen von einigen seiner Programme an, um dann daran anzuknüpfen.
„So vernachlässigte er z. B. durch sein großes Tempo beim Essen die richtige Besteckhaltung und die Einhaltung von Tischsitten.“ Dies war Frau Ferros’ Einschätzung von Benjamins Essverhalten zum Ende des ersten Schuljahres. Damals kündigte die Lehrerin unseres Sohnes an, dass daran „weiter mit liebevoller Konsequenz“ gearbeitet werden würde, was aber leider in einen erbitterten Machtkampf ausartete. Benjamin konnte immer noch nicht mit einem Messer umgehen. Er schaffte es weder, ein Stück Fleisch zu zerteilen, noch ein Brot zu schmieren. Uns war die Tatsache bekannt, dass er für viele Dinge mehr Zeit zum Erlernen benötigte, weil seine Kraftdosierung und die Koordination seiner Bewegungen für einen Umgang mit Messer und Gabel noch nicht geschult genug waren. Da die Schule seit Benjamins Einschulung jedoch eine Ganztagsschule war, mussten wir ihn wohl oder übel zum Schulessen anmelden. Wir wussten allerdings, dass ihm oft von dem Geruch des gekochten Essens unwohl wurde und dass er meistens nur die Beilage aß, weil er nahezu sämtliches gekochtes Gemüse ablehnte. Weil Frau Ferros sich weigerte, sein Fleisch zu schneiden, und ihn auch daran hinderte, es in die Finger zu nehmen, verzichtete unser Sohn letztendlich darauf. Sie versuchte weiterhin, ihn zum Essen aller Gerichte zu zwingen, und warf uns eine ungesunde Ernährung vor, obwohl Benjamin beinahe täglich frisches Obst oder Gemüse in seiner Lunchbox vorfand und dieses immer aufaß. Ich hätte ihm lieber diesen täglichen Machtkampf erspart und ihm Proviant mitgegeben, aber aus personellen Gründen war es abermals nicht möglich, unseren Sohn in der Pause separat zu betreuen. Ein Jahr später wechselte die Schule den Anbieter, wobei das Essen nicht nur preiswerter, sondern auch ungenießbarer wurde. Dies war für uns der endgültige Auslöser für das Abmelden unseres Sohnes vom Schulessen. Benjamin musste zwar trotzdem mit den anderen Kindern den Speisesaal aufsuchen, durfte aber endlich seinen mitgebrachten Proviant verzehren und bekam dann am späten Nachmittag eine warme Mahlzeit zu Hause. Das folgende Beispiel zeigt, dass es auch optimale Lösungen für autistische Kinder bei der Mittagsmahlzeit in öffentlichen Schulen geben kann: „Seit Jahren ist Lucas schon sehr wählerisch, wenn es ums Essen geht, und in die Vorschule habe ich ihm immer etwas mitgegeben. In seiner neuen Schule ist man sehr entgegenkommend. Das Küchenpersonal ist sehr nett und bereitet Hamburger nach meinem Rezept für ihn zu. Lucas darf sogar in die Küche, wenn sie sein Essen vorbereiten, und er darf es salzen und pfeffern.“2
Zu Beginn seiner Schulzeit verzehrte unser Sohn stets sein gesamtes mitgebrachtes Essen in der allerersten Pause. Er hatte keinen Plan, wie er seinen Proviant einteilen sollte, kein Zeitgefühl dafür, wie lang sein Schultag werden würde oder wann er eventuell noch einmal Hunger bekommen könnte, und es mangelte ihm an einem Sättigungsgefühl, was uns zu Hause zwang, seine Nahrungsaufnahme streng zu reglementieren. Dieses Problem lösten wir, indem Leon Benjamins Verpflegung in Portionen aufteilte, jede Portion in eine gesonderte Butterbrottüte legte und jede Tüte mit der entsprechenden Pause nummerierte. Von da an gab es keine Probleme mehr mit der Nahrungseinteilung in der Schule, aber Benjamin brachte im Gegensatz zu seinen Brüdern nie ein Schulbrot wieder mit nach Hause.
Der Dose, der Tor, der Auto, das Erde, das Sonne, das Mond, die Mund, die Radio, die Land – so sah Benjamins erstes schulisches Übungsblatt zum Thema „bestimmte Artikel“ aus. Im Mitteilungsheft unseres Sohnes wurde uns in warnender roter Schrift sogleich die Lösung des Problems mitgeliefert: „Bitte darauf achten, dass Benjamin die Artikel richtig verwendet. Er hatte heute nicht ein Beispiel richtig.“ Wie sollten wir darauf achten, dass unser Sohn die Artikel richtig verwendet, wenn er doch gar keine benutzte? Deshalb war uns zu dieser Zeit bisher nicht aufgefallen, dass Benjamin Artikel nicht richtig anwenden konnte. Wir waren immer noch froh, wenn er mit uns kommunizierte und wenn seine Sätze dabei wenigstens über Subjekt und Prädikat verfügten, Objekte waren eine Zugabe, die uns jedes Mal innerlich jubeln ließen. Er baute so gut wie keine Füllwörter in seine Ausführungen ein und Adjektive oder Adverbien warteten noch auf die Entdeckung, dass sie regelmäßig benutzt werden durften. Wir mussten uns stets sehr vorsichtig mit ihm unterhalten, um ihn nicht wieder zum Abwenden vom verbalen Austausch zu bringen. In stressigen Situationen verfügte Benjamin oft nicht mehr über genügend Kraft, um auch noch ein Gespräch zu führen. Meine Frage nach seinen Erlebnissen in der Schule beantwortete er jeden Tag mit „Ie weiß nich!“, was zum einen daran lag, dass er wirklich nicht wusste, was er denn erzählen konnte oder sollte. Zum anderen gelang es ihm oft noch nicht, die wenigen Erlebnisse, die er berichten wollte, in verständlichen Worten auszudrücken. Wenn ich Benjamin nach konkreten Ereignissen gezielt befragte, weil sich beispielsweise in seinem Mitteilungsheft dazu eine Notiz befand oder weil Anabels Mutter mir telefonisch Neuigkeiten anvertraut hatte, dann vermochte mein Sohn häufig dazu etwas mitzuteilen. Die Schwierigkeiten mit der Benutzung von Artikeln und Füllwörtern lagen hauptsächlich im überwiegend visuellen Denken unseres Sohnes begründet, denn Artikel kann sein Gehirn nicht in Bilder umwandeln, bei Füllwörtern gelingt das häufig erst durch das Konstruieren von assoziativen Brücken. Wenn Benjamin aber keine Artikel verwendete, wie sollte er dann bei einem Wort wie „Spielende“ wissen, ob damit das Ende des Spiels oder aber ein männlicher beziehungsweise weiblicher Spieler gemeint war? Sicherlich konnte er die Bedeutung der Substantive, und hier ließen sich noch viele Beispiele anfügen wie etwa „Leiter“ oder „Schild“, nicht immer einwandfrei aus dem Kontext erschließen.
„Jedes Substantiv hat ein Geschlecht, und in dessen Verteilung liegt kein Sinn und kein System; deshalb muß das Geschlecht jedes einzelnen Hauptwortes für sich auswendig gelernt werden. Es gibt keinen anderen Weg. Zu diesem Zwecke muß man das Gedächtnis eines Notizbuches haben. Im Deutschen hat ein Fräulein kein Geschlecht, während eine weiße Rübe eines hat. Man denke nur, auf welche übertriebene Verehrung der Rübe das deutet und auf welche dickfellige Respektlosigkeit dem Fräulein gegenüber.“3 Weitaus bedeutendere Personen als unser Sohn hatten ihre Schwierigkeiten mit dem Erlernen der deutschen Sprache, wie diese Zeilen von Mark Twain beweisen, welcher 1878 in Heidelberg versuchte, diese Fertigkeit zu erwerben, während er die alte Welt zu Fuß erkundete. Er fand, dass es gewiss keine andere Sprache gibt, „die so ungeordnet und unsystematisch, so schlüpfrig und unfaßbar ist“.4 Es gab nur einen entscheidenden Unterschied zwischen Mark Twain und unserem Sohn: Der geniale amerikanische Schriftsteller eignete sich die deutsche Sprache als Fremdsprache an, aber für Benjamin hingegen war es seine Muttersprache. Oder etwa nicht? In dieser Zeit fiel uns beim Nachdenken über dieses Thema auf, dass Benjamin die deutsche Sprache wie eine Fremdsprache erlernte. Er eignete sich Vokabel für Vokabel und Regel für Regel an, alles, was wir mühsam in ihn hineinpressten. An seinen Äußerungen erkannten wir, dass er sämtliches Gehörte in Bilder umsetzte und so abspeicherte. Gänseblümchen als „Entenglöckchen“ und Kopfhörer als „Ohrenschützer“ zu bezeichnen, waren nur zwei Beispiele dafür, welche uns quasi bildlich vor Augen führten, wie Benjamins Informationsverarbeitung funktionierte. Aber wie sollte er nun die Benutzung von Artikeln erlernen, die offenbar nicht nur ihm überflüssig und unsinnig vorkamen?
In der Schule vertrat man die Meinung, dass bei jeder Äußerung unseres Sohnes auf die korrekte Benutzung der Artikel geachtet werden müsse. Diese Methode kam im Unterricht und auch in der Sprachtherapie konsequent zur Anwendung. Benjamin wurde immer wieder aufgefordert, bei jedem benutzten Substantiv den korrekten Begleiter zu erraten, und spätestens beim dritten Versuch hatte er zwangsläufig Erfolg. Aber eine Verbesserung seines Vermögens, Artikel richtig zu verwenden, stellte sich auch nach mehreren Wochen nicht ein, es blieb beim Raten. Zu Hause begannen wir damit, den richtigen Artikel zu nennen und im Raum stehen zu lassen. Versuchten wir, von Benjamin die Benutzung eines Artikels zu erpressen, antwortete er nur „Was!“ und schränkte dann seine Kommunikation mit uns spürbar ein, was ja auch verständlich war, denn so machte eine Unterhaltung eben keinen Spaß mehr. Wie er sich in der Schule bei den erzwungenen Übungen verhielt, vermag ich nicht zu sagen. Aber auch unser Versuch des zwanglosen Korrigierens blieb völlig erfolglos. War es unmöglich, Benjamin diese Fertigkeit beizubringen, oder fehlte uns nur die richtige Idee?
Auf der Suche nach einer Lösung kam ich zu der Erkenntnis, dass das Erlernen der Benutzung von Artikeln nicht über Hören und Sprechen funktionieren würde, sondern dass ich die visuelle Überlegenheit unseres Sohnes dafür ausnutzen musste. Ich begann, Übungsblätter für Benjamin zu entwickeln, in der Hoffnung, dass unser Sohn wenigstens einen Teil der Substantive mit ihren Begleitern auswendig lernen würde. Nun musste ich noch das richtige Maß finden und eines Abends, als ich wieder einmal unsere Sorgen mit ins Bett nahm, fiel mir plötzlich die romantische Filmkomödie „Frankie & Johnny“ ein. Frankie, die von Michelle Pfeiffer gespielte Bedienung in einem griechischen Lokal, wundert sich, warum der gerade aus dem Gefängnis entlassene Koch Johnny, welcher von Al Pacino dargestellt wurde, so viele Fremdwörter beherrscht. Daraufhin erzählt ihr Johnny, dass er jeden Tag beim Rasieren ein Fremdwort und dessen Bedeutung lernt. Plötzlich kam mir der Gedanke, dass Regelmäßigkeit und Beschränkung genau die zwei Dinge waren, die zum Erfolg führen könnten. Also versah ich daraufhin jedes Übungsblatt lediglich mit zehn Wörtern. In der linken Spalte standen die bestimmten Artikel, in der Mitte die Übungswörter und rechts zeichnete ich Bilder von den Übungswörtern. Benjamin hatte nun die Aufgabe, die Artikel mit den Wörtern und die Wörter mit den entsprechenden Bildern zu verbinden. Mit einer zweiten Farbe forderte ich einen weiteren Versuch der fehlerhaften Zuordnungen. Danach folgte die Auswertung in einem Kästchen mit Belohnungsbild und für den Rest des Tages wurde nicht mehr über Artikel geredet. Das war enorm wichtig, weil Benjamin einerseits durch die Übungen merken sollte, dass die Begleiter der Substantive bedeutsam sind und von ihm geübt werden müssen, andererseits sollte er sich die übrige Zeit des Tages entspannen und mit Freude unbeschwert kommunizieren können. Auch wenn es mir schwerfiel, ihn nicht andauernd zum Üben aufzufordern, war dies mit Sicherheit der richtige Weg.
Benjamins Reaktion auf die Artikel-Übungsblätter fiel sehr unterschiedlich aus. Es gab Tage, wo er sich mit wenig Widerstand in sein Schicksal fügte, an anderen Tagen schimpfte er laut, zerknüllte sein Arbeitsblatt und schlug gelegentlich um sich, wenn ihm jemand zu nahe kam. Seltsamerweise zerriss er nie ein Übungsblatt. Irgendwann gab er seinen Widerstand auf und erledigte meist recht flink seine Arbeit, aber mir tat jedes Mal die so verloren gegangene Zeit und Energie leid. Verzweifelt versuchte mein Sohn, Regeln für die Vergabe der Artikel aufzustellen. So glaubte er eines Tages, dass Wörter, die sich reimen, auch dieselben Begleiter haben müssten, bis „die Maus“ in „das Haus“ ging und seine Regel zunichtemachte. Ein anderes Mal verkündete er triumphierend, dass alle Wörter, die auf „e“ enden, weiblich sind: die Katze, die Tasse, die Hose, die Wolle, die Welle, die Taube …, ja, das schien zu funktionieren, wenn da nicht dieser furchtbare Löwe mit bedächtigem Schritt über sein Blatt marschiert wäre. An dieser Stelle möchte ich noch einmal Mark Twain zu Wort kommen lassen, der seine Verwirrung über die grammatischen Geschlechter der deutschen Sprache wie folgt beschrieb: „Ein Baum ist männlich, seine Knospen sind weiblich, seine Blätter sind sächlich; Pferde sind geschlechtslos, Hunde sind männlich, Katzen sind weiblich – natürlich einschließlich der Kater; jemandes Mund, Hals, Busen, Ellbogen, Finger, Nägel, Füße und Leib gehören dem männlichen Geschlecht an, und sein Kopf ist männlich oder sächlich, je nach dem Wort, das zur Bezeichnung gewählt wird, und nicht nach dem Geschlecht der Person, die ihn trägt – denn in Deutschland tragen alle Frauen entweder männliche oder geschlechtslose Köpfe; jemandes Nase, Lippen, Schultern, Brust, Hände, Hüften und Zehen gehören dem weiblichen Geschlecht an; und seine Haare, Ohren, Augen, Kinn, Beine, Knie, Herz und Gewissen haben überhaupt kein Geschlecht. Der Erfinder der Sprache hat wahrscheinlich das, was er vom Gewissen wusste, vom Hörensagen erfahren.“5 Was für ein Durcheinander! Als Muttersprachler denken wir nicht weiter über all diese Ungereimtheiten nach und amüsieren uns gelegentlich über das unpassende Geschlecht eines bestimmten Begriffs, wie beispielsweise die Frage, warum es „die Schnecke“ und nicht „das Schneck“ heißt, wo doch die gewöhnlichen Landschnecken Zwitter sind. Unsere beiden anderen Söhne haben die Grammatik ebenso wie die meisten Kinder beim Spracherwerb durch Zuhören und Nachsprechen gelernt, einschließlich der korrekten Benutzung von Artikeln. Würde Benjamin das jetzt noch aufholen können?
Die Erfolgsquote unseres Sohnes bei seinen Übungsblättern lag mehr als ein dreiviertel Jahr lang bei durchschnittlich fünf richtigen Zuordnungen der Artikel pro Aufgabenblatt mit zehn Substantiven. Beim Verbinden der erlesenen Wörter mit den entsprechenden Bildern unterlief Benjamin dagegen so gut wie nie ein Fehler. Eine derartige Erfolgsquote konnte man bei zwei Versuchen auch durch Auswürfeln der Ergebnisse erreichen. Damit mussten wir davon ausgehen, dass alle Ergebnisse nur geraten waren. Eigentlich schien dieses Unterfangen sinnlos zu sein, aber eine innere Stimme riet mir, noch nicht aufzugeben. Inzwischen war fast die ganze Familie in dieses Projekt involviert. Pascal glaubte wohl, dass Benjamin zu viel Zuwendung bekam, und forderte ebenfalls eine Zeit lang Artikel-Übungsblätter von mir, obwohl er dabei nie Fehler machte. Conrad bot an, Übungsblätter für Benjamin zu zeichnen, um dafür eine Stunde länger am Computer spielen zu dürfen. Dieses Angebot nahm ich dankbar an, da Benjamin die von Conrad liebevoll mit Belohnungs-Pokémons verzierten Blätter mehr mochte als meine. Später zeichnete auch Pascal Übungsblätter für Benjamin, denn obwohl er erst die Vorschule besuchte, beherrschte er bereits das gesamte Alphabet und konnte schon eine Menge Wörter lesen und schreiben. Mitunter entwarfen meine Jungen außerdem am Computer Arbeitsblätter und druckten sie dann aus. Wir waren von ihrem Enthusiasmus ganz gerührt. Die Themen der Übungsblätter variierten täglich, manchmal wurden die Wörter willkürlich ausgewählt, dann wieder passten alle Wörter zu einem bestimmten Thema wie beispielsweise Geburtstag, Weihnachten, Gemüse oder Meerestiere. Nach ungefähr einem Jahr beharrlichen Übens stieg Benjamins Erfolgsquote plötzlich sprunghaft an, ohne dass ich dafür eine Erklärung fand. Nachdem diese unglaublichen Erfolge zwei Monate lang kontinuierlich anhielten, erhöhte ich den Schwierigkeitsgrad der Übungen, indem ich Benjamin entweder gleichzeitig den Plural der Wörter hinschreiben ließ oder zusammengesetzte Wörter, Verniedlichungen und Reimwörter benutzte. Später ließ ich ihn die Wörter allein zusammensetzen, wobei er auch die Artikel der einzelnen Wörter bestimmen sollte. Die letzte Stufe unserer Übungen bestand darin, dass Benjamin aus einem Substantiv und einem Verb ein zusammengesetztes Wort konstruieren und dann zuordnen sollte, also beispielsweise aus „Maus“ und „springen“ „die Springmaus“ zusammensetzen musste. Nach dieser langen Übungszeit schien der Erfolg dauerhaft zu sein und ich beschloss mit gutem Gewissen, Benjamin von dieser Qual zu befreien, nicht ahnend, dass schon bald die nächste Herausforderung auf uns lauern würde.
Unser Sohn beherrschte also fortan fast immer die richtige Wahl der Artikel, und zwar auch bei Wörtern, die wir nie geübt hatten. Er machte dabei nicht mehr Fehler als Gleichaltrige. Aber wie konnte das funktionieren? Die einzige, mir möglich erscheinende Erklärung ist, dass Benjamin durch die Übungsblätter gelernt hatte, sich die Wortkombination von bestimmtem Artikel und Substantiv als zwingende sprachliche Einheit einzuprägen, so wie er dies später mit Vor- und Zunamen von Personen tat. Er erstellte sozusagen eine visuelle Verknüpfung von Artikel und Substantiv als Ganzheit, denn nicht umsonst bedeutet „Artikel“ im Deutschen „Begleiter“. Fortan prägte er sich offensichtlich beim Vorlesen und während des eigenständigen Lesens die Substantive mit ihren Begleitern ein. Benjamin konnte zwar nun Artikel richtig bestimmen, aber nicht immer richtig benutzen, denn in Sätzen, wo diese überflüssig oder sogar falsch sind (Nullartikel), wie beispielsweise in dem Satz „Mäuse sind Nagetiere“, ließ er sie nicht weg. Ähnlich verhielt es sich ein paar Jahre später mit Vor- und Zunamen, wo unser Sohn nie einschätzen konnte, wie man diese richtig benutzt. Nachdem er endlich das Telefonieren erlernt hatte, beantwortete er die folgende Frage seiner Großmutter: „Hier ist die Oma, wer von euch Jungs ist denn dran?“, immer mit „Benjamin Maus“.
Etliche Jahre später fiel mir eher zufällig das über dreißig Jahre alte Buch von Elvira Crummenerl alias Gerda Thieme in die Hände. Zu meinem großen Erstaunen beschrieb die Gründerin des Selbsthilfevereins „Hilfe für das autistische Kind“ darin, dass viele Kinder aufgrund ihrer autistischen Behinderung nicht in der Lage sind, die richtige Verbindung zwischen Artikel und Substantiv herzustellen. Die Autorin nutze folgende Methode, um ihrem Sohn die korrekte Benutzung von Artikeln zu vermitteln: „Ich hatte damals als Brücke farbliche Kennzeichnung gewählt, wie ich es in einer Gehörlosenschule gesehen hatte. Alle Die-Wörter erhielten einen roten, alle Der-Wörter einen grünen und alle Das-Wörter einen blauen Strich. Dann unterteilte ich eine große Heftseite in drei Spalten, schrieb in die linke oberste Reihe ‚die‘ (mit einem roten Strich), daneben ‚der‘ (mit einem blauen [sic] Strich) und dann ‚das‘ (mit einem grünen [sic] Strich) und ließ Dirk die gekennzeichneten Wörter aus dem Bilderbrockhaus in die Tabelle eintragen, wobei er dann automatisch das richtige Geschlechtswort vorsetzte.“6 Diese Methode hätte mit Sicherheit auch bei Benjamin zum Erfolg geführt, da diese Vorgehensweise genau wie mein Verfahren auf der visuellen Überlegenheit dieser Kinder aufbaut.
Unter dem Druck der Schule mussten wir unseren vormittäglichen Therapietermin für die Sensorische Integrationstherapie aufgeben und stattdessen auf einen Termin am frühen Abend ausweichen. Benjamin besuchte die Ergotherapie mittlerweile so gern, dass er trotz des späten Termins meistens zu einer guten Mitarbeit zu bewegen war. Von den Therapeutinnen wurden zahlreiche Höhepunkte organisiert, wie beispielsweise die zweimal jährlich stattfindende Schaumwoche. Dazu legten sie den größten Therapieraum einschließlich der Rutschen mit dicker Plastikfolie aus, um den kleinen Patienten ausgiebige Erfahrungen mit Wasser, Creme, Seife und Schaum zu ermöglichen. Benjamin verbrachte seine gesamte Therapiestunde damit, die Rutsche einzucremen und am Fuß der Rutsche Schaumberge aufzutürmen. Dann bestieg er die schiefe Ebene und sauste mit enormer Geschwindigkeit in sein vergängliches Hindernis, wobei er so ausgelassen und glücklich wirkte, wie wir es selten erlebten. Ich bedauerte sehr, dass Leon ihn so nicht sehen konnte, denn auch die geschossenen Fotos brachten nur einen Bruchteil dieser selten geäußerten Lebensfreude zum Ausdruck.
Im Herbst nach fünfzehnmonatiger Therapiezeit überwand unser Sohn seine Angst vor Tüchern und Planen. Er brachte viel Mut auf und kroch mehrmals unter das große Schwungtuch im Therapieraum. Diese positive Erfahrung ermöglichte es ihm, zu Hause seinen Kriechtunnel zu benutzen, welcher ein Iglu mit einem Tipi in verschiedenen Kinderzimmern verband. Vielleicht war dies ja ein erster Schritt, um mit seiner Angst vor der Dunkelheit besser umzugehen. Für unsere Halloween-Feier bastelte ich mit den Kindern Geister aus Styroporkugeln und alten Stoffwindeln, welche wir dann mit nachleuchtenden Stickern und Farben dekorierten, sodass sie das Dunkel ein wenig erhellten, nachdem sie zuvor einer Lichtquelle ausgesetzt worden waren. Am Abend von Halloween versteckte ich die aufgeladenen Gespenster in der Wohnung, gab jedem Kind eine Kürbistaschenlampe und ließ sie die Geister in der sonst völlig dunklen Wohnung suchen. Erstaunlicherweise protestierte Benjamin dieses Mal nicht, als auch das letzte Licht im Flur gelöscht wurde, und machte sich wie seine Brüder, allerdings sehr viel vorsichtiger und mit einer schaurig schönen Erregung, eifrig auf die Suche nach seiner Spukgestalt. Was für die Kinder Spaß bedeutete, betrachtete ich immer auch als Therapie und Training für Benjamin und so freute es mich außerordentlich, dass unser mittlerer Sohn an jenem Abend nicht genug von dieser Aktivität bekommen konnte. Seine Brüder spielten willig mit, denn je länger ihr Mitstreiter nicht die Lust verlor, desto länger durften sie aufbleiben. Aber sie veränderten mit jeder neuen Runde die Spielregeln, sodass einmal ein Kind alle Geister allein suchen musste oder jeder das Gespenst eines anderen aufspüren sollte. Später praktizierte ich dieses Spiel im Dunkeln in allen möglichen Varianten. Ich klebte nachleuchtende Insekten an die Türen und forderte die Kinder auf, im dunklen Zimmer mit weichen Schaumstoffbällen, welche in einem von einer Taschenlampe beleuchteten Körbchen lagen, die Tierchen zu treffen. Ein anderes Mal gestalteten wir aus Fotokarton und Papierstreifen Spinnennetze und befestigten sie an Wänden und Schränken. Dann verband ich den Kindern nacheinander die Augen, gab ihnen mit Klebefolie versehene Plastikspinnen und ließ sie unter den Anweisungen ihrer Brüder auf ein Netz zulaufen, um die Spinnen darin zu positionieren. Hinterher konnten sie so prima feststellen, wie gut sie sich ohne Sehen zu orientieren vermochten. In den Winterferien erntete ich die ersten Früchte meiner Bemühungen, denn Benjamin nahm all seinen Mut zusammen und betrat voller Ehrfurcht zusammen mit Pascal die spärlich beleuchteten, assyrischen Königsgrabkammern im Berliner Pergamon-Museum.
Obwohl Benjamin diese Experimente mit der fast gänzlichen Dunkelheit immer länger aushielt, mussten wir ein Vierteljahr später feststellen, dass seine Angst vor der Finsternis nicht im Geringsten nachgelassen hatte. In den Osterferien besuchten wir den Vergnügungspark Disneyland Paris und obwohl die Anlage zu dieser Jahreszeit trotz Vorsaison sehr von Besuchern überlaufen war, spürten wir Benjamin diesen Stress kaum an. Doch dann wollte unser Sohn unbedingt mit der Geisterbahn fahren, ungeachtet unserer eindringlichen Warnung vor den dunklen, gruseligen Gefilden. Da viel jüngere Kinder vergnügt dem Ausgang entsprangen, stellten wir uns schließlich an. Wir mussten dicht gedrängt einen Fahrstuhl betreten, der uns nach unten in das Kellergeschoss des künstlichen Schlosses bringen sollte, wo sich das eigentliche Fahrgeschäft befand. Die unheimlichen Geräusche und das mysteriöse Flackern des Lichtes im scheinbar klapprigen Lift erduldete Benjamin in meinem Arm festgekrallt. Er schien äußerst angespannt, aber nicht ängstlich zu sein. Plötzlich blieb der Fahrstuhl abrupt stehen, wackelte bedenklich und das Licht verlosch gänzlich. Ein mehrsprachiges Gemurmel der Urlauber um uns herum war zu vernehmen, aber Benjamin bekam eine furchtbare Panikattacke. Er versuchte aus Angst, um sich zu schlagen, aber dafür war es zu eng. Er wollte schreien, doch seine Stimme versagte mit einem furchtbaren Geräusch. Ich konnte nichts anderes tun, als ihn mit meiner ganzen Kraft fest zu umklammern, und hoffte inständig, dass die Beleuchtung schnell zurückkehren und unsere Fahrt gleich weitergehen würde. Einige erwachsene Fahrgäste drängten sich jetzt noch dichter an uns, aber dem Klang ihrer fremdländischen Stimmen konnte ich entnehmen, dass sie beruhigend auf unseren Sohn einwirken wollten. Nie und nimmer hätte ich geglaubt, dass in einem Vergnügungspark für Kinder das Licht völlig ausgeschaltet werden würde. Bei unserem Besuch im LEGOLAND-Park machten wir die angenehme Erfahrung, dass sich überall wenigstens eine winzige Beleuchtungsquelle befand. So wurden die unterirdischen Höhlen der Piraten von Glühwürmchen und anderem niedlichen Getier schwach beleuchtet und spärliche Fackeln erzeugten eine vage Ahnung von den dunklen Gängen des Königsschlosses. Am Ende der nervenzerreißenden Fahrstuhlfahrt verließ ein zitterndes, schweißgebadetes, bleiches Geschöpf den Aufzug und sank kraftlos in meine Arme. Als Benjamin jedoch die Wagen der Geisterbahn erblickte, zog er mich hinein und verbrachte die Fahrt schlapp in meinen Armen liegend, scheinbar ohne die finsteren Gestalten in den Kellergewölben zu beachten. Conrad, der in einem anderen Wagen fuhr, plapperte hinterher aufgeregt über Zombies und andere Monster, aber da musste ich feststellen, dass ich nichts von alledem mitbekommen hatte. Ich besitze keine Erinnerung an das Innere der Geisterbahn, ich sah nur noch den Fahrstuhl, den Wagen des Fahrgeschäftes und meinen furchtbar blassen Sohn vor mir. Die Geisterbahn wurde von Benjamin entgegen seiner Gewohnheit kein zweites Mal benutzt.