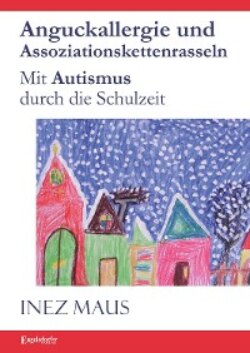Читать книгу Anguckallergie und Assoziationskettenrasseln - Inez Maus - Страница 9
Ein auf der Spitze stehendes Dreieck
ОглавлениеIch denke immer, wenn ich einen Druckfehler sehe, es sei etwas Neues erfunden.
Johann Wolfgang von Goethe
Es war immer äußerst mühsam, Benjamin für irgendwelche Aktivitäten nach draußen zu locken, besonders wenn die Außentemperatur minus 8 °C betrug. An so einem eisigen Wintertag holte ich gemeinsam mit Pascal meinen Sohn von der Schule ab. Nach der Mittagspause gehen zu dürfen, stimmte ihn äußerst zufrieden. Aber ich marschierte mit den zwei aneinandergeketteten Schlitten, jeder mit einem Kind beladen, nicht nach Hause, sondern zum Rodelberg. Dort angekommen, sprang Pascal wie ein Gummiball von seinem hölzernen Untersatz und stürmte samt Schlitten den verschneiten Hügel hinauf. Benjamin blieb einfach sitzen, also nötigte ich ihn aufzustehen und zog dann meinen Sohn und seinen Schlitten die Anhöhe hinauf, während Pascal mit Conrad, den er auf der Spitze angetroffen hatte, laut jubelnd an uns vorbeisauste. Oben angekommen, wollte Benjamin keine Abfahrt wagen. Wie die Jahre zuvor rodelte ich nach einiger Überzeugungsarbeit mit ihm zusammen. Nach dem dritten Mal hielt ich, von einer spontanen Eingebung inspiriert, auf halber Höhe an, wendete den Schlitten, setzte meinen Sohn darauf und sagte ihm, dass er doch schon allein rodeln kann. Ich fragte ihn: „Kann es losgehen?“ Überraschenderweise antwortete er: „Ja!“, und ich ließ sofort, ohne weiter nachzudenken, den Schlitten los. Ich war mir nicht sicher, ob er mich richtig verstanden hatte oder ob er wusste, was jetzt mit ihm geschieht, aber im schlimmsten Fall würde er umkippen und im weichen Schnee landen. Jedoch fiel der Schlitten nicht um und Benjamin kam heil am Fuße des Hügels an. Endlich konnte er allein rodeln! Beim nächsten Durchgang startete er ein Stückchen weiter oben und so arbeiteten wir uns Schlittenlänge um Schlittenlänge bis zur Spitze der Erhebung vor. Ich musste allerdings jedes Mal nach unten laufen, ihn auffordern, den Schlitten zu verlassen, und dann das hölzerne Gestell für ihn die Steigung wieder hochziehen. Als wir nach dreieinhalb Stunden alle schon völlig durchgefroren waren, wollte Benjamin immer noch nicht seine neue Lieblingsbeschäftigung aufgeben. Sonst reagierte er so empfindlich auf Kälte, aber jetzt schien er nichts zu spüren. Erst die Aussicht auf einen Videofilm und die beginnende Dämmerung ließen uns endlich aufbrechen. Leider litt Pascal nach diesem erfolgreichen Tag unter quälenden Ohrenschmerzen und die Kinderärztin stellte am nächsten Tag eine Mittelohrentzündung fest, sodass wir in den folgenden Tagen vorerst nicht wieder rodeln gehen konnten.
Fast drei Jahre zuvor hatten wir Benjamin mit kindgerechten Inlineskates beschenkt und es war uns auch gelungen, ihn zum Benutzen dieser Sportgeräte zu motivieren. Allerdings hielt er sich zu Beginn mit beiden Händen an uns fest, später reichte eine Hand. Ich ließ ihn regelmäßig zur Spieltherapie damit rollen, aber über die Phase des Handhaltens kam er nie hinaus. Für andere Sport- und Bewegungsspiele organisierten wir kleine familiäre Sportfeste im Freien oder Picknicks, wo die Snacks durch Geschicklichkeitsspiele verdient werden mussten. Trotz all dieser Bemühungen bekam Leon im Elterngespräch von Frau Ferros zu hören, dass Benjamin im Sportunterricht „absolut faul“ sei. Im Halbjahresbericht der Lehrerin fanden sich daraufhin konkrete Anweisungen: „Mit Beginn der schönen Jahreszeit sollte auch im Elternhaus versucht werden, Benjamin viele Möglichkeiten zu geben, sich auf Spielplätzen zu erproben, neue Spielgeräte kennenzulernen, seinen Körper zu kräftigen, Kontakte mit fremden Kindern aufzunehmen, ihm eine Chance zu geben, seine sich entwickelnde soziale Kompetenz auszubauen.“ Was glaubte denn diese Lehrerin, was wir all die Jahre unermüdlich trainiert und angestrebt hatten? Es tat so weh, von Außenstehenden immer nur kritisiert zu werden. Diese Anweisungen klangen ja so, als hätten wir uns nicht um unseren Sohn gekümmert. Oder hatte Frau Ferros etwa nicht damit gerechnet, dass wir unser Recht auf Einsicht in die Schülerakte in Anspruch nehmen würden?
Conrads sehnlichster Wunsch zu seinem zwölften Geburtstag bestand in einem Pokémon-Spiel für den Gameboy (mobiles elektronisches Spielgerät), weil alle seine Freunde bereits ein solches Spiel besaßen. Pokémons sind fiktive Gestalten, die oft Tieren oder Fantasy-Figuren sehr ähneln. So gab es beispielsweise drachen-, vogel- oder insektenartige Pokémons. Das Ziel des Spiels für den Gameboy bestand darin, dass der Spieler verschiedene Welten durchforsten und die Monster einfangen musste, welche er dann trainieren und in Wettkämpfen einsetzen durfte. Mit einem Verbindungskabel konnten zwei Spieler ihre Spielfiguren tauschen, das war besonders wichtig, weil es einige Arten nur in bestimmten Editionen gab. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir uns erfolgreich gegen dieses Fass ohne Boden gewehrt, denn bereits die ersten Editionen wurden von einhundertfünfzig Geschöpfen bevölkert, welche teilweise auch als Gummi-, Plastik- oder Plüsch-Spielgefährten verlockend in den Spielwarengeschäften, und nicht nur dort, auf ihre willensstarken Opfer warteten. Würden wir allerdings Conrad diesen wichtigen Wunsch nicht erfüllen, dann wäre er hierbei von der Kommunikation mit seinen Freunden ausgegrenzt. Da inhaltlich nicht wirklich etwas an diesem Spiel auszusetzen war, bekam er die blaue Edition zu seinem Geburtstag geschenkt und war so glücklich damit, dass er uns mit seiner Freude überschüttete.
Was wir allerdings nicht vorhergesehen hatten, war die Tatsache, dass Pokémons ansteckend waren wie Windpocken. Kurze Zeit später hatte nicht nur Conrad alle einhundertfünfzig Wesen auswendig gelernt, sondern auch Benjamin kannte sämtliche Gestalten und bemühte sich sogar, deren Namen verständlich auszusprechen, was bei Wörtern wie Quaputzi, Smettbo, Sarzenia oder Vulpix eine echte Herausforderung für ihn darstellte, die er mit Feuereifer annahm. Selbst Pascal begann, sich mit diesen Wesen zu beschäftigen. Eine unaufhaltsame Sammelwut befiel unsere Kinder und ein unstillbarer Hunger nach Plüschtieren, Büchern, Sammelkarten, Aufklebern und anderen Produkten bestimmte unseren Alltag. Wir ließen dies in einem gewissen Maße zu, denn diese kleinen Taschenmonster brachten uns unglaubliche Erfolge, da Benjamin so sehr auf sie fixiert war. Er übte nicht nur fleißig sprechen und lesen, sondern er legte sich genau wie seine Brüder einen selbst gezeichneten Katalog mit allen Pokémons an, wofür er Karteikarten benutzte. Sorgfältig listete er Eigenschaften und Fähigkeiten der Geschöpfe auf und schulte somit freiwillig seine Schreibfertigkeiten. Da auch er seine Sammelkarten vervollständigen wollte, ging er auf seine Brüder zu, um mit ihnen doppelte Karten zu tauschen. An kleinen Partys und ausgedehnten Spielen mit den Plüschfiguren, welche seine Geschwister zelebrierten, nahm er bedeutend ausdauernder und toleranter teil als an früheren Spielen. Seine sozialen, sprachlichen und motorischen Fähigkeiten wurden so völlig ohne Zwang trainiert. Außerdem eignete sich alles, was irgendwie mit Pokémons zu tun hatte, sei es nun die Fernsehserie, die wir für unsere Kinder aufzeichneten, oder seien es kleine Geschenke, mit denen ich mich bei jeder Gelegenheit bevorratete, hervorragend als Motivationsmittel für Benjamin. Wollte er ungeliebte Aufgaben nicht erledigen, so machte ihn die Aussicht auf das Ansehen einer Folge Pokémon, auf ein paar Aufkleber oder auf ein Tütchen mit Sammelbildern meist sehr gefügig. Später, als auch unsere beiden Kleinen eine eigene Edition für den Gameboy besaßen, tauschte Benjamin mit seinen Brüdern ebenfalls seine virtuellen Monster. Und Conrad wechselte mit seinem besten Freund Sören digitale Kreaturen für seinen Bruder, weil Benjamin diese Leistung nicht fertigbrachte. Es berührte mich zutiefst, dass mein Großer dies aus eigenem Antrieb und aus Liebe zu seinem Bruder tat. Zum allerersten Mal begann unser mittlerer Sohn in dieser Zeit über seine Empfindungen zu reden, weil er die Pokémons in absolute Lieblinge, welche, die „ganz gut“ waren, und solche, die er gar nicht mochte, einteilte. Ich kann nur sagen, ich begann, diese Monster zu mögen, weil sie uns allen so sehr das Leben erleichterten.
Benjamin grübelte außerdem bei jeder einzelnen Kreatur darüber, welche Lebewesen oder Fantasy-Figuren dem Entwickler wohl als Inspiration gedient haben könnten. Da ich mich mit Leib und Seele auf diese Diskussionen einließ, wurden unsere Gespräche ausdauernder und intensiver. Mir war wichtig, dass wir miteinander redeten, worüber wir uns unterhielten, war vorerst zweitrangig. Wenn Kommunikation für unseren Sohn erst einmal selbstverständlich geworden ist, dann werden wir auch über andere Themen sprechen können. Dies sollte sich bewahrheiten, denn ein paar Jahre später plapperte Benjamin zumindest im Familienkreis wie ein Wasserfall, weil bei ihm ein Gedanke den anderen jagte und er uns diese Ideen und Einfälle unbedingt mitteilen wollte. Leon prägte dafür liebevoll den Begriff „Assoziationskettenrasseln“. Als wir ihn einmal zum Schweigen aufforderten, antwortete er uns entrüstet: „Früher habe ich euch zu wenig geredet und jetzt rede ich euch zu viel!“
In der zweiten Hälfte von Benjamins zweitem Schulbesuchsjahr fielen uns zunehmend mehr Stressreaktionen an unserem Sohn auf. Außer dem Kauen an den Fingernägeln, an das wir uns ja beinahe schon gewöhnt hatten, begann er zu unserem Entsetzen jetzt erneut damit, seine T-Shirts zu zernagen, was er seit Beginn der Vorschule nach seiner reichlich missglückten Kindergartenzeit nicht mehr getan hatte. Nach der Schule lief er nur noch nervös auf und ab, konnte sich auf kein Spiel mehr konzentrieren und das abendliche Einschlafen gestaltete sich immer schwieriger, weil Benjamin uns zwar müde erschien, aber nicht einschlafen konnte. Wir vermuteten, dass er Kummer hatte, aber konnten nicht herausfinden, was ihn so bedrückte. Als ich in dieser Zeit die Aufforderung zu einem Elterngespräch von Frau Ferros bekam, glaubte ich, den Dingen nun auf den Grund gehen zu können. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Frau Ferros bombardierte mich mit Vorwürfen, ließ mich kaum zu Wort kommen und wertete alle meine Argumente als Ausreden. Das Gespräch lief folgendermaßen ab. Nach der knapp ausgefallenen Begrüßung wurde ich darüber aufgeklärt, dass Benjamin jeden Tag draußen spielen müsse, und eine Menge Tipps für geeignete Sportarten gab die Lehrerin ungefragt dazu. Ich erwiderte, dass unser Sohn aus den verschiedensten Gründen, die ich alle versuchte aufzuzählen, (noch) nicht allein draußen spielen kann, erklärte die Probleme, die er aufgrund seines schwachen Muskeltonus mit den unterschiedlichen Bewegungsabläufen hat und … Aber sie unterbrach mich und beharrte darauf, dass ich meinen Sohn einfach nur auf den Spielplatz schicken müsse, alles andere ergäbe sich dann von allein. In ihrem Bericht schrieb sie dazu wenig später: „Durch das Elternhaus sollte es Benjamin unbedingt ermöglicht werden, seine Freizeit so oft wie möglich mit anderen Kindern (auch fremden) außerhalb der Wohnung zu verbringen. Es ist für seine soziale Entwicklung wichtig, dass er sich darin übt, zu Kindern soziale Kontakte herzustellen, diese zu pflegen, Kompromisse zu schließen […]. Nur so kann es gelingen, seinem egoistischen Verhalten entgegenzuwirken […].“ Dann warf Frau Ferros mir vor, dass unser Sohn „unfair, rücksichtslos und kontaktgestört“ sei, was sie am Schuljahresende so auch in seine Beurteilung schrieb: „So kam es auch vor, dass er körperlichen Einsatz zeigte, um seine Interessen durchzusetzen.“ Benjamin müsse beim Essen immer der Erste sein und er habe sie heute bei der Mittagsmahlzeit unter dem Tisch getreten und sich nicht entschuldigt! Bei diesen Ausführungen spürte ich einen leichten Hass in ihrer Stimme, aber Frau Ferros schien nie den Stress zu spüren, den Benjamin in solchen Situationen aushalten musste. Aus eigener Erfahrung wusste ich, dass unser Sohn oft an uns oder seine Geschwister anstieß, aber das lag an seiner schlechten Bewegungskoordination und nicht an der ihm unterstellten Rücksichtslosigkeit.
Die immer noch anhaltenden Rivalitäten mit seinem Klassenkameraden Kevin waren der nächste Punkt auf Frau Ferros’ Beschwerdeliste, wozu ich nichts weiter sagte und mich mit dem Gedanken tröstete, dass es doch ihre Aufgabe ist, Ordnung in die Klasse zu bringen. Frau Ferros bemängelte, dass Benjamin Grundbegriffe, die ein Achtjähriger beherrschen muss, nicht kenne. Das verwunderte mich und ich fragte genauer nach. Sie verkündete, er kenne keine Kleidungsstücke, aber dagegen erhob ich energisch Einspruch, denn ich wusste genau, dass mein Sohn über dieses Wissen verfügte. Etwas kleinlaut gab Frau Ferros daraufhin zu, dass Benjamin nicht wusste, was eine Bluse ist. Wie sollte er das auch wissen, wo er doch nur Brüder hat? Mit dem Lesen klappe es nicht, weil Benjamin dafür einfach zu „faul“ sei. Dass uns unser Sohn seit Beginn des Frühlings jeden Abend eine Seite aus einem Tierbuch vorlas, glaubte sie mir einfach nicht. Wie sollte ich ihr dies auch beweisen, musste ich es überhaupt beweisen? Des Weiteren könne sich unser Sohn keine vier Wörter hintereinander merken, wenn sie nur einmal vorgelesen werden. Diese Fähigkeit sei aber wichtig für das Schreiben von Diktaten. Damit hatte Frau Ferros recht, das war uns auch bereits aufgefallen und daran arbeiteten wir schon mit verschiedenen Übungen.
Als Nächstes regte sich Benjamins Lehrerin furchtbar über sein „abgehobenes Wissen“ auf, wogegen es ihm an „Basiswissen“ mangele. Entrüstet berichtete sie, dass er ihr den Aufbau des Innenohres haarklein erklärt habe und endete mit dem Ausruf: „Wozu muss er das denn jetzt wissen?!“ Um mir zu verdeutlichen, was sie meinte, verglich sie das Wissen „normaler“ Kinder (hier schrillten meine inneren Alarmglocken) mit einem Dreieck, wobei die breite Unterseite das Basiswissen sei und die nach oben zulaufende Spitze das immer speziellere Wissen darstelle. Bei Benjamin sei dies genau umgekehrt, sein Dreieck stehe auf der Spitze, weil sein Basiswissen so dünn und sein Spezialwissen so extrem sei. Das mag ja teilweise sogar zutreffend sein, aber sie machte mir den Vorwurf, dass wir diese Verteilung unserem Sohn so anerzogen hätten. Und sie war nicht in der Lage, diese Erkenntnis für einen besseren Umgang mit Benjamin zu nutzen, ihn beispielsweise über seine Interessen zu erreichen oder zu motivieren. In meinem Tagebuch hielt ich nach diesem unbefriedigenden Gespräch die Vermutung fest, dass Frau Ferros sich vor Benjamins Intelligenz fürchtete, wenn er ihr mit acht Jahren Dinge erklärte, die sie nicht so mühelos erklären konnte, und wenn er sie im Unterricht gnadenlos verbesserte, sowie sie einen Fehler beging. „Ein Schulmeister hat lieber einige Esel als ein Genie in seiner Klasse, und genau betrachtet hat er ja recht, denn seine Aufgabe ist es nicht, extravagante Geister heranzubilden, sondern gute Lateiner, Rechner und Biedermänner. Wer aber mehr und Schweres vom andern leidet, der Lehrer vom Knaben oder umgekehrt, wer von beiden mehr Tyrann, mehr Quälgeist ist und wer von beiden es ist, der dem anderen Teil seiner Seele und seines Lebens verdirbt und schändet, das kann man nicht untersuchen, ohne mit Zorn und Scham an die eigene Jugend zu denken.“1 Beim Lesen dieser Zeilen könnte man meinen, Hermann Hesse kannte die Spannungen zwischen Benjamin und Frau Ferros.
Abschließend erwähnte Frau Ferros so ganz nebenbei, dass unser Sohn wegen seiner Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache sowieso keine Fremdsprache erlernen werde. Ich wagte es auch kaum zu hoffen, dass Benjamin später einmal ein oder zwei Fremdsprachen erlernen wird, aber wie konnte sie es denn von vornherein und so bestimmt ausschließen? Und was hatte dieses „Gespräch“ nun gebracht? Nichts, außer dass ich mich wieder einmal unverstanden, beschuldigt und zu Unrecht kritisiert fühlte, was mich frustrierte und wütend machte. Auf dem Rückweg kam mir der Gedanke, dass vielleicht genau das, was Frau Ferros als „liebevolle Konsequenz“ bezeichnete, zwei ihrer absoluten Lieblingswörter in ihren Berichten, die Ursache für Benjamins Stressreaktionen darstellte. Und wenn ihre Erziehungsmethoden „liebevoll“ waren, dann mochte ich lieber nicht darüber nachdenken, wie die nicht liebevollen Alternativen denn ausgesehen hätten. Am nächsten Tag wollte mir das Gespräch einfach nicht aus dem Kopf gehen und ich hätte gern ganz laut Musik angestellt, um meinen Gedankenkreisen nicht mehr folgen zu müssen. Im Nachhinein fiel mir auf, dass Frau Ferros teilweise wie eine Mutter mit mir geredet hatte: „Na, dann kaufen Sie ihm doch ein Skateboard und dafür ein Computerspiel weniger.“ Wieso ließ ich mir das bieten und wieso hatte ich auf solche Äußerungen keine passende Antwort? Erstaunlicherweise brachte Benjamin an jenem Freitag eine wolkenlose Sonne mit nach Hause, und das, obwohl er doch Frau Ferros am Vortag beim Mittagessen „mehrere Male“ unter dem Tisch gegen das Bein getreten habe. Hatte Frau Ferros etwa doch über meine Ausführungen nachgedacht?
Die Tomatis-Methode und Therapien, die sich daraus ableiteten, schienen uns immer wieder einzuholen. Benjamins Ergotherapeutin Jenny legte uns eine erneute Hörprüfung sowie die sofortige Durchführung eines Horchtrainings dringend ans Herz. Da Jenny bis jetzt systematisch, mit fundierten Kenntnissen und erfolgreich mit Benjamin gearbeitet hatte, ließen wir uns überreden und schleppten unseren Sohn in die von ihr empfohlene HNO-Praxis, um dann nach mehreren Terminen erneut zu erfahren, dass keine periphere Hörstörung vorliege und alle Befunde im Normalbereich seien. Uns wurde eine logopädische Therapie vorgeschlagen, von einer auditiven Wahrnehmungstherapie nach Tomatis hielt dieser Arzt nichts. Diese Strapaze hätten wir Benjamin ersparen können, aber uns erging es mit unserer Unsicherheit und der Suche nach besseren Therapien oder Wundermitteln sicherlich wie vielen Eltern in vergleichbarer Situation: Wenn sich etwas verlockend anhört, muss es zumindest erst einmal näher betrachtet werden. Alfred A. Tomatis war ein französischer HNO-Arzt, der die Auffassung vertrat, dass „eine Veränderung der Hörfähigkeit automatisch eine Veränderung der Stimme und des Verhaltens zur Folge hat. […] Die Erkenntnis, daß die Psyche das Hören- bzw. Nichthörenwollen unbewußt beeinflußt, führte ihn zu ausgedehnten Versuchen, auf den Hörvorgang Einfluß zu nehmen.“2 In der Therapie werden verschiedene Frequenzen aus Musikstücken, meistens von Mozart, oder aus Stimmaufnahmen der Mutter herausgefiltert, um dann bei der Wiedergabe der Tonbänder die Entwicklungsschritte des Horchens nachzuvollziehen. Schon zwei Jahre zuvor hatte uns Leons Vater auf einen Zeitungsartikel hingewiesen, in dem über ein Hörstudio für Audio-Psycho-Phonologie berichtet wurde. Leon besuchte daraufhin einen Informationsabend in dieser Einrichtung, kam aber ziemlich enttäuscht nach Hause, weil ihn die angeführten wissenschaftlichen Grundlagen der Therapie nicht überzeugt hatten, und meinte dazu: „Einfache Antworten auf komplizierte Fragen machen mich prinzipiell skeptisch.“ Er brachte einen Kostenvoranschlag mit, nach dem die erste Kur in drei Teilen knapp 4000 DM kosten würde, weitere notwendige Teile von je acht Tagen täten dann 750 DM kosten. Da die Therapie nicht von den Krankenkassen anerkannt wurde, hätten wir diese Kosten selbst zu tragen. Als wir die Preisliste weiterlasen, kamen wir zu dem Punkt, dass für behinderte Kinder ab der achten Kur „nur“ noch 630 DM pro Teil bezahlt werden mussten. Nach langen Diskussionen entschieden wir, dass wir dieses Geld besser in Lernmaterial und Therapiegegenstände investieren sollten.
Aber damit war dieses Thema noch nicht vom Tisch. Ein halbes Jahr bevor Jenny mich auf die Tomatis-Therapie ansprach, erzählte mir Anabels Mutter ganz aufgeregt, dass sie jetzt mit ihren beiden Töchtern an einer derartigen Therapie teilnahm. Die Kosten für Anabel übernahm der „Spastikerverband“, für Isabel musste sie nur sehr wenig bezahlen, weil es bei Zwillingen erhebliche Rabatte gab. Während die beiden Mädchen sich dieser Therapie unterzogen, besorgte ich mir alle verfügbaren Bücher von Alfred A. Tomatis und studierte sie. Auch nach dem Lesen der Originalliteratur war ich von der Methode nicht überzeugter als eineinhalb Jahre zuvor. Im Flyer der Fachgemeinschaft für Audio-Psycho-Phonologie verwirrte mich die Aussage, dass eine Unmenge von Störungen bis hin zu schwersten Behinderungen durch diese Behandlung gemildert oder geheilt werden könnten. Nach Beendigung der Therapie der Zwillinge befragte ich ihre Mutter nach den Erfolgen, in der Hoffnung, jetzt eine wundervolle Geschichte zu hören, damit auch wir uns auf diese Therapie stürzen konnten. Anabels Mutter erzählte mit leicht enttäuschter Stimme, dass sie das Gefühl habe, dass Anabel sich jetzt ein bisschen besser und ein wenig länger aufrichten konnte. Und Isabel, die etwas hyperaktiv und motorisch ungeschickt sei, schaffe es, über kleinere Hindernisse zu springen. Vor der Therapie sei sie mit Sicherheit das einzige Kind gewesen, welches hinfiel, wenn alle Kinder über ihre aufgereihten Schultaschen sprangen. Aber wie konnte man jetzt sagen, ob sich diese kleinen Fortschritte nicht auch ohne diese Therapie eingestellt hätten? Das war unmöglich, also beschlossen wir ein zweites Mal, von dieser Therapie Abstand zu nehmen. Umso mehr verwundert es mich im Nachhinein, warum wir dieses Thema noch ein drittes Mal aufgriffen. Dieses Mal las ich im Internet Unmengen von Fallberichten, welche mich ebenfalls nicht überzeugen konnten. Unsere dreimalige ablehnende Entscheidung war letztendlich wohl richtig, denn: „Es ist zu vermuten, dass unspezifische Effekte, die in Verbindung mit dem auditorischen Integrationstraining auftraten, wie mehr Aufmerksamkeit durch die Eltern, Üben von ruhigem Sitzen, Erwartung der Eltern, eher einen Einfluss zeigten als die Therapie selbst […]. Die auditorische Integrationstherapie ist deshalb als eine zu unspezifische Therapie zu werten, die für die Förderung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen nicht ausreicht […].“3
Erfahrungen mit „unspezifischen Effekten“ wie „mehr Aufmerksamkeit durch die Eltern“ konnten wir bereits mit Conrads Neurodermitis-Erkrankung sammeln. Diese brach unmittelbar nach Benjamins Geburt aus und wurde trotz verschiedener Behandlungen wie Bäder und Salben immer schlimmer. Leon stieß damals bei seinen Recherchen auf eine private Klinik in den Schweizer Alpen und schickte uns für zwei Wochen dorthin, während er sich zu Hause um Benjamin kümmerte. Jene Klinik versprach, durch eine spezielle Diät diese Hautkrankheit zu heilen. Der ärztliche Leiter der Klinik teilte mir damals mit, dass aufgrund der genetischen Prädisposition auch unser jüngerer Sohn sowie das ungeborene Kind in meinem Bauch davon betroffen sein werden. Tränenüberströmt saß ich nach diesem Gespräch, von Übelkeit geplagt, auf einer mondänen Treppe in der Klinik, weil ich glaubte, diese mir soeben eröffnete Herausforderung nicht zu meistern. Damals konnte ich nicht ahnen, dass die Hautprobleme der Kinder zu unseren Nebenproblemen zählen werden. Ich lernte, viele Gerichte nach dieser speziellen Diät zuzubereiten, und wendete meine Erkenntnisse nach unserer Rückkehr zu Hause an. Conrads Neurodermitis hatte sich allerdings schon vor der Reise deutlich gebessert, denn von dem Moment an, wo er von uns über die geplante Reise in Kenntnis gesetzt worden war, entspannte sich seine entzündete Haut. Wenige Wochen nach der Reise war er völlig beschwerdefrei und ist es seitdem auch nahezu geblieben, obwohl wir die anstrengende Diät nach Conrads Heilung schrittweise aufgegeben hatten. Die eigentliche Heilung für Conrad bestand wohl eher in der intensiven Zuwendung, die er in dieser Zeit erfahren hatte, denn Neurodermitis ist eine Hauterkrankung, die eng mit dem Zustand der Psyche verknüpft ist. Krankheitsschübe werden meistens durch emotionalen Stress ausgelöst. Die ausgedehnten Wanderungen in den malerischen Bergen, das aufregende Fahren mit der ratternden Zahnradbahn oder auch den spannenden Besuch einer Wasserfestung im Genfer See muss mein Erstgeborener als sorgenfreien Urlaub empfunden haben. Der Arzt, welcher mich damals beraten hatte, sollte leider recht behalten, denn sowohl Benjamin als auch Pascal mussten immer wieder mit Neurodermitis-Schüben kämpfen, diese Hautirritationen wurden aber glücklicherweise nie so schlimm wie seinerzeit die ihres älteren Bruders.
Zu unserem Klinikaufenthalt in der Schweiz drängt sich mir noch eine andere Erinnerung auf. Als ich eines Tages mit Conrad von einem Ausflug zurückkehrte und auf einen kleinen Spielplatz mit hölzernen Bergtieren zusteuerte, entdeckte ich dort eine Mutter mit einem niedlichen, rotblonden Mädchen. Als dieses Mädchen Conrad erblickte, rief es voller Freude: „Look Mummy! What a nice red balloon!“ Es schaute erwartungsfroh zu seiner Mutter auf und zeigte gleichzeitig mit seinem winzig kleinen Fingerchen auf Conrads prall gefüllten Luftballon, der allerdings nicht rot, sondern orange war. Dies versetzte mir einen tiefen Stich ins Herz, weil das kleine Mädchen in Benjamins Alter war und doch so viel mehr konnte. Über den Luftballon kam ich mit der Engländerin ins Gespräch und erfuhr, dass ihre Tochter vor wenigen Tagen zwei Jahre alt geworden war. Benjamin würde in zwölf Tagen ebenfalls dieses Alter erreichen. Absurderweise schockte mich dieses kleine Erlebnis so sehr, weil ich plötzlich feststellen musste, dass auch gleichaltrige Kinder anderer Nationalitäten weiter entwickelt waren als mein kleines Söhnchen. Bei nüchterner Betrachtung wäre mir das natürlich klar gewesen, aber in diesem Moment spielten mir meine Gefühle einen bösen Streich.
Die Gesamtelternvertretung von Benjamins Schule organisierte jedes Jahr eine klassenübergreifende Eltern-Schüler-Fahrt in Form eines verlängerten Wochenendes. In diesem Jahr beschloss ich, daran teilzunehmen, weil ich dies als gute Gelegenheit zum Austausch mit anderen Eltern und zum Kennenlernen von Schülern, welche die Schule meines Sohnes besuchten, empfand. Da Leon keinen Urlaub bekam, fuhr ich mit Benjamin und Conrad in dieses malerisch an einem See gelegene Camp. Gleich der erste Tag war mit Aktionen angefüllt, sodass bei Benjamin keine Langeweile aufkam. Nach der Fahrt mit einer Pferdekutsche, wo mein Sohn neben dem Kutscher auf dem Kutschbock sitzen durfte und darüber äußerst erfreut war, wanderte ich mit meinen Söhnen ins Nachbardorf, um dort üppig dekorierte Rieseneisbecher zu vertilgen. So verbrachten wir die Zeit bis zum Abend störungsfrei und fanden uns beim Dunkelwerden am großen Feuerplatz ein. Ein Lagerfeuer wurde entzündet und die Kinder konnten Spießbrot backen, wofür sie den Teig selbst hergestellt hatten. Zu meiner Enttäuschung und Entrüstung saßen die anderen Eltern jedoch phlegmatisch am Feuer, rauchten, tranken Alkohol in Gegenwart ihrer Kinder und redeten fast nur über Fußball. Da sich zudem auf früheren Fahrten bereits Cliquen gebildet hatten, fand ich keinen Anschluss. Anabels Mutter, die ebenfalls zum ersten Mal mit ihren beiden Töchtern an dieser Fahrt teilnahm, erging es genauso und so leisteten wir uns gegenseitig Gesellschaft.
Am folgenden Morgen erfuhren wir von der Leitung des Camps, dass das verlockende Seeufer verschilft sei und dass diese Seite des Sees aus Naturschutzgründen nicht zum Baden freigegeben war. Conrad hatte sich sehr auf das Baden gefreut und nachdem ich Benjamin im vergangenen Sommer zum ersten Mal in einen See gelockt hatte und er dabei seine Angst vor den winzigen, flink umherschwimmenden Stichlingen überwinden konnte, wollte ich dieses Erfolgserlebnis hier festigen, was aber nun bedauerlicherweise ins Wasser fiel. Zum Glück beinhaltete unser Gepäck die riesigen Wasserpistolen der Kinder und so lieferten sich Conrad und Isabel wenigstens ausgiebige Wasserschlachten. Mein mittlerer Sohn verbrachte den gesamten Vormittag damit, ganz allein in einem gigantischen Sandkasten zu sitzen und die warmen, blassgelben Körnchen beglückt durch seine Finger rieseln zu lassen. Ich wusste, dass er Stress abbauen musste, und ließ ihn gewähren. Am Nachmittag gelang es mir, Benjamin das Tischtennisspielen beizubringen, und wir besuchten eine Bastelstunde mit Naturmaterialien, wo mein Sohn durch eine elegante Raupe aus Kiefernzapfen das Aufsehen der anwesenden Erwachsenen erregte. Gegen Abend überzeugte ich Benjamin mühsam, zu den Jungen aus seiner Schule zum Billardspielen zu gehen, denn Billard konnte er bereits seit seinem vierten Geburtstag gut spielen. Ich begleitete ihn bis zur Tür des Clubraumes und beobachtete, wie er zielstrebig auf die Jungen zuging, etwas schwer Verständliches sagte und beherzt nach einem Queue griff. Ein wenig älterer, gehbehinderter Knabe stellte sich vor meinem Sohn auf und bellte ihn an: „Du lern erst mal richtig sprechen, bevor du mit uns spielen darfst.“ Benjamin zog seine Hand zurück, verließ wortlos den Raum und marschierte wieder zur Tischtennisplatte, um unser vorheriges Spiel erneut aufzunehmen, obwohl sich bereits die aufkommende Dunkelheit über die gesprenkelte Steinplatte senkte. Die Kinder im Billardraum brachen in schallendes Gelächter aus und ich verfiel in völlige Hilflosigkeit. Nicht im Traum hätte ich daran gedacht, dass auch behinderte Kinder so gehässig zueinander sein konnten. Wieso aber eigentlich nicht? War ich zu naiv und wie verhält man sich in so einer Situation als Elternteil richtig? Ich wusste es nicht und war froh, dass die Abenddämmerung meine Tränen, welche auf die Tischtennisplatte tropften, verbarg. Hatte ich mir zu viel vorgenommen?
Der gesellige Abend mit Grillen, Musik und Tanz verlief nicht viel anders als der Abend am Lagerfeuer am Tag zuvor. Außer ein paar Höflichkeitsgesprächen kam kein Austausch zwischen mir und anderen Anwesenden zustande. Ich war froh, als mich Benjamin gegen zweiundzwanzig Uhr in unser Zimmer zerrte, um ins Bett gehen zu können. Eingeschlafen ist er dann allerdings erst vier Stunden später. In der nicht enden wollenden Nacht telefonierte ich aus Sehnsucht und Heimweh mit Leon und erfuhr dabei, dass sich Conrads Aufnahmebescheid für das gewünschte Gymnasium in der Post befunden hatte. Das war genau die gute Nachricht, die ich jetzt zum moralischen Wiederaufbau benötigte. Den dritten und letzten Tag füllten wir neben dem Essen von Eis ganz unspektakulär mit Tischtennisspielen, wobei Benjamin durch sein fleißiges Üben erstaunliche Fortschritte erreichte. In den folgenden Jahren nahmen weder wir noch Anabels Familie ein weiteres Mal an diesen Fahrten teil.
Conrad schleppte nicht nur die Pokémons in unsere Familie ein, sondern generierte mit seinem Interesse an der Star-Wars-Saga ebenfalls ein neues Verlangen bei seinem Bruder. Völlig einsichtig akzeptierte Benjamin allerdings, dass er mit seinen acht Jahren nur die Filme, welche eine Altersfreigabe ab sechs Jahren hatten, sehen durfte. Wir mussten ihm dazu lediglich das entsprechende Siegel auf der Filmverpackung zeigen. Ebenso wie bei den Pokémons sammelte unser Sohn nicht nur Wissen, sondern auch Produkte zum Thema Star Wars. Und wiederum hatte ich mit dieser neuerlichen Begierde ein wunderbares Motivationsmittel an der Hand. Als der Film „Star Wars Episode I – Die dunkle Bedrohung“ in die deutschen Kinos kam, gab es in den Frühstücksflocken eines bekannten Herstellers Plastikfiguren zum Sammeln. Am Anfang lief alles ganz entspannt. Conrad und Benjamin sammelten, tauschten untereinander und gaben Figuren, die sehr häufig vorkamen, Pascal zum Spielen. Je mehr Figuren unser mittlerer Sohn allerdings besaß, desto unruhiger wurde er, weil er unbedingt alle zehn Sammelfiguren in seinen Besitz bringen musste. Als er acht verschiedene Figuren sein Eigen nannte, konnte er überhaupt nicht mehr schlafen und kam andauernd aus dem Bett, um zu fragen, ob wir am nächsten Tag eine Packung „Müsli“ kaufen werden. Da dieser Zustand unerträglich wurde, beschloss Leon entgegen unseren sonstigen Prinzipien, am Wochenende Frühstücksflocken auf Vorrat zu kaufen. In den ersten zwei Packungen, welche Leon mitbrachte, fand sich sofort Figur Nummer neun, ein Umstand, welcher allerdings wenig beruhigend auf Benjamin wirkte. Im Gegenteil, die Sorge um die zehnte Figur war so allmächtig, dass bei unserem Sohn keine Freude aufkam. Conrad und Leon liefen an diesem Samstag noch einige Male los, um weitere Packungen zu kaufen, aber erst in der zwölften Schachtel fanden wir die begehrte Statue. Benjamin reihte sie mit tiefer Erleichterung in die Schlange der anderen Figuren in seinem Setzkasten ein und ging in den kommenden Tagen immer wieder zu dieser Ansammlung hin, um zu überprüfen, ob auch alles seine Ordnung hatte. Unserem Ältesten misslang es übrigens, seine Sammlung zu vervollständigen, was ihn jedoch nicht sonderlich grämte. Mit dieser seltsam anmutenden Aktion haben wir uns ein Stück Nachtruhe im wahrsten Sinne des Wortes zurückgekauft.
Sicherlich war Benjamin so fasziniert von der Star-Wars-Saga, weil sich ein steter Kampf zwischen Gut und Böse durch die gesamte Handlung zieht, sodass die Geschichte wie ein modernes Märchen anmutet. Nach dem Anschauen des ersten Films aus dem Jahr 1977, den wir bei einer Ausstrahlung im Fernsehen auf einem Videoband aufgenommen hatten, wünschte sich Benjamin einige Zeit später das digital aufgearbeitete Werk als Geschenk. Beim ersten Abspielen kommentierte er aufgeregt jede noch so kleine Verbesserung im Film, sei es nun ein grellerer Lichtblitz, ein Monster, welches mehr Zähne aufwies, oder eine kurze Szene, die mit dem damaligen Stand der Technik noch nicht realisierbar gewesen war. An einigen Stellen seiner Ausführungen waren wir ungläubig, wurden aber beim Vergleichen der Bänder immer eines Besseren belehrt.
Es war nicht schwer vorherzusehen, dass Frau Ferros die Star-Wars-Filme verurteilen wird, obwohl ich vermutete, dass sie selber diese Filme nie angeschaut hatte. Um Benjamin weitere Probleme zu ersparen, versuchten wir ihm zu erklären, dass er mit seiner Lehrerin besser nicht über diese Filme reden sollte. Aber er verstand uns nicht und es kam, wie es kommen musste. Frau Ferros regte sich bei jeder Gelegenheit über alles, was auch nur im Entferntesten mit dem Thema Star Wars zu tun hatte, auf und versuchte, Benjamin mit aller Macht davon abzubringen, sodass unser Sohn hin- und hergerissen war, weil er nach Meinung seiner Lehrerin die Filme nicht sehen durfte, seine Eltern es ihm aber erlaubten. Ich fragte mich damals, ob Frau Ferros die anderen Jungen der Klasse, welche die fraglichen Filme auch ansehen durften, ebenso bedrängte. Die uneingeschränkte Ehrlichkeit unseres Sohnes brachte uns nicht nur auf diesem Gebiet eine Einmischung in unser Privatleben, welche nur schwer zu ertragen war.
Benjamins erste Diktate erwiesen sich als genauso unverständlich wie seine frühe Sprache: „Herlst. Im Herlst renet es fot. Aebr heute schint die Sonne. Der Wind bält die Bätter von den Bäumen. Die bunter Darnchen steien hoch. Jeser Kind feuer sind.“ (Herbst. Im Herbst regnet es viel. Aber heute scheint die Sonne. Der Wind bläst die Blätter von den Bäumen. Die bunten Drachen steigen hoch. Jedes Kind freut sich.) Da unser Sohn die phonematische Struktur eines Wortes nicht erfasste, war es ihm nur möglich, ganzheitlich eingeprägte Wörter richtig zu verschriften. Daraufhin stellte Frau Ferros bei der Schulleitung einen „Antrag auf Überprüfung einer LRS“ (Lese- und Rechtschreibschwäche), informierte uns darüber und forderte unser Einverständnis für eine Untersuchung durch die zuständige Schulpsychologin. Wir verweigerten dieses Einverständnis, da wir aus unserer negativen Erfahrung wussten, was dabei herauskommen konnte, wenn unbekannte Fachleute unseren Sohn überprüfen wollten, stattdessen sollte Benjamin diesbezüglich unserer Psychologin Frau W. vorgestellt werden. Frau Ferros äußerte ihr Unverständnis darüber und unterstellte uns, unserem Sohn eine schnelle Hilfe verweigern zu wollen. Trotzdem blieben wir bei dieser Entscheidung. Außerdem teilte ich Frau Ferros mit, dass bei Benjamin allenfalls eine Rechtschreibschwäche, aber keinesfalls eine Leseschwäche vorliegen konnte, da er zumindest zu Hause fleißig und sinnerfassend las, was sie ein halbes Jahr später bestätigte: „Während er, bedingt durch seine Artikulationsprobleme, Lesetexte noch fehlerhaft vorliest, hat er stilllesend keine Probleme auch bei ungeübten Texten den Sinn nahezu vollständig zu erfassen.“
Obwohl die Frage einer vorliegenden Rechtschreibschwäche bei unserem Sohn noch nicht geklärt war, versorgte uns Frau Ferros mit einseitigem Informationsmaterial und drängte uns, unseren Sohn bei einem ganz bestimmten Nachhilfeinstitut anzumelden. Sie arrangierte auch ein Gespräch zwischen mir und einer Kollegin, deren Enkel in diesem besagten Institut einen Sommerkurs belegt hatte. Diese Kollegin war zwar mit den Fortschritten ihres Enkels zufrieden, gab aber zu bedenken, dass Benjamin, den sie aus einigen Vertretungsstunden kannte, dort nicht die richtige Förderung erhalten würde. Daraufhin wendete ich mich persönlich an diese Einrichtung und musste erfahren, dass die dort tätigen Pädagogen bis jetzt erst ein einziges Kind mit autistischen Zügen unterrichtet hatten und dass diese Therapie nach drei Stunden wegen Erfolglosigkeit abgebrochen worden war. Damit hielten wir es für unwahrscheinlich, dass Benjamin dort angemessene Förderung erhalten konnte. Unsere Weigerung zur Zusammenarbeit mit der Schulpsychologin hatte zur Folge, dass ich zum Schulleiter zitiert wurde, der ebenfalls versuchte, mich umzustimmen, was ihm aber nicht gelang. Wieso versuchten die beteiligten Personen in der Schule uns immer das Gefühl zu vermitteln, das Falsche für unseren Sohn zu tun?
Bis zu unserem Termin in der Klinik für Audiologie und Phoniatrie in den Sommerferien konnte es nicht schaden, sich mit dem Thema Lese- und Rechtschreibschwäche zu beschäftigen, damit wir, falls Benjamin davon betroffen war, darauf vorbereitet sein würden. Wir mussten sehr schnell feststellen, dass es eine Fülle an Literatur zu diesem Thema gab, welche aber keinesfalls für Klarheit oder gar Aufklärung zu sorgen vermochte. In der Fachwelt herrschte keine Einigkeit darüber, wann eine Lese-Rechtschreib-Schwäche oder auch Legasthenie vorliegt, welche Kriterien für eine Diagnose erfüllt sein müssen, welche Tests sich für die Diagnostik eignen … „Zu den Merkmalen, die am häufigsten beobachtet werden, zählen gravierende Lese-, Rechtschreib- und Schreibschwäche sowie die Verkehrung von Symbolen. Dazu kommen oft Verwirrung im Bereich von Raum und Zeit, Desorientierung und erschwertes Begreifen gewisser Dinge.“4 Von dieser Aufzählung an Merkmalen traf auf unseren Sohn jedoch nur zu, dass er Rechtschreibprobleme und ein schlechtes Zeitgefühl hatte, welches ich jedoch nicht als „Verwirrung“ bezeichnen würde. Verwirrend wirkten auf uns allerdings seitenlange Auflistungen möglicher Ursachen und die ausführlichen Beschreibungen misslungener Schulkarrieren von Betroffenen. In diesem Zusammenhang war Folgendes gut zu wissen: „Legasthenie-Diagnosen haben – im Vergleich zu anderen medizinischen Diagnosen – eine relativ hohe Fehlerquote. Fehldiagnosen sind hier durchaus keine Seltenheit, obgleich Ärzten und Psychologen ein vielfältiges Test-Instrumentarium zur Verfügung steht. Dies hat seinen Hauptgrund darin, daß sich die Experten bis heute nicht auf die Festlegung eindeutiger Legasthenie-Diagnose-Kriterien verständigen konnten und – etwas überspitzt ausgedrückt – jeder Schulpsychologe mehr oder weniger seine eigenen Maßstäbe von Normalität bzw. Abnormalität zugrundelegt.“5
Trainingsmethoden zur Verbesserung der Lese- und Rechtschreibleistungen gab es in Hülle und Fülle, ebenso mangelte es im Fachhandel nicht an diversem Übungsmaterial. Da jedoch keine typischen Legasthenie-Fehler existieren, sondern vielmehr jedes Kind seine eigenen Fehler macht, schien es uns sinnvoll, an dieser Stelle anzusetzen. Wir analysierten Benjamins Fehler und stellten sehr schnell fest, dass ihm nie Fehler beim Setzen von Satzzeichen sowie bei der Groß- und Kleinschreibung unterliefen. Schon früher war uns aufgefallen, dass unser Sohn die deutsche Sprache nicht wie seine Muttersprache, sondern wie eine Fremdsprache erlernte. Zwangsläufig fragten wir uns deshalb, ob Benjamins bildhaftes Erfassen der ihn umgebenden Welt als seine eigentliche „Muttersprache“, oder wohl eher als sein „Urdenken“, anzusehen war. Des Weiteren unterliefen unserem Sohn beim Schreiben von Diktaten am Computer auffallend weniger Fehler im Vergleich zu handschriftlichen Diktaten (in das Schreibprogramm von Benjamins Computer war zur damaligen Zeit keine Rechtschreibkontrolle implementiert). Der Grund hierfür war wohl darin zu sehen, dass die feinmotorische Anstrengung beim Schreiben mit der Tastatur weitgehend wegfiel und unserem Sohn so mehr Energie zur Konzentration auf die Rechtschreibung zur Verfügung stand. Die Verknüpfung dieser beiden Beobachtungen brachte mich auf die Idee, für Benjamin Computerprogramme zu besorgen, die für Ausländer, welche die deutsche Sprache erlernen wollen, konzipiert waren. Diese Programme erklärten auch Dinge, welche für Muttersprachler selbstverständlich sind. Benjamin nahm diese Übungen gut an und zeigte keine Probleme damit, dass die Aufgaben ausnahmslos für Erwachsene gedacht waren. Einige Fragen, wie beispielsweise „Bist du verheiratet?“, verwirrten ihn anfangs, aber unsere Erklärung, dass dies ein Programm für Erwachsene ist, genügte ihm als Begründung. Besonders große Erfolge bescherte uns Lernsoftware vom Auralog-Verlag, weil diese Programme über eine Spracherkennung verfügten. Für Benjamin war es ausgesprochen effektiv, auf dem Monitor eine Kurve zu sehen, die ihm zeigte, wie gut sein gesprochenes und mit einem Mikrofon aufgenommenes Wort mit dem Idealbild des Wortes übereinstimmte. Er brauchte eine Weile, bis er akzeptierte, dass die Kurven nie ganz gleich sein würden. So trainierte er nicht nur Schreiben, sondern auch Hören und Sprechen. Je besser er die Wörter hören und sprechen konnte, desto fehlerfreier wurde ihre Verschriftung. Wir registrierten jedoch umgekehrt auch den Effekt, dass unser Sohn jetzt Wörter deutlich aussprechen konnte, von denen er die korrekte Schreibweise gelernt hatte. So gelang ihm zum Beispiel nach knapp einem Übungsjahr die verständliche Aussprache des beliebten Satzes „Die Griechen kriechen nicht.“ Auch wenn sich diese Schilderungen jetzt einfach anhören, so stellten sich dauerhafte Erfolge erst nach jahrelangem, zähem Üben ein.
Schulferien, egal ob kurze oder lange, brauchten für Benjamin immer eine feste Struktur, andernfalls pflegte sein Wohlbefinden erheblich gestört zu sein, was für alle Beteiligten äußerst anstrengend und unangenehm werden konnte. Einfach einmal so in den Tag hinein leben, das war etwas, was unseren Sohn außerordentlich verunsicherte und beunruhigte. Deshalb begann ich in diesem Sommer damit, Ferienpläne zu schreiben. Ich erstellte für jedes Kind eine Liste mit Aktivitäten, die in verschiedene Unterkategorien aufgeteilt waren, und legte für unbekannte Orte und Tätigkeiten Informationsmaterial bereit. Jeder konnte nun in der Liste ankreuzen, was er gern tun wollte. Der Sinn und Zweck der ganzen Aktion bestand darin, dass ich nicht mehr nur wie ein Animateur für Benjamin auftreten wollte, sondern dass unser Sohn selber entscheiden sollte, was er tun möchte und was nicht, denn Entscheidungen zu treffen, fiel ihm sehr schwer. Meistens traf er eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung und um dem vorzubeugen, gab es auf meiner Liste Punkte, die Pflicht für Benjamin waren. Weiterhin forderte ich meinen Sohn auf, eine bestimmte Mindestanzahl an Aktivitäten aus jedem Block auszuwählen, wobei meine erste Liste aus folgenden Blöcken bestand: Partys, Innenaktivitäten (Brettspiele, Experimentierkästen, Basteln), Außenaktivitäten (Sportspiele, Museen und Gärten, Baden), Essenswünsche und Nachtaktivitäten. Während Pascal und Conrad über die maximal mögliche Anzahl der Wünsche jammerten, weil sie mehr Ideen und Interessen hatten, als zeitlich in den Ferien unterzubringen waren, quälte sich Benjamin sehr damit, die Mindestanzahl an Aktivitäten in jedem Feld auszuwählen. Die Ferienpläne galten nur für die Zeit, die wir zu Hause verbrachten, nicht aber für die Dauer unserer Reisen. Nachdem alle Kinder ihre Wünsche geäußert hatten, trug ich diese in unsere im Flur aufgehängten Wochenpläne ein und versah die Aktivitäten mit kleinen Bildchen, um Benjamin und Pascal die Orientierung zu erleichtern. In den folgenden Jahren ermunterte ich meine Kinder, die Ferienpläne selber zu schreiben, am Ende der Ferien verschiedene Aktivitäten zu bewerten und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Später überließ ich ihnen die komplette Planung von einzelnen Ausflügen, Partys oder Thementagen zu Hause. Leon kreierte als Anreiz für Benjamin die Auszeichnung „Partymeister“, welche aus einer Urkunde und einem Geschenk bestand und in Bronze, Silber und Gold vergeben wurde. Benjamin strengte sich unheimlich an, um auch in den Besitz der begehrten Prämien zu gelangen. Lernprogramme, verschiedene Aufgaben zur deutschen Sprache sowie Arzt- und Therapietermine prägten viele Jahre lang die Schulferien der Kinder, da wir es uns nicht erlauben konnten, größere Pausen in Benjamins Übungen zuzulassen, weil er jedes Mal nach derartigen Pausen, welche durch Reisen und Weihnachten entstanden, mindestens drei Wochen benötigte, um seinen Arbeitsrhythmus wiederzufinden.
Burger und Eis, das waren die beiden „Gerichte“, welche Benjamin in diesem Sommer zuzubereiten lernte. Eine Zutatenliste für die Burger erstellen, die Lebensmittel einkaufen und dann den Tisch decken, dafür benötigte unser Sohn mit genauen Anweisungen – Schritt für Schritt und immer wieder erklären – fast den ganzen Tag, obwohl die Buletten für die Burger schon von Leon fix und fertig gebraten worden waren. Conrad und Pascal bereiteten in dieser Zeit gemeinsam einen Obstsalat zu, sozusagen aus Langeweile. Benjamin in die Küche zu locken, war der erste Erfolg in diesen Ferien, der zweite bestand in einer riesengroßen Blumenwiese, welche wir vier alle zusammen aus den verschiedensten Materialien bastelten. Die Ideen und der Elan meiner Randkinder waren dabei unerschöpflich, so zierte beispielsweise eine lilafarbene „Löffelblume“ die Mitte des Kunstwerkes, welche aus gehorteten Plastiklöffeln zusammengesetzt worden war. Benjamin ließ sich von der Begeisterung seiner Brüder in gewissem Maße mitziehen und leistete auch einen Beitrag, wobei es seine Idee war, der Wiese ein Flüsschen mit Fischen und Seerosen zu verpassen. Es kostete unseren mittleren Sohn unvorstellbar viel Kraft, so lange mit seinen Brüdern zusammenzuarbeiten, denn üblicherweise bevorzugte er es, allein zu basteln, zu zeichnen … Da ich aber wusste, wie wichtig es in seiner späteren Schullaufbahn einmal sein wird, in einer Gruppe bestimmte Dinge zu erledigen, war ich der Meinung, dass ich gar nicht früh genug damit anfangen konnte, dies mit Benjamin zu üben. Nahezu alles, was Conrad und Pascal mit Freude erfüllte, bedeutete für Benjamin eher Training oder Therapie. Abgesehen vom Lesen, Bauen mit LEGO-Bausteinen oder Spielen von Computerspielen tat unser mittlerer Sohn fast gar nichts freiwillig. Dass mein Handeln dennoch richtig war, bestätigte mir Benjamin drei Jahre später, wo er nach jeder Aktion, zu der ich ihn genötigt hatte, sagte: „Danke, Mami, dass du mich gezwungen hast.“