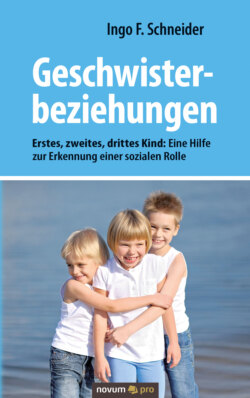Читать книгу Geschwisterbeziehungen - Ingo F. Schneider - Страница 6
ОглавлениеVorwort
Warum versucht Anna schon früh, wie Vater und Mutter, mit Messer und Gabel zu essen, während ihre kleine Schwester noch lange mit der Hand isst? Warum bleibt ein ältestes Kind, wenn Besuch kommt, erst einmal auf Distanz und beobachtet, während der kleinere Bruder ohne Scham mit dem Besucher spricht. Warum sorgt sich ein erstgeborener Erwachsener darum, ob man ihn erkennt, anerkennt und ob man ihn respektiert, während sich ein Zweitgeborener eher fragt, ob man ihn sympathisch, lieb und lustig findet. Immer wieder treffen wir in unserem Alltag auf solche Verschiedenheiten, sowohl wir Erwachsene, wenn wir uns mit unserer Umgebung vergleichen, als auch die Eltern, die solche Unterschiede bei ihren Kindern feststellen.
Eltern sind immer wieder beeindruckt von der reichhaltigen Verschiedenheit ihrer Kinder. Dabei wird gern übersehen, dass gerade diese Verschiedenartigkeit der Kinder ein grosses kreatives Potenzial in der Dynamik geschwisterlicher Beziehungen darstellt. Oft taucht die Frage auf, woher diese Verschiedenheit kommen könnte. Gelegentlich erkennt man bei dem einen oder anderen Kind Gesichtszüge, Körperhaltungen oder Verhaltensweisen des Vaters, der Mutter, der Grosseltern, Onkel und Tanten, und man erkennt genetische Bestimmungen. Auch an geschlechtliche Unterschiede wird gedacht, oder es werden elterliche Erlebnisse während Schwangerschaft und Geburt diskutiert.
Aber besonders in der Erziehung werden Erklärungen für die Verschiedenheit der Geschwister gesucht. Dann stellen sich Eltern oft bange Fragen, was sie wohl bei dem einen oder anderen Kind anders gemacht haben. Ein wichtiges Anliegen der Eltern ist ja, gerecht zu sein, was oft dazu führt, dass sie versuchen, die Kinder gleich zu behandeln. Sie sind aber mit der Tatsache konfrontiert, dass dies grundsätzlich gar nicht möglich ist, denn zum einen sind die Kinder verschieden alt, was unterschiedliche Verhaltensweisen erfordert, und zum anderen machen die Eltern bei jedem Kind neue Erfahrungen, die ihr Verhalten bei den nächsten Kindern ändern.
Bei diesem Zwiespalt zwischen der Sorge um Gerechtigkeit in der Erziehung einerseits und der Verschiedenheit der Geschwister anderseits ist es naheliegend, dass der Stellung des Kindes innerhalb der Geschwisterreihe auch eine Bedeutung zukommt. In meiner Arbeit mit zahlreichen Familien setzte sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass jedes Kind bei seiner Ankunft eine andere Situation vorfindet und dass diese Situation ebenso wie andere Einflüsse für seine weitere Entwicklung verantwortlich ist. Es ist, unabhängig vom Einfluss der Erziehung, nicht das Gleiche, ob ein ankommendes Kind nur seine beiden Eltern vorfindet oder ob schon ein oder sogar mehrere Kinder anwesend sind. Es zeigte sich, dass dem Kind bei seiner Ankunft gar keine andere Möglichkeit bleibt, als die Rolle seiner Stellung in der Geschwisterreihe zu übernehmen.
Das Wissen um die Unausweichlichkeit der Rollenübernahmen erleichtert die Eltern häufig, da ihnen damit ein Teil der elterlichen Verantwortung abgenommen wird. Besonders in der weitverbreiteten Situation der modernen Kleinfamilie, in der beide Eltern arbeiten, ist es nicht verwunderlich, dass junge Eltern ihre Kinder in einer Stimmung erziehen müssen, in der Ängste und Schuldgefühle vorherrschen. Das ständige sich Anklammern an Normen, Erziehungsideale und ein «objektiv-richtiges» Verhalten lässt immer weniger Platz für freie Gefühlsäusserungen und für die unbelastete Freude an den Kindern. Mit dem Erkennen der, jeder Familie innewohnenden, Rollenübernahmen der Kinder können die Eltern viel leichter jedes Kind in seiner Eigenart erkennen, begleiten und es in seiner Entwicklung unterstützen.
Auch für Erwachsene ist das Erkennen ihrer eigenen Rollen oft eine Erleichterung. So ist es für einen Erstgeborenen befreiend, zu erkennen, dass Tausende von erstgeborenen Brüdern und Schwestern um ihn herum, wie er, die Tendenz haben, in nächtlichen Sorgengedanken über ihre Zweifel an ihren Fähigkeiten, ihrem Wert und ihrer Anerkennung zu grübeln. Ein Zweitgeborener kann leichter mit seinem Zwiespalt zwischen dem Drang nach Unabhängigkeit sowie seiner Angst vor Einsamkeit umgehen, wenn er erkennt, dass sich viele Zweitgeborene in seiner Umgebung mit der gleichen Frage auseinandersetzen. Ein erwachsener Drittgeborener fühlt sich weniger alleine, wenn er erkennt, dass auch andere Drittgeborene diese seine Mühe haben, mit der strengen Zeitstruktur unseres gesellschaftlichen Lebens umzugehen.
***
Geschwisterthemen beschäftigten schon seit jeher die Menschheit. Es gibt zahlreiche Legenden über Brüder und Schwestern, die wir aus Sagen und Märchen, aus der Bibel und der Mythologie kennen: Kain und Abel, Esau und Jakob, Kastor und Pollux, Romulus und Remus, Hänsel und Gretel und viele andere. Alle diese Figuren zeigen Rollenverhalten von Geschwistern in all ihren Auseinandersetzungen, mit ihren Stärken und ihren Schwächen.
In verschiedenen Kulturen war es zu gewissen Zeiten üblich, dass der erste Sohn den väterlichen Besitz erbte, der zweite Sohn in Kriegsdienst ging und der dritte Sohn Pfarrer, Mönch oder Lehrer wurde. Wir erkennen in dieser Grundidee eine deutliche Analogie zu den in diesem Buch beschriebenen Typologien des ersten, zweiten und dritten Kindes: das erste Kind als der Erhalter und Fortführer der elterlichen Tradition, das zweite Kind als Abenteurer und Entdecker fremder Welten und das dritte Kind als Sinnsucher der menschlichen Existenz. Diese ursprünglich sinnvolle Unterscheidung stiess sich allerdings an der Tatsache, dass die Mädchen in dieser Aufstellung ausgeschlossen waren, was unter den Söhnen Verschiebungen bewirkte, welche nicht mehr dem obigen Grundmuster entsprachen.
Auch in Filmen und in der Literatur treffen wir immer wieder Themen über Brüder und Schwestern an: Thomas Manns «Buddenbrooks», Dostojewskijs «Die Brüder Karamasow», Theodor Storms «Zur Chronik von Grieshuus», Franz Werfels «Die Geschwister von Neapel». Ich will hier auch «Narziss und Goldmund» von Hermann Hesse erwähnen, obwohl es sich hier nicht um leibliche Brüder handelt, aber Hesse beschreibt die beiden Protagonisten in ihrer Gegensätzlichkeit so tiefgründig, dass wir in ihnen deutlich einen Erstgeborenen und einen Zweitgeborenen erkennen. In der moderneren Literatur finden wir unter anderen «The Correction» von Jonathan Franzen, oder «Moon» von Tony Hillerman, unter den Filmen «Billy Elliot» von Stephen Daldry, «Gladiator» von Ridley Scott, «Interiors» von Woody Allen, «Kirschblüten-Hanami» von Doris Dörrie oder «Farinelli» von Gérard Corbiau.
Alle diese Darstellungen von Geschwistern in ihrem Zusammenwirken lassen uns eine Vielfalt von Beziehungsmöglichkeiten entdecken. So treffen wir zwei Brüder, zwei Schwestern, den älteren Bruder und seine jüngere Schwester, die ältere Schwester und ihren jüngeren Bruder, die drei Schwestern, die zwei Brüder mit der jüngeren Schwester und so fort. Dabei ergibt sich das Grundgerüst der Familienambiance immer aus der Zusammensetzung von Geschlecht und Geburtenrang und wir sehen ähnliche, sich wiederholende Typologien und Bilder des Mädchens, des Knaben, des Mannes, der Frau, aber auch des ersten Kindes, des zweiten Kindes und des dritten Kindes. Die Ähnlichkeit, ja Gleichförmigkeit, mit der die Letzteren immer wieder beschrieben werden, lässt auf ein diffuses Wissen der Autoren über typische Ausdrucksformen der Geburtenränge schliessen. Die einzelnen Bilder der Geschwisterrollen erhalten so eine archetypische Bedeutung.
Bei diesen stetigen Wiederholungen in der Darstellung der einzelnen Geschwisterrollen ist es daher um so erstaunlicher, dass bisher nicht mehr Versuche unternommen wurden, die einzelnen Typologien der Geschwister nach ihrem Geburtenrang zu systematisieren. Dies mag damit zusammenhängen, dass es bis Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts viele sehr kinderreiche Familien gab. Bei einem «Haufen» von sechs, acht oder über zehn Kindern sind spezifische Rollenverhalten der einzelnen Kinder weniger augenfällig als bei den heute üblichen Kleinfamilien mit zwei bis drei Kindern. Zum anderen war damals die Kindersterblichkeit sehr hoch, was dazu führte, dass die geschwisterlichen Rollenverhalten beim Tod eines der Kinder teilweise verschoben und eine anfangs klare Rollenverteilung verwischt wurde.
Ziel dieses Buches ist, den Leser mit den verschiedenen Geschwisterrollen vertraut zu machen. Es werden auch Arbeitsmethoden und Modelle vorgestellt, welche die Dynamik zwischen den Geschwistern, die zu den charakteristischen Äusserungsformen der Geschwisterrollen führen, aufzeigen.
Ingo F. Schneider