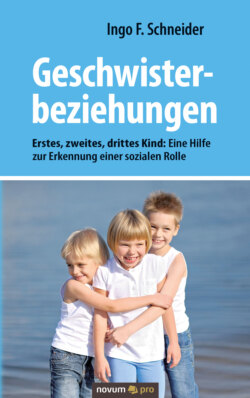Читать книгу Geschwisterbeziehungen - Ingo F. Schneider - Страница 8
ОглавлениеII Woher diese Unterschiede kommen: Die Prägung
Es ist heute allgemein üblich, die Verschiedenheit unter den Geschwistern mit dem Unterschied im elterlichen Verhalten gegenüber den Kindern oder mit psychischen Mechanismen wie der oft zitierten Entthronung1 des ersten Kindes durch die späteren, zu erklären. Oberflächlich betrachtet ist diese Betrachtungsart verständlich, da die Ankunft des ersten Kindes für die Eltern tatsächlich eine radikale Änderung ihres Alltagslebens, ihrer Beziehung zueinander und auch ihres sozialen Lebens mit sich bringt. Die folgenden Kinder finden dann Eltern vor, die ihre neue soziale Rolle bereits aufgenommen und erzieherische Erfahrung hinter sich haben.
Diese Betrachtungsweise könnte den Unterschied zwischen dem ersten und den jüngeren Kindern erklären, aber nicht die Tatsache, dass es auch unter diesen jüngeren Geschwistern markante Unterschiede gibt. Ich machte zahlreiche vergleichende Befragungen2, bei denen die verschiedenen Ausdrucksformen unter allen Geschwistern des gleichen familiären Haushaltes im vergleichenden Kontext erfragt wurden. In der folgenden Liste sind die aus diesen Befragungen offensichtlich gewordenen Gesetzmässigkeiten zusammengefasst.
Die Geschwistertypologien wiederholen sich im Dreierrhythmus: Die 4., 7. etc. Kinder zeigen die gleichen Ausdrucksformen wie das erste Kind, die 5., 8. etc. die gleichen wie das zweite und die 6., 9. etc. die gleichen Ausdrucksformen wie das dritte Kind.
Die ersten beiden Kinder zeigen Typologien, die in allem gegenteilig und ergänzend zueinander stehen. Diese polare Gegensätzlichkeit finden wir auch zwischen den vierten und fünften und wahrscheinlich auch zwischen den siebten und achten, etc. Kindern.
Die Geschwistertypologien bilden sich auch bei Zwillingen und im ersten Lebensjahr adoptierten Kindern aus.
Halbgeschwister, die in einem anderen Haushalt leben, haben keinen Einfluss auf die Prägung der Geschwisterrollen in der befragten Familie.
Die Ausbildung der Geschwistertypologien erfolgt unabhängig vom sozialen und kulturellen Einfluss und in den meisten Fällen auch unabhängig von individuellen, schicksalsmässigen Einflüssen.
Wir finden die gleiche Ausbildung der Geschwistertypologien auch in Familien mit alleinerziehenden Elternteilen.
Die Prägung zu den Typologien der einzelnen Geschwister erfolgt in den ersten Jahren bis zum 5./6. Altersjahr.
Diese Feststellungen zeigen, dass den Anwesenden eines Familienhaushaltes eine prägende Wirkung zufällt und dass es sich bei der Ausbildung der Geschwistertypologien um Rollenübernahmen innerhalb dieses Haushaltes handelt.
Im Folgenden stelle ich ein Modell vor, welches die Entstehung der Polarität der ersten beiden Geschwisterrollen beschreibt und versucht, aufzuzeigen, dass 3., 6. und 9. Kinder offensichtlich notwendig sind, um den polaren Zyklus der ersten beiden Kinder eines jeden Zyklus’ abzuschliessen. Das Modell ruht auf der folgenden Ausgangsfrage:
Welche Situation findet jedes Kind bei seiner Ankunft in diesem Haushalt vor; was für eine Entwicklungsmöglichkeit, welche Rolle steht dem ankommenden Kind zur Verfügung?
1 Die Prägung des ersten Kindes: Die Welt der Menschen
Ein erstes Kind ist geboren worden.
Es wird sich von nun an daran gewöhnen, seine beiden Eltern zu sehen. Immer sieht es dasselbe Gesicht der Mutter, dasselbe Gesicht des Vaters und es wird zu diesen beiden Eltern eine nachhaltige Beziehung entwickeln. Mit ihnen wird es zum ersten Mal in seinem Leben eine Form des Zusammenlebens aufbauen und wird diese Erfahrung durch sein ganzes künftiges Leben tragen.
Die einzigen Partner dieses Kindes in diesem Haushalt sind also die Eltern.
Wie alle Eltern weisen auch diese ihre eigenen Persönlichkeiten auf, die wiederum einen Einfluss auf die Individualität des Kindes ausüben. Auf diesen individuellen Teil des elterlichen Einflusses auf das Kind gehe ich in diesem Text nicht weiter ein.
Vielmehr wende ich mich dem Teil des elterlichen Einflusses zu, der in stereotyper Art in jeder Familie bewirkt, dass das erste Kind Verhaltensformen entwickelt, die bei allen Vertretern seines Geburtenranges zu erkennen sind.
Die Welt der Menschen
Bei den Eltern handelt es sich von Natur aus um Erwachsene. Diese unterscheiden sich vom Kleinkind durch ihr soziales Verhalten, das bestimmt ist durch einen menschlichen Kodex, durch menschliche Konventionen, verbindliche ethische und moralische Vorstellungen und Vereinbarungen, wie Regeln und Gesetze, aber auch durch menschliche Fähigkeiten, wie den aufrechten Gang, das Benutzen von Kleidung, Essbesteck, Werkzeug, Sprache und Schrift.
Der nachhaltige Einfluss auf die Typologie des ersten Kindes kommt weniger vom Inhalt dieser Konventionen; diese zeigen in verschiedenen sozialen oder kulturellen Bereichen Unterschiede. Vielmehr prägt die Tatsache selbst, dass der überwiegende Teil unserer ursprünglichen, instinktmässigen Regungen in eine soziale Form gebracht werden muss. Das Kind merkt verwundert, dass es Erlaubtes und Unerlaubtes gibt.
Dieser elterliche Kodex hat sich im Laufe der Entwicklung der Menschheit ausgebildet. Indem es bei jeder Generation zu kleinen Anpassungen und Veränderungen im Verhaltenskodex kam, entwickelte sich allmählich der Mensch zu dem, was er heute ist. Diese, durch eine endlose Generationenfolge gebildete «Familienspirale» stellt also gleichsam die Gebärmutter der Menschheit dar und bettet das Individuum zwischen der langen Ahnenkette der Vergangenheit und den Nachkommen der Zukunft ein.
Das erste Kind steht nun seinen Eltern gegenüber, die sich ihm als einzige menschliche Partner in diesem Haushalt anbieten. Es macht die Erfahrung, dass sich diese beiden Erwachsenen von ihm vor allem dadurch unterscheiden, dass sie nach einer sozial bestimmten Verhaltensform leben. Diese Verhaltensform regelt die menschlichen Beziehungen und schöpft seine grosse Macht aus der tiefen Verwurzelung in einer langen Ahnenkette. Es ist die grosse Kraft dieser Familienspirale, die für die Ausprägung der Typologie des ersten Kindes ausschlaggebend ist; die Eltern sind nur deren Träger.
Das Kind wird nun versuchen, seinen ursprünglichen Regungen ebenfalls eine Form zu geben, und es wird die Form wählen, die es im Verhalten seiner Eltern gesehen hat.
Jedes Kind ahmt seine Eltern nach. Schon nach wenigen Wochen wird es lächeln, überhaupt wird es zahlreiche Ausdrucksformen und Gesichtsausdrucke nachahmen. Später wird es den aufrechten Gang der Eltern nachahmen. Das erste Kind scheint aber schon früh die Tatsache zu erahnen, dass es nicht so wie die Eltern ist. Gegenüber diesem Anderssein macht sich der tiefe Wunsch des Dazugehörens immer mehr bemerkbar. Es wird also früher als die anderen Kinder ganze, durch die Kultur bedingte Verhaltenskomplexe, wie das Sauber-Werden oder das sich Ankleiden von den Eltern erlernen wollen und es zeigt seine Neugier, sein Interesse, sowie seine Sorgen um alles, was das menschliche Zusammenleben, die menschlichen Konventionen, und das menschliche Wissen und Können anbelangt.
Es beobachtet seine Eltern und ahmt sie nach. Es lernt, die Regeln des Haushaltes zu beachten, auch zu testen, um sie schliesslich zu assimilieren und selber zu benützen. Seine Freude und sein Stolz über das Aufnehmen dieser Regeln zeigen, wie wichtig ihm das Erwachsen-Werden ist.
***
Zusammenfassung:
Das erste Kind wendet sein Interesse den sozialen Konventionen und allem, was uns Menschen vom Tier unterscheidet, zu. Die menschlichen Beziehungen erfasst es über seine Fähigkeit der Beobachtung, des Abwägens, der Unterscheidung und des Prüfens. Es fühlt sich im Denken wohl.
2 Die Prägung des zweiten Kindes: Die Welt der Dinge
Ein zweites Kind ist geboren worden.
Es sieht drei Gesichter. Sie gehören drei Menschen, die sich bereits an einen Dreierhaushalt gewöhnt haben. Zwei dieser Gesichter gehören Erwachsenen, das dritte Gesicht gehört einem älteren Kind, von dem es schon erwartet wurde und mit dem es später viel spielen und streiten wird. Dieses Kind ist in seiner Entwicklung fortgeschritten, es ist aber vor allem ein Kind. Die Situation hat sich gegenüber derjenigen des ersten Kindes grundsätzlich geändert. Dem zweiten Kind bieten sich nicht mehr nur die Erwachsenen als Partner an, sondern es ist auch ein Kind da, das zwischen ihm und der Familienspirale steht und es vor deren Einfluss abschirmt. Die Familienspirale hat also für das zweite Kind nicht die zwingende Wichtigkeit wie für das erste Kind. Es scheint die Verschiedenheit zwischen sich und den Erwachsenen einfach hinzunehmen, ohne dass diese Verschiedenheit es in seinem Sinnen und Trachten gross zu beeinflussen scheint. Es wendet sich viel mehr den umliegenden Dingen, die es entdeckt, zu.
Die Welt der Dinge
Für das erste Kind ist die Objektwelt eher Mittel zum Zweck, das heisst, es wird schon sehr früh darauf achten, was die Eltern wohl mit diesem oder jenem Objekt machen. Für das zweite Kind hat das Objekt eine viel zentralere Bedeutung. Über das Objekt entdeckt es die Natur und das Universum, als Teile der Schöpfung, die sich ihm in ihrer unbegrenzten Vielfalt anbietet. Das zweite Kind scheint in dieser Schöpfung seinen Partner zu finden. Es nimmt Objekte in die Hand, in den Mund, legt mehrere Objekte aufeinander, ineinander, verformt sie, verändert sie und ist dabei viel weniger als das erste Kind davon bestimmt, was die Eltern damit machen.
Der Mensch mit seinen sozialen Strukturen ist Teil der Schöpfung und gleichsam nur ein besonders interessantes Objekt der Natur. So begegnet das zweite Kind den Menschen, wie es allen Objekten begegnet. Es geht auf sie zu, berührt sie, streichelt sie. Dies erklärt auch seinen sinnlichen Bezug und leichten Kontakt zu den Menschen.
***
Zusammenfassung:
So wie sich das erste Kind seinem Partner, den Menschen über Blick und Wort nähert, so erforscht das zweite Kind sein Objektumfeld über die sinnliche Berührung, sein Fühlen und seinen Drang, diese Objekte umzuwandeln. Es entwickelt so seine sinnlich-schöpferische Antriebskraft und fühlt sich im Machen wohl.
***
Die polare Beziehungsdynamik der ersten beiden Kinder:
Diese grundsätzlich verschiedenen Ausgangssituationen zwischen den beiden älteren Kindern bilden den Ursprung für die sich gegenseitig ergänzende Gegensätzlichkeit, die sich in allen ihren Äusserungsformen zeigt.
| Das erste Kind | Das zweite Kind |
| Beobachtet die Eltern und entwickelt vor allem den Sehsinn. | Will die Dinge fühlen und entwickelt vor allem den Berührungssinn. |
| Das Sehen regt das Denken an:Es vergleicht, wägt ab, beurteilt. | Das Berühren regt die Muskeltätigkeit an:Das Kind macht mit den Dingen. |
| Denkende Wahrnehmung | Fühlende Wahrnehmung |
| Kopf | Bauch |
3 Die Prägung des dritten Kindes: Das Spiel mit Raum und Zeit
Ein drittes Kind ist geboren worden.
Es sieht vier Gesichter. Zwei gehören dem Elternpaar, die zwei anderen dem älteren Kinderpaar.
Das Elternpaar ruht auf der komplementären Gegensätzlichkeit des Geschlechtes, das Paar der zwei älteren Kinder auf der komplementären Gegensätzlichkeit ihrer Geschwisterrollen. Beide Paare sind gewohnt, ihre Gegensätzlichkeit im Alltag ständig wieder zu leben: Sie spielen und streiten zusammen.
Die Plätze sind in dieser „Paarumgebung“ besetzt.
Erwachsene Drittgeborene machen oft Bemerkungen, die auf eine eigene Empfindungsart von Zugehörigkeit und Ausgeschlossensein schliessen lässt: «Ich gehörte dazu und gehörte doch nicht dazu …», oder: «Ich hatte das Gefühl, adoptiert zu sein; mir war die Familie wie fremd …».
Die beiden älteren Kinder haben inzwischen zu zweit ihre Kinderwelt aufgebaut und sind fixiert in der Polarität ihrer Beziehung. Sie werden kleine elterliche Aufgaben übernehmen, werden das dritte Kind mit Interesse und Neugier betrachten, aber kaum auf die Idee kommen, das «süsse Kleine» in die polare Dynamik ihrer gewachsenen Zweierbeziehung einzubeziehen.
Erst- und zweitgeborene Erwachsene drücken sich gelegentlich über den Drittgeborenen aus: «Er ist anders als wir». Dabei ist interessant, dass sie von «wir» sprechen, gerade sie beide, die so gegensätzlich sind. Sie empfinden also ihre Polarität als eine Ganzheit, in welcher jeder seine eigene Identität im Spiegel seines Gegenübers findet; die Andersartigkeit des Drittgeborenen bedeutet, dass sie ihn als ausserhalb ihrer Polarität empfinden.
Was die konkreten Äusserungsformen betrifft, übernimmt das dritte Kind Verhaltensmuster von beiden Älteren. Diese Tendenz kann dann von den beiden anderen als Öffnung und Erweiterung in ihrer Identitätsfindung aufgenommen werden. Erwachsene sagen etwa von ihrem dritten Geschwister: «Bei ihm suchen wir Rat, wenn wir in Schwierigkeiten sind», oder sie wird als Bedrohung aufgenommen und als Andersartigkeit abgedrängt.
Von den gegensätzlichen Charakteristiken der ersten beiden Kinder wählt das dritte Kind meistens nur die eine oder die andere; es gibt nur ausnahmsweise eine dritte Möglichkeit. Aber es kann von einem gegensätzlichen Charakteristikpaar die Möglichkeit des ersten Kindes, von einem anderen diejenige des zweiten Kindes wählen. Dies führt zu einer häufig angetroffenen, scheinbaren Widersprüchlichkeit zwischen einzelnen Ausdrucksformen des dritten Kindes.
Wir finden also bei dritten Kindern in ihren konkreten Ausdrucksformen eine viel grössere individuelle Verschiedenheit als für die beiden anderen und man kann weniger über eine aufzählende Beschreibung aus der vergleichenden Befragung zu einem bildhaften Gesamteindruck kommen. Wir müssen gleichsam die Ebene wechseln und wir erfahren über das Funktionieren von Drittgeborenen viel mehr von Erwachsenen als von Müttern über ihre dritten Kinder. So kommen von erwachsenen Drittgeborenen immer wieder Äusserungen, die auf eine Auseinandersetzung um das Existentielle des Lebens schliessen lassen:
Eine drittgeborene Patientin erklärte mir, dass sie oft an eine nahe gelegene Böschung einer Autobahn gehe, um die vorbeirasenden Fahrzeuge zu betrachten. Ein drittgeborener Mann erzählte mir, dass er wiederholt die Kriegsgräber im Nord-Osten Frankreichs besuchte. Es wurde die Faszination beschrieben, zu beobachten, «zu was der Mensch fähig sei».
Zur Sensibilität höre ich gelegentlich Äusserungen wie: «Damit ich die Ereignisse wahrnehmen kann, müssen sie mich durchdringen. Wenn es mir schlecht geht, durchdringen sie mich auch, sonst würde ich sie nicht wahrnehmen können, aber sie erschüttern mich in meinem Innersten». Dies steht im Gegensatz zum Erstgeborenen, der eher einen Schutzwall um sich aufbauen würde, um sich nur ja nicht durchdringen zu lassen, und zum Zweitgeborenen, der eher weggehen und eine Beschäftigung suchen würde, um sich vom unangenehmen Ereignis abzulenken.
Zeit und Raum scheint von Drittgeborenen in anderer Weise als von den beiden Älteren wahrgenommen zu werden. So kommt es immer wieder vor, dass Patienten mir beschreiben, wie gehetzt sie sich fühlen, wenn sie einem Zeitprogramm folgen müssen, bei dem sich eine Arbeit an die andere reiht.
Der dritte Aspekt der Polarität: Das Spiel mit Raum und Zeit
Wie können wir, um die Funktionsart des dritten Kindes zu verstehen, die Ebene wechseln? Dazu ist es sinnvoll, bei den beiden älteren Kindern zu beginnen und zu überlegen, welche Gesetze ihrer alltäglichen polaren Dynamik beim dritten Kind zur Wirkung kommen.
Wie in Anhang 3, «ein dynamisches Konzept der Polarität», näher erklärt wird, können Polaritäten rhythmische Zyklen auslösen. Auch ist in der Natur ein Zyklus nie identisch mit dem vorhergehenden, sondern ist ihm ähnlich. Diese Ähnlichkeit führt dazu, dass sich Zyklen nicht im Kreis bewegen, sondern in ihrer Folge eine Spirale bilden. Da die Spirale in ihrer Achse richtunggebend ist, zeigt sie neben den beiden gegenläufigen Wirkungen der Pole eine neue, dritte Bewegungsrichtung. Diese dritte Bewegung, oder der «dritte Aspekt» der polaren Bewegung3, finden wir in allen zyklischen oder rhythmischen Phänomenen der Natur. Jeder Zyklus weist die gleiche Grundstruktur wie der vorhergehende auf, hat aber innerhalb dieser Grenzen neue Entwicklungs- und Anpassungsmöglichkeiten. Der dritte Aspekt wäre damit eine Voraussetzung für Wachstum, Reifung, Entwicklung und Entfaltung.
Diese Dreigliedrigkeit der Polarität ist die Grundlage der Dreierfolge in den Geschwisterstellungen. Die ersten beiden Kinder leben in einer polaren Dynamik: Sie spielen und streiten miteinander und erleben tagtäglich das Anderssein des anderen. In ihrer Beziehungsdynamik erfahren sie ständig, wie sich ihre Gegensätzlichkeiten ergänzen oder aufeinanderprallen. Dauernd wechseln sie zwischen Bewunderung und Verachtung, zwischen Neugier und Gleichgültigkeit, zwischen Sympathie und Antipathie. Bei jedem Wechsel zwischen diesen Polen machen sie Erfahrungen, hinter denen die Gesetzmässigkeit des dritten Aspektes polarer Zyklen zu erkennen ist. Erst die Erfahrung schreibt sich in die Zeitachse ein; ein identischer Zyklusdurchgang ist nie mehr möglich.
So kommt es, dass eine Geschwisterschaft von nur zwei Kindern dauernd das Doppelgesicht ihrer Polarität erlebt und diese über die Erfahrung im dritten Aspekt der Polarität entwickelt, auch ohne die Gegenwart eines dritten Kindes. Bei der Ankunft des dritten Kindes ist dieser dritte Aspekt der Polarität also bereits als Platzhalter vorgegeben. Das dritte Kind hätte dann keine andere Wahl, als diesen Platz einzunehmen und in dieser Rolle seine geschwisterliche Identität zu finden.
Was bedeutet es für das dritte Kind, ausserhalb der Polarität der beiden Älteren zu stehen? Welche soziale Rolle mit welchen konkreten Äusserungsformen kann man erwarten? Ich kann für diese Fragen keine abschliessende Erklärung geben. Von Erwachsenen bekomme ich gewisse Hinweise, die durch die typischen Ausdrucksformen des dritten Kindes bestätigt werden. So haben Drittgeborene eine andere Wahrnehmung von Zeit und Raum. Zum Beispiel beklagen sich drittgeborene Erwachsene regelmässig darüber, wie schwer es ihnen fällt, mit der Zeit zurechtzukommen. Gegenüber der objektiven Zeitstruktur mit Stundenplänen und Zeitprogrammen (Metron) hat bei ihnen das subjektive Zeitempfinden (Chronos) eine viel grössere Wichtigkeit als für die beiden Älteren. Auch die zum Raumempfinden gehörende Auseinandersetzung zwischen Abgrenzung und Zugehörigkeit zur Familie scheint sich bei Drittgeborenen in anderer Weise abzuspielen als bei den beiden anderen.
***
Zusammenfassung:
Die polare Beziehungsdynamik zwischen den ersten beiden Kindern bildet den Platzhalter für das dritte Kind:
… und die folgenden Kinder
Ein viertes Kind ist geboren worden.
Es sieht fünf Gesichter. Zwei gehören wiederum den beiden Eltern, die es umsorgen, und die anderen drei gehören drei Kindern, die untereinander einen in sich abgeschlossenen Zyklus bilden. Die beiden älteren Kinder haben ihre polaren Rollen übernommen und diese Polarität hat zu deren Entwicklung geführt, während das dritte Kind diese Entwicklung der Polarität, das heisst den dritten Aspekt der Polarität, als seine geschwisterliche Rolle übernommen hat.
Die drei älteren Kinder zeigen in ihren Rollen eine solche Abgeschlossenheit, dass es einem weiteren Kind nicht möglich ist, sich hier in einer eigenen, vierten Rolle zu entfalten. Angesichts dieser Abgeschlossenheit findet das vierte Kind also die gleiche Situation vor wie das erste Kind bei seiner Ankunft: Es findet zwei Eltern vor, die sich über ihre Sozialisationen in die Gesellschaft integriert haben. Die Eltern werden begleitet von drei älteren Kindern, die bereits begonnen haben, sich in dieser Familienspirale zu integrieren. Das vierte Kind entwickelt also, wie vor ihm das erste Kind, seine Partnerschaft zur Erwachsenenwelt.
***
Mit der vergleichenden Befragung wird die, schon 1958 von Karl König4 beschriebene, Dreigliedrigkeit der Geschwisterstellungen bestätigt. Es zeigte sich auch, dass sich diese Dreierstruktur in sehr grossen Familien mit acht und mehr Kindern bis zu den Jüngsten mit der gleichen Deutlichkeit zeigt. Man kann also annehmen, dass der Dreierrhythmus nicht durch einen anfänglichen Auslöser bestimmt wurde und sich mit der Zeit abschwächt, sondern dass ihm eine innere Gesetzmässigkeit zugrunde liegt, die beim Durchlaufen eines jeden Zyklus ständig neu angetrieben wird.
1 Alfred Adler: Kindererziehung, (1989) Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main
2 Siehe unter „Statistische Resultate“ von Christine Bruchez am Schluss dieses Buches.
3 Wenn wir von der klassischen Auffassung der Polarität mit der Gegensätzlichkeit von zwei Polen ausgehen, haben wir hier ein drittes Element. Für dieses «Dritte» eine Bezeichnung zu finden, ist schwierig. Wir könnten von dritter Bewegung, Kraft, Tendenz, Aktivität, Element sprechen, ich ziehe aber vorläufig den «dritten Aspekt» der polaren Bewegung vor, da bei diesem Ausdruck der Blickwinkel, von dem aus wir die Polarität und ihre Dynamik betrachten, mitbestimmend ist. (Vergl. Anhang 3)
4 Karl König: Brüder und Schwestern – Geburtenfolge als Schicksal (2013), Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.