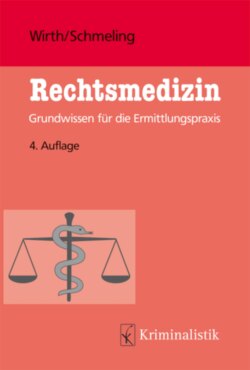Читать книгу Rechtsmedizin - Ingo Wirth - Страница 46
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIV. Gewaltsamer Tod › 1. Stumpfe Gewalt › 1.1 Verletzungen der Haut
1.1 Verletzungen der Haut
Infolge streifender oder schräger Einwirkung auf die Körperoberfläche (Schürfen, Kratzen, Rutschen, Schleifen) entsteht eine Abschürfung (Exkoriation) oberflächlicher Hautschichten. Kriminalistisch bedeutsam ist die Möglichkeit, an den zusammengeschobenen Oberhautschüppchen (sog. Epithelmoräne) die Schürfrichtung zu erkennen. Aufgehäufte Hautschüppchen an einem Wundrand belegen eine Abschürfung in Richtung dieses Randes. In Abhängigkeit von der Oberflächenbeschaffenheit des schürfenden Gegenstandes kann es zu Materialübertragungen zwischen Gegenstand und Haut kommen (z. B. Erde, Fahrbahnbestandteile, Lacksplitter, Hautpartikel, Gewebsflüssigkeit).
Oft wird die Oberhaut nur geringfügig verletzt, sodass die betroffene Stelle nicht sofort sichtbar ist. Die Verletzung tritt an der Leiche erst nach einiger Zeit zutage, weil durch das Fehlen der oberflächlichen Zellschicht Gewebswasser verdunsten kann und die geschädigte Fläche vertrocknet. Diese Hautvertrocknungen sind von gelblich-brauner Farbe und weisen eine pergament- bis lederartige Konsistenz auf.
Vereinzelt werden Oberhautdefekte durch senkrechte Gewalteinwirkung hervorgerufen. Von kriminalistischer Bedeutung sind die resultierenden Hautvertrocknungen, weil daran die Form der verursachenden Gewalt ablesbar sein kann (Schlagflächen, Kanten, Profile). Auch Strangulationsmarken sind geformte Defekte der Oberhaut, die alsbald vertrocknen.
Es lässt sich bei vertrockneten Oberhautdefekten nicht immer erkennen, ob die Verletzung vor oder nach dem Tod entstanden ist. Erbringt die Leichenöffnung eine Unterblutung dieser Stelle, darf eine Entstehung der Hautabschürfung zu Lebzeiten angenommen werden.
Wird durch die schürfende Gewalt auch die unter der blutgefäßlosen Oberhaut gelegene, gefäßführende Lederhaut verletzt, kommt es zu Blutungen und Wundschorfbildung.
Ein Bluterguss (Hämatom) entsteht infolge Zerreißung von Blutgefäßen durch Gewebsquetschung und -zerrung mit oder ohne Hautabschürfung. Sein Ausmaß ist abhängig von der Größe der einwirkenden Gewalt, den anatomischen Gegebenheiten der betroffenen Körperregion, dem Blutgefäßreichtum der verletzten Stelle und der individuellen Blutungsbereitschaft. Besonders leicht entstehen Blutergüsse an Stellen, an denen die Haut direkt über einem Knochen liegt (Schienbein, Schädeldach). In lockeren Gewebsschichten breiten sich Blutungen leicht aus (Augenober- und -unterlid mit Absinken bis in die Wange, Hodensack, äußere weibliche Geschlechtsorgane). Ausgedehnte Hämatome entstehen bei krankheitsbedingter Blutungsbereitschaft (Bluterkrankheit, schwere, häufig alkoholbedingte Lebererkrankungen) oder bei Dauerbehandlung mit gerinnungshemmenden Medikamenten zur Thrombosevorbeugung (z. B. nach Herzinfarkt oder Schlaganfall, bei Durchblutungsstörungen an den Beinen).
Die Blutergüsse können die Haut, die Unterhaut und/oder die tiefer liegenden Weichteilgewebe betreffen. Je nach ihrer Lage treten die Hämatome gleich nach der Gewalteinwirkung oder aber nach Stunden, mitunter erst nach Tagen an der Körperoberfläche in Erscheinung. Es dauert einige Zeit, bis eine in der Tiefe entstandene Blutung unter der Haut sichtbar wird.
Die Blutunterlaufung der Haut, als blauer Fleck bekannt, entspricht in ihrer Ausdehnung ziemlich genau dem geschädigten Bereich. Eine Hautunterblutung muss aber nicht unbedingt den Ort der äußeren Gewalteinwirkung markieren. So kann die Unterblutung von Ober- und Unterlid eines Auges (Monokelhämatom, blaues Auge) durch eine direkte Gewalteinwirkung mit der Faust entstanden sein oder bei einem Schädelbasisbruch indirekt zustande kommen, weil sich die Blutung von der Bruchstelle bis in das lockere Bindegewebe der Augenregion ausbreitet. Durch kräftiges Saugen an der Haut, vor allem des Halses, können umschriebene Hautunterblutungen verursacht werden (sog. Knutschflecke).
Unabhängig von ihrem Zustandekommen ist die frische Blutunterlaufung von blauer bis blau-roter Farbe und meist gut konturiert. Je nach der Lokalisation schwillt der Bereich mehr oder weniger stark an. Bei Blutungen in der Kopfschwarte ist die Ausbreitung über den Ort der Gewalteinwirkung hinaus nur gering. Eine solche Blutung bleibt bei kurzer Überlebenszeit umschrieben und lässt sich scharf gegen die Umgebung abgrenzen. Zu tasten ist eine Schwellung mit weichem Zentrum, eine sog. Beule.
Die Färbung der Hautunterblutungen erlaubt eine Schätzung ihres Alters, weil beim Überleben der Verletzung der rote Blutfarbstoff über verschiedene farbliche Zwischenstufen abgebaut wird. Bei großflächigen Blutunterlaufungen dauert es bis zum vollständigen Verschwinden 2 bis 4 Wochen, bei kleineren Hämatomen einige Tage.
Nach einer überlebten Verletzung vollziehen sich die Farbveränderungen wie folgt:
| • | bis 6 Tage blau-violett, |
| • | 6 bis 8 Tage grünlich, |
| • | mehr als 8 Tage gelblich. |
Bei größeren Hautunterblutungen dienen die Farbveränderungen in der Randzone zur Altersschätzung. Mit fortschreitender Alterung wird die ursprünglich scharfe Kontur immer unschärfer und die Farbe verblasst. Je älter die Hautunterblutung ist, desto schwieriger wird es, den verletzten Bezirk von der umgebenden gesunden Haut abzugrenzen. Demnach sind Größenangaben bei älteren Unterblutungen nur noch Zirkaangaben.
Geformte Hauteinblutungen lassen manchmal einen Rückschluss auf das Zustandekommen der Verletzung zu. So kann der einwirkende Gegenstand regelrecht abgebildet sein (z. B. Gürtelschnalle, Schürhaken, Schuhsohlen- und Fahrzeugreifenprofil).
Stockschläge und Schläge mit anderen länglichen Gegenständen verursachen parallel verlaufende, streifige Hautblutungen mit einem blassen, blutleeren Mittelstreifen. Solche Doppelstriemen (Abbildung 7) entstehen dadurch, dass das Gewebe an der Auftreffstelle gequetscht wird und die rechts und links daneben liegenden Blutgefäße zerreißen.
Abb. 7:
Doppelstriemen in der Haut nach Stockschlägen, aus [9]
Als spezielle Erscheinungsformen der Hautunterblutung sind die Stauungsblutungen bei Strangulation zu werten, ebenso die anämischen Aufschlagspuren beim Sturz aus großer Höhe.
Durch eine massive, tangentiale Gewalteinwirkung (z. B. Überrollen von Kraftfahrzeug) kann es zur Ablösung eines Hautareals vom zerstörten Unterhautfettgewebe oder der Haut einschließlich des Unterhautfettgewebes von der Muskulatur kommen. Dabei bildet sich eine Wundtasche, die vorwiegend mit Blut und Fettgewebe gefüllt ist. Eine solche Verletzung wird als Ablederung (Décollement) bezeichnet. Der Hautbezirk über der Wundtasche zeigt auch bei schweren inneren Verletzungen häufig keine oder nur eine geringfügige Unterblutung.
Nach schwersten Misshandlungen (Schläge, Tritte) können die Haut- und Weichteilblutungen ein solches Ausmaß erreichen, dass der Tod durch Verbluten in das Unterhautfettgewebe eintritt. Begünstigend wirken dabei eine Fettembolie und ein allgemeines Kreislaufversagen (Verblutungsschock).
Um die Lokalisation, die Ausdehnung, die Mitbeteiligung von Knochen und inneren Organen sowie den Ausgangspunkt der Blutaustritte feststellen und beurteilen zu können, ist eine Leichenöffnung erforderlich.
Bei der Einwirkung stumpfer oder stumpfkantiger Gewalt entstehen Hautdurchtrennungen (Wunden), wenn die Elastizitätsgrenze der Haut überschritten wird. Für derartige Verletzungen sind die Bezeichnungen Platz-, Riss- und Quetschwunde gebräuchlich. Bei der sog. Platzwunde handelt es sich nach dem Entstehungsmechanismus um eine Quetsch-Riss-Wunde.
Bevorzugt treten solche Verletzungen dort auf, wo die Haut ohne wesentliches Weichteilpolster straff über Knochenflächen oder -kanten gespannt ist (Schädeldach, Kinn, Schienbein, Fingerknöchel).
Für die Wundbeurteilung sind zu beachten:
| • | Wundrand (Wundumgebung), |
| • | Wundwinkel, |
| • | Wundgrund. |
Die typische Wunde infolge stumpfer Gewalteinwirkung ist die Kopfplatzwunde, an der man die wichtigsten Charakteristika meist gut erkennen kann. Kennzeichnend sind unregelmäßige Wundränder (gezähnelt, fetzig, zipfelig) mit mehr oder weniger breitem Vertrocknungssaum und Blutunterlaufung der umgebenden Haut. Manchmal erweisen sich die Wundränder auch als abgeschoben (unterminiert). Die Wunden können einen linearen oder einen mehrstrahligen Verlauf mit mehr als zwei Wundwinkeln zeigen. In der Tiefe auf dem Wundgrund finden sich Gewebsbrücken, die aus kleinen Blutgefäßen, Bindegewebssträngen und Nerven bestehen. Gelegentlich bleiben bei größeren Wunden auch Hautbrücken erhalten. Bei der Wundinspektion ist besonders auf Fremdkörper am Wundgrund zu achten, die einen Hinweis auf das verletzende Werkzeug oder auf den Entstehungsvorgang geben können (Holz-, Metall-, Lack-, Glassplitter, Textilfasern, Sand).
Eine Sonderform der Hautwunde ist die Bissverletzung, die durch Menschen oder Tiere verursacht sein kann. Typische Menschenbisse zeigen mehr oder weniger deutlich den Gebissabdruck als runden bis ovalen Bissring durch Blutunterlaufungen und Abschürfungen. Solche Bissverletzungen kommen aus sexuellen Motiven, bei Kindesmisshandlung oder als Abwehrverletzung bei tätlichen Auseinandersetzungen vor, wenn sich das Opfer durch Beißen wehrt.
Die Bisse von Tieren bewirken meist Gewebsdurchtrennungen, wobei die Verletzungen unterschiedlich schwer sein und bis zum Zerfleischen ganzer Körperteile führen können. Ausgedehnte tödliche Verletzungen sind möglich (sog. Kampfhunde, große Raubtiere). Bei Schlangenbissen steht die Giftwirkung im Vordergrund.