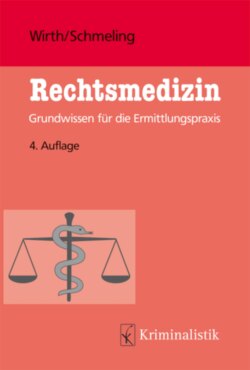Читать книгу Rechtsmedizin - Ingo Wirth - Страница 47
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIV. Gewaltsamer Tod › 1. Stumpfe Gewalt › 1.2 Verletzungen von Knochen und Muskeln
1.2 Verletzungen von Knochen und Muskeln
Eine stumpfe Gewalteinwirkung kann am Skelettsystem zu einer Verrenkung (Luxation) und zu einem Knochenbruch (Fraktur) führen.
Als Luxation bezeichnet man die Verschiebung gelenkbildender Knochenteile gegeneinander, wobei eine Zerreißung der Gelenkkapsel sowie von Bändern und Muskeln entstehen kann. Die verschobenen Knochenteile haben entweder überhaupt keinen Kontakt mehr miteinander (vollständige Luxation) oder berühren sich nur noch teilweise (unvollständige Luxation).
Die Frakturen weisen einen außerordentlichen Formenreichtum auf (Abbildung 8). Ihre Klassifizierung kann nach unterschiedlichen Gesichtspunkten erfolgen. So lassen sich die Frakturen einteilen nach
| • | Knochenbeschaffenheit – traumatische Fraktur = Bruch eines gesunden Knochens infolge äußerer Gewalteinwirkung = häufigste Form – pathologische Fraktur = Bruch eines krankhaft veränderten Knochens (z. B. Verminderung der Knochensubstanz bei Osteoporose) |
| • | Ort der Gewalteinwirkung – direkte Fraktur = Knochenbruch an der Stelle der Gewalteinwirkung – indirekte Fraktur = Knochenbruch entfernt vom Ort des Traumas |
| • | Grad der Kontinuitätstrennung – vollständige Fraktur = Knochenquerschnitt komplett durchtrennt, zwei oder mehr Bruchstücke – unvollständige Fraktur = Knochenzusammenhang teilweise erhalten, häufig bei Kindern als sog. Grünholzfraktur |
| • | Verlauf der Frakturlinien – einfache Frakturlinien, bezogen auf die Längsachse des Knochens = Quer-, Schräg-, Spiral- und Längsfraktur – mehrfache Frakturlinien = T- oder Y-Fraktur, Splitter- oder Trümmerfraktur |
| • | Anzahl der Frakturen – Einzelfraktur = Knochen einmal gebrochen – Doppel- oder Mehrfachfraktur = Knochen zwei- oder mehrmals gebrochen – multiple Frakturen = Brüche verschiedener Knochen, Sonderform Reihen- oder Serienfraktur, wenn die Knochen eine funktionelle Einheit bilden (Rippen, Mittelhand- und Mittelfußknochen) |
| • | Entstehungsmechanismus – Riss-, Biegungs-, Berstungs-, Stauchungs-, Schub- oder Scher-, Torsionsfraktur.[1] |
Weiterhin werden Frakturen nach der Mitbeteiligung der darüberliegenden Haut in offene und geschlossene Knochenbrüche unterschieden. So können spitze Knochenbruchstücke die Haut durchspießen (z. B. beim Unterschenkelbruch) und dadurch eine offene Fraktur verursachen. Ebenso ist es möglich, dass innere Organe verletzt werden (z. B. Lungenanspießungen durch Rippenbruchstücke).
Bei der Leichenschau lassen sich Knochenbrüche an sicheren Frakturzeichen erkennen. Das sind:
| • | Fehlstellung, |
| • | abnorme Beweglichkeit, |
| • | Knochenreiben (Krepitation: Werden die rauhen Bruchflächen gegeneinander bewegt, ist das Knochenreiben hör- und fühlbar.), |
| • | sichtbare Knochenbruchstücke. |
Abb. 8:
Formen von Knochenbrüchen, aus [1]
[Bild vergrößern]
Im Gegensatz zu Knochenbrüchen der Gliedmaßen lassen sich Frakturen des Rumpfskeletts und des Schädels äußerlich oft nicht erkennen.
Für die kriminalistische Praxis resultiert die Bedeutung der Frakturen vor allem daraus, dass sich von der Bruchform auf das Zustandekommen des Knochenbruchs rückschließen lässt. Dadurch können wertvolle Anhaltspunkte für die Rekonstruktion hinsichtlich Angriffspunkt, Art und Richtung der Gewalteinwirkung gewonnen werden. Eine sachgerechte Interpretation der verschiedenen Frakturformen setzt eine entsprechende Erfahrung voraus und erfordert nicht selten das Zusammenwirken von Rechtsmediziner, Unfallchirurg und Röntgenarzt.
Die Knochenbruchheilung dauert unterschiedlich lange je nach Frakturform, Gesundheitszustand des Verletzten und Hinzutreten von Komplikationen (z. B. Infektion, unzureichende Ruhigstellung der Bruchstelle). Auch das Alter hat einen Einfluss. Bei Kindern heilt eine Fraktur schneller, im Greisenalter dagegen langsamer. Die Bruchstelle wird durch die Neubildung von Knochengewebe (Kallus) stabilisiert. Nach 4 bis 6 Wochen besteht eine feste, knöcherne Verbindung der Bruchenden und die Fraktur ist verheilt. Anders verläuft die Knochenbruchheilung nach operativer Behandlung (Osteosynthese).
Verheilte Frakturen sind zeitlebens nachweisbar und deshalb in Verbindung mit anderen individuellen Besonderheiten wichtige Identitätsmerkmale.
Auf spezielle Frakturformen der einzelnen Skelettabschnitte (Schädel, Wirbelsäule, Brustkorb, Becken, Gliedmaßen) wird bei der Beschreibung von Kopfverletzungen (Kapitel IV Nummer 1.4), Schusswirkungen (Kapitel IV Nummer 6), Verkehrsunfällen (Kapitel XII) und Kindesmisshandlungen (Kapitel XIII Nummer 4) eingegangen.
Eine stumpfe Gewalteinwirkung auf die Muskulatur kann eine Quetschung, Zerreißung oder Zermalmung größerer Muskelanteile bewirken. Bei ausgedehnten Schädigungen (z. B. Sturz aus großer Höhe, Verkehrsunfall, Schläge und Tritte, Verschüttung) wird Muskeleiweiß (Myoglobin) freigesetzt. Über den Blutstrom gelangt es in die Nieren und führt zum Nierenversagen durch Verstopfung der Nierenkanälchen (sog. Crush-Niere).