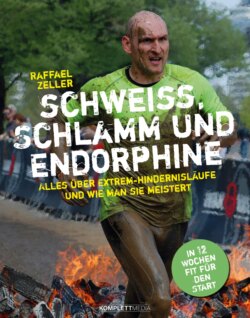Читать книгу Schweiß, Schlamm und Endorphine - Iris Hadbawnik - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»Mega!«
»Brutal!«
»Der absolute Hammer!«
Egal, wen man nach dem Zieleinlauf eines Extrem-Hindernislaufs befragt, alle Sportler haben eines gemeinsam: Sie alle sind an ihre eigenen Grenzen gegangen. Körperlich, aber auch mental. Je nach Härte des gefinishten Rennens durchlebten sie die tiefsten Urängste des Menschen: Höhe, Feuer, Stacheldraht, Eiswasser, Elektroschocks und Klaustrophobie. Die Qualen, die sie durchlitten haben, zeigen sich bereits in den Namen der Hindernisse. Sie heißen Everest, Body Bowling, Cliffhanger, Ice Channel, Electroshock Therapy, Birth Canal oder Fiery Holes. An ihnen erfuhren die Sportler Schmerzen, Kälte, Krämpfe, Leid und Verzweiflung mindestens ebenso intensiv wie Freude, Adrenalin, Mut, Selbstbewusstsein und Stolz.
Das Phänomen Extrem-Hindernislauf – auch Obstacle Course Race (OCR), Hindernislauf, Survival-Run, Mud Race, Mud Run (also: Matschrennen) oder Extrem-Crosslauf genannt – hat sich in den letzten Jahren wie ein Lauffeuer verbreitet. Seit der Premiere des ersten kommerziellen Rennens – dem Tough Guy Race, also dem Rennen für harte Kerle – im Januar 1987 in England, hat sich das Konzept dieser Erfolgsgeschichte unaufhaltsam in alle Welt ausgebreitet. Dabei wollte der ehemalige britische Soldat Billy Wilson, der in der Szene besser als Mr. Mouse bekannt ist, mit einem Charity-Event lediglich einen Gnadenhof für Pferde finanziell unterstützen.
Wilson, der zuvor Trainingscamps für die Grenadier Guards, ein Regiment der Britischen Armee, entworfen hatte und dem das normale Marathon-Laufen einfach zu langweilig geworden war, hatte die Idee, jene Art von Militärcamps auf den zivilen Bereich zu projizieren und im Rahmen eines Crosslaufs mit zunächst einfachen natürlichen Hindernissen anzubieten. Niemand konnte damals auch nur im Geringsten erahnen, welchen Hype er damit auslösen würde.
Allein an den Teilnehmerzahlen des Tough Guy lässt sich ablesen, wie diese Idee praktisch in Windeseile in der Ausdauerszene die Runde machte. Von anfänglich knapp 100 Läufern stieg die Zahl mit jeder Berichterstattung und mit jeder Verschärfung des Hindernisparcours sprunghaft an. Heute liegt das Teilnehmerlimit des Rennens bei 7.000 Läufern. Dabei gilt der Tough Guy bis heute als einer der schwierigsten Läufe der Welt und wurde bis vor wenigen Jahren als die inoffizielle Weltmeisterschaft unter den Extremläufen gehandelt. Auf einer Strecke von aktuell 15 Kilometern müssen mehr als 200 teils anspruchsvolle Hindernisse, mit einer Höhe von bis zu 20 Metern, überwunden werden. Da kann es auch schon mal vorkommen, dass man kurz nach dem Start eine Güllegrube passieren muss oder beim Tauchen im winterlichen Gewässer mit dem Kopf gegen eine Eisscholle knallt. Die Härte dieses Rennens belegt auch die Finisher-Quote, die derzeit bei rund 50 Prozent liegt. 2015 kamen bei 5.500 Startern lediglich 2.800 erfolgreich über die Ziellinie. Demnächst werden es noch weniger Finisher sein. Am 29. Januar 2017 wird der Tough Guy nämlich wohl leider zum letzten Mal stattfinden.
WIE KOMMT MAN AUF DIE IDEE, SICHEINER HERAUSFORDERUNG WIE DEM TOUGH GUY RACE ZUSTELLEN?
Im Falle von Sebastian Menck (Jg. 1995) war es purer Zufall. Der mittlerweile 21-Jährige ist seit über zwei Jahren in der OCR-Szene aktiv, lief äußerst erfolgreich verschiedene Wettkämpfe und hat sich für Anfang 2017 das Tough Guy Race als besonderes Ziel gesetzt:
»Den ersten Kontakt zum Trailrunning hatte ich bereits im Internat in England, wo ich für einige Zeit zur Schule ging. Unter dem Namen ›Crosscountry‹ wurde hier querfeldein gelaufen. Die Gegend um North Yorkshire eignet sich perfekt dafür. über große Wiesen geht es dauerhaft bergauf und bergab. Steinmauern begrenzen hier die Felder und stellen optimale Hindernisse dar. In dieser ländlichen Umgebung gibt es praktisch nur diese Art des Laufens, denn asphaltierte Straßen sind rar.
Zurück in meinem Internat in Deutschland, dem Kurpfalz Internat nahe Heidelberg, meldete ich mich für das einzigartige Projekt »Extrem-Hindernislauf« an, welches dort seit einiger Zeit für die Schüler des Internats angeboten und vom Extremsportler Raffael Zeller geleitet wird. Mit meinen Erfahrungen aus England war ich schnell überzeugt und brannte für das spezielle Training. unter Raffaels professioneller Anleitung eigneten wir uns grundlegende Techniken zur schnellen und effektiven Fortbewegung im Gelände an. Die Herausforderungen, denen ich mich hier stellen musste, waren völlig neue. Die steilen Berge, die kalten Flüsse und die dichten Wälder im Raum Heidelberg verlangen einem Anfänger alles ab. Dazu kam der Nervenkitzel, denn die Projektgruppe »Extrem-Hindernislauf« fand immer abends nach Einbruch der Dunkelheit statt. Nur mit Stirnlampen bewaffnet, ging es über Wiesen und durch die dunklen Wälder. Fernab von Häusern und Wegen hat uns Raffael die Berge hinauf- und wieder hinuntergepusht. Durch Hunderte Liegestütze erreichte jeder von uns seine eigene Leistungsgrenze und wuchs über sich hinaus. Stück für Stück fühlte sich das Laufen auf einmal viel einfacher an. Nicht weniger fordernd, doch durch die Kälte, durch die Feuchtigkeit und den schweren Matsch an den Füßen wurde es zur Normalität. Dieser rohe, extrem fordernde Sport faszinierte mich immer mehr. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich nie gedacht, dass dieses Training der Anfang meines Weges in die OCR-Szene sein würde. Nach der jährlichen Feuertaufe, dem 23 Kilometer langen Querfeldein-Abschlusslauf der Projektgruppe, entschied ich mich endgültig, an einem ersten OCR-Wettkampf teilzunehmen. Vor dem Start war ich sehr nervös – hätte es aber nicht sein müssen, weil ich durch Raffael optimal auf das Rennen vorbereitet wurde. Nach diesem ersten erfolgreichen Wettkampf, dem Spartan Sprint in München, erlag ich vollends dem Bann des Extrem-Hindernislaufens. Nun folgte ein Wettkampf auf den nächsten, und durch die Zusammenarbeit mit dem Onlinemagazin androgon. com wurde dieses Hobby bis heute zu meiner großen Leidenschaft. «
KURZER AUSFLUG IN DIE HISTORIE: EXTREM-HINDERNISLAUF DAMALS UND HEUTE
Wer sich Bilder und Aufnahmen von Extrem-Hindernisläufen anschaut oder schon an einem solchen Rennen teilgenommen hat, fühlt sich in Szenen von Filmen wie Full Metal Jacket von Stanley Kubrick (1987), Ein Offizier und Gentleman von Taylor Hackford (1982) oder 300 von Zack Snyder (2006) hineinversetzt. Es gilt, mit lautem Gebrüll in den Wettkampf zu starten, Herausforderungen zu meistern, den Anweisungen eines Drill Instructors Folge zu leisten, gegen »Gladiatoren« zu kämpfen und Hindernisse zu bewältigen, die jeder Militärausbildung alle Ehre erweisen würden. Denn genau hier findet sich der Ursprung der Idee zu Tough Guy und Co.
Während sich seit der Antike bis zum späten Mittelalter die feindlichen Heere in der Kriegsführung vor allem in starren Formationen auf dem Schlachtfeld gegenüberstanden und bekämpften, änderte sich Ende des 19. Jahrhunderts diese Taktik durch den Einsatz von Feuerwaffen und Artillerie. Dies vor allem wegen der hohen Verluste an Soldaten. Seitdem kam es zu einem Umdenken der Militärs und zur Einführung der sogenannten »asymmetrischen Kriegsführung«, bei der sich die Soldaten im feindlichen Gelände den schwierigen örtlichen Bedingungen anpassen mussten und sich zusätzlich tarnten. Ziel war es, dadurch möglichst hinter die feindlichen Linien zu gelangen und den Gegner aus dem Hinterhalt zu bekämpfen. Dabei ging es für die Soldaten samt Waffe und Gepäck über Stock und Stein, über natürliche, aber auch feindliche Hindernisse jeder Art. Egal ob Wassergräben, Wände und Mauern, Panzersperren oder Stacheldrähte – das schnellstmögliche Bewältigen der Barrieren war schlichtweg lebensnotwendig, um nicht vor die feindlichen Geschütze zu geraten.
Sportler überwinden beim OCR zum Teil martialische Hindernisse. Hier beim Getting Tough –The Race 2015.
Also versuchte man in den Kasernen, die Soldaten bestmöglich auf ihren Einsatz vorzubereiten. Spätestens jetzt kamen die Hindernisbahnen ins Spiel. Hier lernten die Männer neben Ausdauer, Beweglichkeit und Kraft auch die lebensrettende Schnelligkeit im Gelände. Sie perfektionierten den Wechsel zwischen aufrechtem Lauf und der niedrigsten Gangart, dem Krabbeln oder Robben, sowie dem Bewältigen der Hindernisse. Da man sich unaufhörlich auf den verschiedenen Ebenen bewegen und der Körper immer wieder auf einen neuen Impuls reagieren musste, bedurfte dies einer sehr hohen körperlichen Fitness. Diese Trainingseinheiten wurden mit einfachen Worten befohlen: »Dran! Drauf! Drüber!« Bis heute gelten diese Worte als Schlachtruf der Infanterie (Panzergrenadiere).
Noch heute ist die Hindernisbahn ein fester Bestandteil der Grundausbildung in deutschen, aber auch europäischen Kasernen. Die Hindernisbahn – kurz auch H-Bahn, HiBa oder Sturmbahn genannt – ist eine militärische Ausbildungsanlage, die Körperkraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Schnelligkeit der Soldaten schulen soll. Im Prinzip ist sie mit einem militärischen Zirkeltraining vergleichbar, aber bei vielen Soldaten eher gefürchtet als geliebt. Wer sich bis zur Bundeswehrzeit weniger um seine körperliche Fitness gekümmert hat, der wird die Hindernisbahn eher als notwendiges Übel betrachten. Bei anderen, wie auch bei mir, kann die HiBa aber auch den Beginn einer lebenslangen Faszination bedeuten.
Beim Militär wird die Hindernisbahn, die in der Regel etwa 200 bis 500 Meter lang und mit rund 12 bis 20 Hindernissen aus Holz, Beton und Stahl bestückt ist, entweder einzeln oder in der Gruppe überwunden. Bei letzterer Methode sollen die Soldaten vor allem lernen, dass sie durch effektive Zusammenarbeit deutlich leistungsfähiger sind und wie sie sich im Team gegenseitig helfen können. Je nach Ausbildungsstand kann auf der militärischen Hindernisbahn der Schwierigkeitsgrad enorm gesteigert werden.
So ist das Absolvieren der Bahn durch die Mitnahme von Waffe und Gepäck, unter reduzierter Sauerstoffzufuhr – also dem Tragen von ABC-Schutzbekleidung –, bei Nacht, bei Regen oder inklusive des Transportes eines »verwundeten« Kameraden, der durch einen Baumstamm ersetzt wird, an der Tagesordnung. Aber nicht nur in Deutschland ist die Bahn Bestandteil der Ausbildung, sondern nahezu weltweit.
Zu jeder Hindernisbahn gehören mindestens folgende Stationen: Eskaladierwand (eine 1,80 bis 2,50 Meter hohe Wand), Steigbahn, Balancierbalken, Gleithindernis (das typische Kriechen unter dem Stacheldraht), Schützen- beziehungsweise Wassergraben, Stolperdrähte und Spanische Reiter (x-förmig angeordnete Holzbalken, die überstiegen werden müssen).
Ein Sportler trägt einen Baumstamm, der einen verwundeten Kameraden simulieren soll.
Hindernislauf goes Olympia
Der Hindernislauf ist jedoch nicht rein militärisch geprägt. Bereits 1850 entstand aus einer Wette von Oxford-Studenten ein Wettkampf, der ein bekanntes Pferderennen nachahmte: ein sogenanntes Steeplechase, also ein Hindernisrennen von Kirchturm zu Kirchturm. Bei diesem Wettkampf mussten die Reiter mit ihren Pferden querfeldein verschiedene natürliche Hindernisse wie Zäune oder Wassergräben überwinden. Als Wegweiser diente jeweils der Kirchturm des nächsten Ortes. Nun sollten Läufer diese Strecke bewältigen, die genau wie die Jockeys Gewichte mittrugen, um sich je nach Alter oder Leistung möglichst gleiche Siegchancen zu sichern. Im Jahr 1900 wurde dieser Hindernislauf, der damals auf einer Strecke von 2.500 und 4.000 Metern durchgeführt wurde, sogar ins olympische Programm aufgenommen. Seit 1928 einigte man sich auf eine Streckenlänge von 3.000 Metern, die noch heute Gültigkeit hat. Die Athleten bei den Olympischen Spielen absolvieren den Hindernislauf auf einer 400-Meter-Bahn und müssen insgesamt 28-mal eine Hürde von exakt 3 Fuß Höhe (91,4 Zentimeter) und 7-mal einen Wassergraben mit einer Breite von 13 Fuß (3,66 Meter) und einer Tiefe von bis zu 70 Zentimetern überwinden.
Seit den Sommerspielen 1912 in Stockholm wurde eine weitere Sportart populär, die speziell für Olympia konzipiert wurde: der Moderne Fünfkampf. Er beinhaltet die klassischen Offiziersdisziplinen, wie Pistolenschießen, Degenfechten und Military-Reiten (Querfeldeinreiten mit natürlichen und künstlichen Hindernissen) – angereichert mit Schwimmen und Querfeldeinlauf. So war der Moderne Fünfkampf ursprünglich darauf ausgelegt, die optimalen Fertigkeiten von Soldaten miteinzubeziehen und somit den idealen Athleten zu formen. Kein Wunder also, dass der Moderne Fünfkampf bis zum Zweiten Weltkrieg überwiegend von Angehörigen der Militärs betrieben wurde. Aber auch hier finden sich Parallelen zum heutigen Hindernislauf, denn beim Querfeldeinlauf, dem sogenannten Crosslauf, mussten die Sportler ein profiliertes Gelände abseits befestigter Wege, mit natürlichen Hindernissen bewältigen. Bis heute kämpft der Moderne Fünfkampf jedoch um Popularität, und es stand bereits zweimal zur Diskussion, ihn aus dem Olympia-Programm zu streichen.
Einige Jahre später, im Jahr 1946, hatte der französische Offizier Henri Debrus die Idee, einen sportlichen Wettkampf ausschließlich für die Armee zu organisieren. Inspiriert wurde er dabei vom anspruchsvollen körperlichen und technischen Training der niederländischen Fallschirmjäger. Diese mussten mit ihrem Fallschirm über einer gekennzeichneten Zone abspringen und anschließend eine Strecke von 20 Kilometern, gespickt mit zahlreichen Hindernissen und Kampfübungen, bewältigen. Debrus ließ das Fallschirmspringen weg und modifizierte die einzelnen Disziplinen nach seiner Vorstellung von einem idealen Grundlagentraining für den modernen Soldaten. Fähigkeiten wie Fechten und Reiten empfand er nach dem Zweiten Weltkrieg als obsolet. Daher kann aus militärischer Sicht der Militärische Fünfkampf als eine Weiterentwicklung des Modernen Fünfkampfs betrachtet werden.
Der Militärische Fünfkampf nach CIOR-Reglement besteht bis heute aus:
• Überwinden der Hindernislaufbahn Land: 500 Meter, 20 international genormte Hindernisse (in Uniform)
• Hindernisschwimmen: 50 Meter, 4 Hindernisse sind zu untertauchen und zu überwinden (in Uniform)
• Schießen: Langwaffe – 200 Meter liegend freihändig, Kurzwaffe – 50 Meter stehend
• Werfen: Handgranaten-Zielwurf
• Orientierungslauf: 12 bis 16 Kilometer (in Uniform)
Der Militärische Fünfkampf nach CISM-Reglement ist militärisch etwas entschärft, obwohl er weltweit nur von Sportsoldaten (Zeit- und Berufssoldaten) durchgeführt wird. Gestartet wird immer in Sportkleidung. Der Orientierungslauf ist durch einen Geländelauf (Crosslauf, 8 Kilometer Männer, 4 Kilometer Frauen) ersetzt und das Pistolenschießen entfällt.
Der erste Wettkampf fand 1947 in Freiburg, in der französischen Besatzungszone in Deutschland, statt. Teilnehmende Länder waren Belgien, Frankreich und die Niederlande. Seit 1950 werden jährlich Weltmeisterschaften abgehalten. Seitdem wuchs die Gemeinschaft des Militärischen Fünfkampfes stetig an und zählt zurzeit über 30 Länder. Obwohl der Sport in Deutschland nicht so verbreitet ist wie in anderen Ländern, gibt es mit den aktiven Sportsoldaten des Conseil International du Sport Militaire (CISM) und den Reservisten der Confédération Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR oder AESOR) zwei Gruppen, die ihm erfolgreich nachgehen. Seit den Weltmeisterschaften 1991 in Oslo nehmen auch Frauen an den Wettkämpfen teil.
Soldat beim Hindernisschwimmen
EXTREM-HINDERNISLAUF IN DEUTSCHLAND? NIEMALS!
Der erste Teilnehmer aus Deutschland, der beim Tough Guy in England an den Start ging, war kein geringerer als Stefan Schlett. Seit über 35 Jahren betreibt er Extremsport und ist Spezialist für alle Sportarten zu Land, zu Luft und im Wasser. Stefan hat auf allen sieben Kontinenten Marathonläufe absolviert und ist der erste Mensch, der den höchsten (Mount Everest, Nepal), den tiefsten (See-Ge-nezareth, Israel), den nördlichsten (Spitzbergen, Norwegen) und den südlichsten (Antarktis) Marathon gelaufen ist. Bereits 1985 startete er beim legendären Ironman auf Hawaii. Er finishte den Badwater Ultramarathon (217 Kilometer durch das Tal des Todes), die Xerox-Challenge (Durchquerung Neuseelands per Mountainbike, Kajak, Rennrad und zu Fuß; 2.444 Kilometer in 22 Tagen) und belegte bei der Weltpremiere des Deca Ultra Triathlons, also des zehnfachen Ironman, in Mexiko den 2. Rang. Er bestritt insgesamt vier Kontinentaldurchquerungen: das Trans America Footrace (4.724 Kilometer in 64 Tagen), das Trans Australia Footrace (4.293 Kilometer in 63 Tagen), das Trans Europa Footrace (5.036 Kilometer in 64 Tagen), sowie die Tour d’Afrique (11.919 Kilometer per Mountainbike in 121 Tagen), und er siegte beim 1.000-Meilen-Rennen in New York. Bis heute hat er vierzehn Mal am Grand Raid de la Réunion teilgenommen, er hat den Mount McKinley, den Kilimandscharo und den Elbrus bestiegen und knapp 500 Fallschirmsprünge absolviert.
Stefan Schlett beim Tough Guy 1997
Und obwohl er über genügend Extremsport-Erfahrung verfügt und in seinem Leben sicher vieles gesehen und erlebt hat, veröffentlichte er nach seinem erfolgreichen Finish beim Tough Guy Race im Januar 1997 eine siebenseitige Reportage in der Fit for Life, dem Schweizer Fachmagazin für Lauf- und Ausdauersport, in dem es heißt: »[…] Eine endlose Serie von Wassergräben und -löchern wird immer wieder von kurzen und steilen Laufpassagen unterbrochen, um den Körper auf Betriebstemperatur zu halten. Kaum hat man sich von der letzten Gemeinheit erholt, folgt die nächste. Der Designer dieses Streckenabschnittes muss ein professioneller Sadist sein! In meiner Zeit als Soldat habe ich viele Hindernisbahnen kennengelernt, war sogar auf Kursen der Special Forces in den Vereinigten Staaten unterwegs. Aber das hier stellt noch einmal eine Steigerung dar. […]« Gleichzeitig prophezeite Stefan, dass es einen solchen Lauf in Deutschland niemals geben würde. Dafür nannte er mehrere stichhaltige Gründe. Zum einen würde keiner eine solche Veranstaltung genehmigen, geschweige denn versichern. Infolgedessen würde kein Veranstalter ein solches Risiko zur Organisation eines derartigen Laufes auf sich nehmen. Und zu guter Letzt war sich Stefan zu einhundert Prozent sicher, dass sich »der verwöhnte deutsche Volksläufer nicht auf solch primitive Spielchen herablassen würde«. Er sollte sich gewaltig irren.
Und weil das Erlebnis so intensiv und das Rennen so außergewöhnlich war, kehrte Stefan noch zweimal nach England zurück. 1999 sogar mit einem deutschen Filmteam im Schlepptau, das eine halbstündige Reportage über den Lauf produzierte. Spätestens jetzt, als die bewegten Bilder in aller Härte des Rennens in den deutschen Wohnzimmern Einzug hielten, konnte sich der Veranstalter des Tough Guy vor deutschen Läufern kaum mehr retten.
Etwa 14 Jahre später startete Stefan beim Braveheart Battle, einem Rennen in Münnerstadt, bei dem es auf 26 Kilometern Länge 45 Hindernisse und rund 2.400 Höhenmeter zu überwinden galt. Nach seinem Finish verglich er das Rennen mit seinem Vorbild Tough Guy: »[…] Um 11.11 Uhr wurden die Höllenfürsten und -fürstinnen mit diabolischem Gebrüll auf das Schlachtfeld losgelassen. Schon nach knapp 2 Kilometern gab’s ein erfrischendes Vollbad in der Lauer (Wassertemperatur 6 Grad Celsius), 11 weitere Tauchbäder sollten noch folgen. Nach den Schockfrostungen an den Wassergräben wurden jeweils derart anspruchsvolle Hindernisse in den Weg gestellt, dass der Body, kurz vor dem Erfrierungstod stehend, wieder aufgeheizt wurde. Zwischendurch fanden sich immer wieder längere Laufeinheiten zum Erholen. Dieser Wettbewerb ist um einiges heftiger als der Tough Guy, wie ich ihn noch aus 1999 kenne. Braveheart ist Tough Guy 2.0. Ach was, 3.0. Ultralang, ultrastark, ultrahart und ultrageil. Jedes Hindernis ein Genuss, jeder Cent Startgeld eine Topinvestition. Und dann die ganzen Irren, Kostümierten, Angemalten – einfach herrlich so viel Lebensfreude! Fazit: Gelobt sei, was hart macht – Extrem-Hindernisläufe sind einfach oberaffengeil! […]«
MOTIVATION OCR: WAS REIZT DICH IN DEINEM ALTER IMMER NOCH AN DERARTIGEN »KAMPFEINSÄTZEN«?
Stefan Schlett (Jg. 1962), Extremsportler und erster Deutscher beim Tough Guy
»Erstens fühle ich mich im 35. Jahr meiner Extremsportkarriere noch fit genug dafür. Zweitens ist es – wie man hier in Bayern zu sagen pflegt – eine ›Brunsgaudi‹. Zudem ist es ein Ganzkörpereinsatz, bei dem vor allem auch die koordinativen und technischen Fähigkeiten gefordert werden. Und nicht zuletzt das Hirn. Strategisch intelligentes Verhalten, mentale Stärke und Kältemanagement tragen wesentlich zum Erfolg bei. Sozusagen athletisches Multitasking. Im Gegensatz zu den üblichen Volks- und Straßenläufen, die dagegen recht altbacken wirken, sind die Schlamm- und Hindernisläufe eine neue und äußerst reizvolle Abwechslung und vor allem Herausforderung. Ich bin der Meinung, dass jeder gesunde, gut trainierte und mental starke Mensch, im Alter zwischen 15 und 75, solche Rennen bewältigen kann. Der Erfolg dieser Veranstaltungen ist zumindest eine Gegenbewegung zur immer noch überfetteten, degenerierten und bewegungsarmen Mehrheit in unseren westlichen Gesellschaften. Ja, es besteht Suchtgefahr, aber da dieser Begriff eher mit negativen Attributen versehen ist, würde ich es als einen Trieb nach Lebenslust, Lebensqualität und archaischer Kampfeslust bezeichnen.«
OCR MADE IN GERMANY
Dennoch dauerte es nach dem ersten Tough Guy einige Jahre, bis die Extrem-Hindernislauf-Welle von Großbritannien in die USA und schließlich nach Deutschland schwappte. Als ein PR-Event der Kultmarke Fisherman’s Friend fiel am 4. Februar 2007 um 12 Uhr der Startschuss zum ersten Fisherman’s Friend Strongman Run auf dem Truppenübungsplatz der Lützow-Kaserne in Münster. Bei der Premiere des 12 Kilometer langen und mit 22 Hindernissen gespickten Rennens waren bereits 1.915 Teilnehmer am Start. 1.596 davon kamen ins Ziel. Aufgrund des überwältigenden Teilnehmer-Feedbacks wurde sogleich eine Fortsetzung des Rennens im nachfolgenden Jahr beschlossen, deren Serie bis heute anhält. Seitdem gilt der Strongman Run als die Mutter aller Hindernisläufe in Deutschland. Bei der zweiten Auflage stieg die Zahl der Teilnehmer bereits um mehr als das Doppelte auf 5.325. Auch wenn die Startgebühr von ehemals 15 Euro bis heute auf mehr als 60 Euro auf vergleichbarer Strecke angestiegen ist, ist das Rennen noch immer der Extrem-Hindernislauf mit der weltweit höchsten Teilnehmerzahl – nämlich rund 13.000.
Weitere nationale und internationale Formate, die sich auf deutschem Boden dauerhaft etablieren konnten, folgten zwar erst 2010 mit dem Braveheart Battle, bei dem bei der Premiere am 13. März 2010 von 592 Startern 421 ins Ziel kamen, doch in der Folge schossen sie wie Pilze aus dem Boden. Die meisten Rennen feierten schnelle Erfolge und konnten die Teilnehmerzahlen innerhalb kürzester Zeit verdoppeln oder gar verdreifachen. Derzeit ist es fast unmöglich, einen Überblick über die Vielzahl der Läufe zu bewahren, die allein im deutschsprachigen Raum angeboten werden.
Extrem-Hindernisläufe trafen Ende der 2000er-Jahre haargenau den Zahn der Zeit. Betrachtet man sich die gesamte Laufentwicklung in Deutschland, macht sich ein interessanter Trend bemerkbar. Nach den Zahlen der Statistik Laufmarkt 2015 von Prof. Dr. Roland Döhrn waren es 2003 noch deutlich mehr Läufer, die bei einem Marathon ins Ziel kamen, als bei einem Halbmarathon. Heute ist die Finisher-Zahl der Halbmarathons mehr als doppelt so hoch wie die der Marathonläufer (im Jahr 2015: Marathon: 113.891; Halbmarathon: 244.772). Das liegt zum einen daran, dass Marathontraining zeitaufwendig und intensiv ist, und zum anderen, dass viele Läufer keine großen sportlichen Ambitionen mehr hegen, sondern beim Laufen einfach nur ihren Spaß haben wollen. Um einen Hindernislauf zu absolvieren, muss man kein Leistungssportler sein. Wenn es rein um das Finishen geht, ist es nicht nötig, wöchentlich 10 Stunden oder mehr zu trainieren. Für jeden, der regelmäßig Sport treibt, ist es durchaus im Bereich des Möglichen, eine Kurzstrecke (5 bis 8 Kilometer), gespickt mit Hindernissen, zu absolvieren. Dazu ist im Gegensatz zu einem Triathlon auch keine kostspielige Ausrüstung erforderlich. Man benötigt kein Fahrrad, keinen Neoprenanzug und keine teure Ausstattung. Gute Laufschuhe und Sportklamotten sind vollkommen ausreichend, um einen Hindernislauf zu bewältigen.
Dass es bei vielen Startern tatsächlich nur um den Spaß geht, zeigt sich am Beispiel des Tough Mudder, einem Obstacle Race, das von zwei Briten konzipiert und 2010 erstmals in den USA ausgetragen wurde. Das Prinzip dieses Laufes beruht darauf, dass, auch wenn Einzelstarter zugelassen sind, viele Hindernisse oftmals nur gemeinsam im Team bewältigt werden können. Es steht weniger die erreichte Zeit als vielmehr der Spaßgedanke im Vordergrund. Es gibt keinerlei Zeitnahme, kein Ranking und kein Preisgeld (ausgenommen beim World’s Toughest Mudder). Ohne Konkurrenzdruck entstehen Teamgeist und ein Wir-Gefühl. Lediglich das erfolgreiche Absolvieren der Strecke und der Stolz, dies als Team geschafft zu haben, sind die Belohnung für die Strapazen. Und der Erfolg gibt den Veranstaltern recht. Inzwischen werden rund 70 Events in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Australien, Neuseeland und Deutschland ausgetragen. 2014 waren es nach Angaben des Veranstalters weltweit über eine halbe Million Menschen, die an Tough Mudder-Events teilgenommen haben.
MOTIVATION OCR: WAS TREIBT DICH AN?
Marcus Gilde (Jg. 1968) aus Hamburg, Flugzeugmechaniker
»Von 2004 bis 2015 nahm ich insgesamt zwölfmal am Tough Guy Race im Januar teil. Elf Mal erreichte ich dabei das Ziel. Lediglich 2010 fiel ich wegen einer Fußverletzung im Rennen aus. Dennoch darf ich mich Tough Guy Veteran nennen. Ein nicht ganz ernst zu nehmender Stolz bewegt mich … Warum es mich immer wieder zum Tough Guy zieht? Das Braveheart-Feeling, der Spirit der Tough Guy Family und das mit allen Sinnen einprägsame Erlebnis des Rennens, wie der Geruch der Erde und der Geschmack des dortigen Wassers, sind der Antrieb, mich unmittelbar nach dem Rennen für das nächste Jahr zu registrieren. Der Tough Guy ist unvergleichlich, nicht kopierbar und vor allem eines: nachhaltig für alle Sinne.«
Marcus (links) mit Jürgen Birner beim Tough Guy
Alle diese Faktoren könnten verantwortlich für die besonders rasanten Zuwachszahlen bei Extrem-Hindernisläufen sein. Sie entwickelten sich von der Randerscheinung in der Laufszene, die anfänglich eher der Teilnahme für Spezialisten zugeordnet wurde, zu einem wahren Massenphänomen und einer ganz neuen Richtung der deutschen Laufbewegung. Nach der Statistik von Prof. Dr. Döhrn betrug 2008 die Zahl der deutschen OCR-Finisher 4.069. Zwei Jahre später waren es bereits 10.277 und 2012 hatten mit 22.737 Läufern schon mehr als doppelt so viele einen Extrem-Hindernislauf erfolgreich absolviert. Im Jahr 2015 nahmen sagenhafte 54.422 Läufer erfolgreich an einem Extrem-Hindernislauf teil. Damit wuchs die Zahl im Vergleich zum Vorjahr erneut um 24 Prozent. Für die weiteren Jahre prognostizierte Döhrn »viel Luft nach oben«. Jedoch ist die Entwicklung auf dem OCR-Markt rasant und der Überblick fällt schwer. Da die oben genannten Zahlen nur die in der Datenbank erfassten Wettkämpfe und beispielsweise keine Läufe ohne Zeitnahme beinhalten (wie beispielsweise den Tough Mudder) – denn ohne offizielle Liste der Einzelergebnisse lassen sich keine Finisher-Zahlen feststellen –, ist die »Dunkelziffer« der tatsächlichen Extrem-Hindernisläufer in Deutschland weitaus höher.
Insbesondere jüngere Generationen fühlen sich weniger zu traditionellen Wettkämpfen und mehr zu OCR-Läufen hingezogen. Deutlich mehr als die Hälfte der Teilnehmer ist jünger als 35 Jahre alt. Auch die Zahl der Frauen an Extrem-Hindernisläufen hat sich von anfänglich 10 auf mittlerweile 25 Prozent gesteigert.
In anderen Ländern ist die Entwicklung der Teilnehmerzahlen noch gravierender. Wikipedia zufolge sollen 2011 bereits etwa eine Million Menschen an OCRs in den USA teilgenommen haben. Tendenz steigend. Wie populär die Hindernislauf-Szene geworden ist, zeigt auch, dass 2016 erstmals deutsche Meisterschaften, wie die German OCR League (Einzelstarter- und Team-Wertung), die GERMAN-OCR-Masters (Einzelstarter) oder der GERMAN-OCR-Cup (Teams), eine Europameisterschaft (OCR European Championship) und seit 2014 eine Weltmeisterschaft, die OCR World Championship, ausgetragen wurden.
Seit 2016 gibt es die German OCR League, die erste unabhängige Liga für Hindernisläufe in Deutschland. Diese Liga besteht aus 15 Lauf-Events, bei denen die Läufer Punkte sammeln können. Die Gesamtpunktzahl setzt sich am Ende aus den drei besten Einzelwerten zusammen. Der Gewinner kann dann den Titel German OCR League Champion tragen.
Eine weitere Rennserie ist die GERMAN-OCR-SERIES. Sie wurde nach eigener Aussage ins Leben gerufen, um dem Extrem-Hindernislauf auch in Deutschland künftig eine professionelle Plattform zu geben. Nach einer Pilotphase 2016 besteht die Serie im Jahr 2017 aus 6 Läufen. Dem Sieger winkt eine stolze Geldprämie von 500 Euro.
DIE FRAGE NACH DEM WARUM
Bleibt am Ende noch immer eine Frage offen: Warum spricht es so viele Menschen überhaupt an, über Hindernisse zu springen und sich ausgiebig im Matsch zu suhlen? Ist es die Flucht aus dem Alltag? Das Durchbrechen von Konventionen? Der Wunsch, die Mauern rund um die Komfortzone zu sprengen? Seit der Kindheit waren die meisten von uns ständigen Verboten ausgesetzt: Mach dich nicht dreckig! Spring nicht in die Pfützen! Werde nicht nass! Gehe nicht ohne Schirm in den Regen! Bleibe stets auf dem Gehweg … Diese Liste lässt sich beliebig lange fortsetzen. Dabei war es bereits für uns Kinder das Größte, sich diesen Verboten zu widersetzen. Wer spielte nicht gern im Schlamm und sprang mit beiden Füßen in die Pfützen? Wem machte es keinen Spaß, mit Gummistiefeln bewaffnet, die Gewässer der Umgebung zu erkunden? Abenteuergeist und die Lust auf die Erforschung des Unbekannten, das trieb uns an. Wer im Berufsleben steht, den ganzen Tag im Büro sitzt, tagtäglich im Anzug herumläuft oder mit einem öden Alltag zu kämpfen hat, der möchte genau dieses Gefühl hervorkramen. Das Neue und Unbekannte erfahren, sich voller Adrenalin ins nächste Abenteuer stürzen. All das kann ein Extrem-Hindernislauf bieten. Durch die Teilnahme an einem solchen Rennen bewahren wir uns ein Stück unserer Kindheit. Aber auch Urinstinkte werden geweckt, die möglicherweise schon seit Jahrzehnten vor sich hinschlummern. Allein das Gefühl, alte Denkmuster zu durchbrechen, kann etwas Erlösendes sein.
»Mach dich nicht dreckig!« Das gilt beim Extrem-Hindernislauf sicher nicht.
Viele der Teilnehmer am Obstacle Course Race waren zuvor klassische Läufer. Rennen auf der Bahn, Volksläufe auf Asphalt oder einen Stadtmarathon zu stemmen, kann auf Dauer ein bisschen fad erscheinen. Man läuft sein Rennen, kommt ins Ziel – und Schluss. Viele wollen Neues ausprobieren und beim fen etwas erleben, von dem sie im Anschluss das Gefühl haben, Außergewöhnliches geschafft zu haben. Den intensiven Triumph, der sich nach dem ersten absolvierten Marathon noch eingestellt hatte, suchen Läufer ab da vergeblich. Jede Wiederholung ist zwar ein Erfolg, aber für viele keine wahre Herausforderung mehr. So erleben auch Ultraläufe oder Ultra-Trailläufe ab einer Länge von 42,2 Kilometern einen enormen Zuwachs. Waren es 2006 gerade mal knapp 4.000 Läufer aus Deutschland, die einen Ultralauf absolvierten, so stieg die Zahl bis heute auf mehr als das Doppelte an. Auch hier geht es den meisten Teilnehmern nicht darum, eine besondere Zeit oder eine besondere Leistung zu erzielen. Es geht um das Gefühl, mit Gleichgesinnten in der Natur unterwegs zu sein, eine Strecke zu absolvieren, die vor Jahren noch unerreichbar erschien, und fernab von Computer, Smartphone und Erreichbarkeit vor allem eines zu haben: Spaß!
Jedoch ist vielen Ausdauersportlern ein Ultralauf zu lang und die Trainingszeit begrenzt. Wer nicht primär vom Laufen kommt und eher vielseitig sportlich unterwegs ist – sich also in den verschiedensten Sportarten, sei es Teamsport, Klettern oder Radfahren wohlfühlt –, der wird beim Extrem-Hindernislauf ebenso auf seine Kosten kommen. Meist genügt es schon 5, 10 oder 20 Kilometer zu bezwingen, sich aber dank der Hindernisse, bei denen man sich immer wieder konzentrieren und motivieren muss, total zu verausgaben und ganzkörperlich gefordert zu sein.
Laufen ist ein wichtiger Bestandteil des OCR.
Aber auch der Teamgedanke spielt bei vielen Teilnehmern eine große Rolle. Gemeinsam etwas Anstrengendes durchzustehen und mit Teamwork die Herausforderung zu meistern. Bei einem OCR ist dieser Gedanke viel stärker ausgeprägt als beispielsweise bei einem Marathon. Das im übertragenen Sinne gemeinsame »Überleben in der Wildnis« spornt viele Sportler an, Leistungen zu vollbringen, die allein undenkbar sind. Einer für alle, alle für einen! Wir schaffen das gemeinsam! Zusammen sind wir stärker! Egal, welches Motto propagiert wird, von vielen Veranstaltern wird speziell der Teamgedanke beworben. Es wird Wert darauf gelegt, dass man sich gemeinsam hilft, die Hindernisse zu bewältigen. Aber nicht nur den Leuten im eigenen Team, sondern auch völlig fremden Mitstreitern. Manche Hindernisse sind sogar so konzipiert, dass diese nur in Teamwork bewältigt werden können, und das schweißt zusammen und fördert die Verbindung zwischen Freunden, Vereinskollegen oder Arbeitskollegen – aber auch zu völlig Fremden.
MOTIVATION OCR: WAS TREIBT DICH AN?
Jeffrey Norris (Jg. 1959) aus Nürnberg, blinder Ultraläufer und Triathlet
»Hindernisläufe als Blinder … ? Warum nicht!? Natürlich erreiche ich bei solchen Events keine vordere Platzierung, aber darum geht es mir auch nicht. Diese Läufe dienen der motorischen Geschicklichkeit, der mentalen Stärkung und fördern den eigenen Willen. Zudem reiße ich dabei Schranken ein, die in manchen Köpfen die freie Sicht versperren … Für manch einen ist es sicher fraglich, wie ein Blinder einen solchen Hindernislauf bewältigt. Und der eine oder andere wundert sich darüber, warum ein Blinder überhaupt an einem Obstacle Course Race teilnehmen will. Meine Antwort dazu ist stets: Ja, warum denn nicht!?
Aber wie schafft es ein blinder Läufer, ein solches Rennen zu absolvieren? In erster Linie benötigt er ein Team, das aus einem oder mehreren Guides besteht. Jeder dieser Guides muss bereit sein, sich auf eine völlig ungewohnte, manchmal abenteuerliche Situation einzulassen. Dabei geht es vor allem um die adäquate Kommunikation, um Vertrauen in sich und in das Team und den eisernen Willen, gemeinsam über die Ziellinie zu laufen. Nur wenn all diese Faktoren reibungslos zusammenspielen, ist der Teamerfolg garantiert!
Jeffrey Norris muss sich auf sein Team verlassen können.
Meine erste Teilnahme an einem OCR erlebte ich beim Braveheart Battle 2012. Ich bekam die Anfrage von Promi-Bodyguard Peter Althof, ob ich für sein Team starten würde. Der Battle wurde mir als »härtester Extremlauf Deutschlands« beschrieben, was ich jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht einschätzen konnte, war ich doch bislang überwiegend im Ultralauf und Triathlon aktiv. Das Rennen war zwar eine physische Herausforderung, jedoch ging ich im Vergleich zu den weiteren OCRs, an denen ich in der Folge teilnahm, nicht an meine psychische Grenze, da zwischen den Hindernissen genug Abstand war, um immer wieder »mental« durchzuatmen. Beim RUNTERRA in Zirndorf war es schon etwas knackiger! Ein Hindernis folgte dem nächsten, und es ging Schlag auf Schlag. Hier war ich vom Start an unter Spannung, und alle Sinne waren voll auf Empfang gestellt. Viel Schlamm, viel Wasser und immer wieder krabbeln, kriechen und klettern – ich sag nur: Augen zu und durch …!
Bei NoGuts NoGlory, der auf einem Reiter-Gutshof stattfand, bin ich ein hohes Wagnis eingegangen: Ich kannte weder das Terrain und die Veranstaltung noch die Jungs, die mich begleiten sollten. So lernte ich mein Team – die Tough Troopers – erst eine Stunde vor dem Start kennen. Alle drei wirkten immer gelassen, richtig cool und vermittelten mir: Der Weg ist frei, wir müssen nur noch über die Finishline! Bei einigen Hindernissen bemerkte ich erst nach dem Bewältigen, wie krass sie eigentlich waren. Ich erinnere mich ganz besonders an einen Baumstamm, der als Brücke diente und überquert werden musste, oder an eine Hängebrücke aus Seilen, auf der man sich von Schlinge zu Schlinge voranbewegte … Es waren alles herausfordernde Hürden, die unseren Weg säumten, aber mein Team war stets aufmerksam, souverän und absolut sicher – sie ebneten mir den Weg. Die Tough Troopers hatten diese spezielle Mission angenommen und bestens erfüllt. Doch es war nicht nur die Mission, die erfüllt wurde, sondern auch ich war erfüllt, von dem, was sie mir durch ihre Unterstützung geboten hatten!«