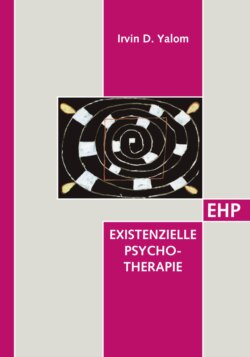Читать книгу Existenzielle Psychotherapie - Irvin D. Yalom - Страница 48
Stadien des Wissens
ОглавлениеEin Arbeitsmodell für die kindliche Entwicklungsfolge des Todesbegriffs hängt von der offenen Frage ab, wann es zuerst vom Tod »weiß«. Entweder das Kind entwickelt allmählich eine Bewusstheit und ein Verständnis des Todes; oder, wie ich glaube, das Kind wird von einem sprunghaften Prozess erfasst, zuviel zu früh zu wissen, und findet dann einen Weg, jenes Wissen zu verdrängen, zu »verlernen«, bis es allmählich darauf vorbereitet ist, das zu akzeptieren, was es ursprünglich wusste. In dieser Angelegenheit gibt es keine Sicherheit; es gibt keine zwingenden Beweise für die beiden Standpunkte.
Ich betrachte die Stadien, die dem ersten Wissen eines Kindes vom Tod folgen, als auf Verleugnung gegründet. Das Konzept der Verleugnung schließt die Existenz vorhergehenden Wissens mit ein: Man kann nur das verleugnen, was bekannt ist. Wenn ein Leser sich entscheidet, die Argumente, die ich zur Unterstützung des vorangehenden Wissens angeführt habe, nicht zu akzeptieren, dann muss er dort, wo ich »Verleugnung« geschrieben habe, »Annäherung an Wissen« lesen.
Verleugnung: Der Tod ist temporär, ein Vergehen, nur Scheintod oder Schlaf. Viele Kinder, die alt genug sind zu sprechen, berichten, dass sie den Tod für reversibel oder temporär oder für ein Nachlassen halten, statt des Endes des Bewusstseins. Diese Ansicht erhält große Unterstützung durch die allgegenwärtigen Zeichentrickfilme im Fernsehen, die Typen zeigen, welche auf eine unendliche Vielzahl von Möglichkeiten zerrissen, platt gedrückt, zermalmt oder verstümmelt werden und dann schließlich und wunderbarerweise wiederhergestellt sind. Nagy berichtet von einigen anschaulichen Interviewauszügen:
S.C. (vier Jahre, 8 Monate): »Es kann sich nicht bewegen, weil es im Sarg ist.«
»Wenn es nicht im Sarg wäre, könnte es sich bewegen?«
»Es kann essen und trinken.«
S.J. (5 Jahre, 10 Monate): »Seine Augen waren geschlossen, es lag dort so tot. Was immer man auch tut, es sagt kein Wort.«
»Wird es nach zehn Jahren das gleiche sein wie zu der Zeit, als es begraben wurde?«
»Es wird dann älter sein, es wird immer älter und älter sein. Wenn es hundert Jahre alt ist, wird es genau wie ein Stück Holz sein.«
»Wie wird es wie ein Stück Holz sein?«
»Das könnte ich nicht sagen. Meine kleine Schwester wird jetzt fünf Jahre alt sein. Ich war noch nicht am Leben, als sie starb. Sie wird jetzt so groß sein. Sie hat einen kleinen Sarg, aber sie passt in den kleinen Sarg.«
»Was glaubst du macht sie jetzt?«
»Sich hinlegen, immer dort liegen. Sie ist noch so klein, sie kann nicht wie ein Stück Holz sein. Nur sehr alte Leute.«
»Was passiert dort unter der Erde?«
B.I. (4 Jahre, 11 Monate): »Er schreit, weil er tot ist.«
»Aber warum sollte er schreien?«
»Weil er vor sich selbst Angst hat.«
T.P. (4 Jahre, 10 Monate): »Ein toter Mensch ist gerade so, als wenn er schlafen würde. Er schläft auch in der Erde.«
»Schläft genau so wie du in der Nacht oder anders?«
»Nun – schließt seine Augen. Schläft wie die Leute in der Nacht. Schläft so, gerade so.«
»Wie weißt du, ob jemand schläft oder tot ist?«
»Ich weiß es, wenn sie in der Nacht ins Bett gehen und ihre Augen nicht mehr öffnen.
Wenn jemand ins Bett geht und nicht aufsteht, ist er tot oder krank.«
»Wird er jemals aufwachen?«
»Nie. Ein toter Mensch weiß nur, wenn jemand zum Grab hingeht oder so. Er spürt, dass jemand da ist oder spricht.«
»Er spürt die Blumen, die auf sein Grab gelegt werden. Das Wasser berührt den Sand. Langsam, langsam hört er alles. Tante, spürt der tote Mensch, wenn es tief in den Grund sickert?« [das Wasser]
»Was glaubst du: Würde er gerne von dort weggehen?«
»Er würde gerne herauskommen, aber der Sarg ist zugenagelt.«
»Wenn er nicht im Sarg wäre, könnte er zurückkommen?«
»Er könnte nicht den ganzen Sand hochstoßen.«
H.G. (8 Jahre, 5 Monate): »Die Leute glauben, dass tote Menschen fühlen können.« »Und können sie das nicht?«
»Nein, sie können nicht fühlen, es ist, als wenn sie schlafen. Schau, ich schlafe, ich fühle es nicht, außer wenn ich träume.«
»Träumen wir, wenn wir tot sind?«
»Ich glaube, das tun wir nicht. Wir träumen niemals, wenn wir tot sind. Manchmal blitzt etwas auf, aber nicht halb so lang wie ein Traum.«
L.B. (5 Jahre, 6 Monate): »Seine Augen waren geschlossen.«
»Warum?«
»Weil er tot war.«
»Was ist der Unterschied zwischen schlafen und sterben?«
»Dann bringen sie den Sarg und legen ihn hinein. Sie legen die Hände so hin, wenn er tot ist.«
»Was passiert mit ihm im Sarg?«
»Die Würmer essen ihn. Sie bohren sich in den Sarg.«
»Warum lässt er sie herein?«
»Er kann nicht mehr aufstehen, weil da Sand über ihm ist. Er kann nicht aus dem Sarg heraus.«
»Wenn da kein Sand über ihm wäre, könnte er herauskommen?«
»Sicher, wenn er nicht sehr schlimm erdolcht wurde. Er könnte seine Hand aus dem Sand strecken und graben. Daran sieht man, dass er immer noch leben will.«
T.D. (6 Jahre, 9 Monate): »Der Patenonkel meiner Schwester starb, und ich fasste seine Hand an. Seine Hand war so kalt. Sie war grün und blau. Sein Gesicht war ganz faltig. Er kann sich nicht mehr bewegen. Er kann nicht mehr seine Hände zusammenpressen, weil er tot ist. Und er kann nicht atmen.«
»Sein Gesicht?«
»Es hat eine Gänsehaut, weil er kalt ist. Er ist kalt, weil er tot ist und für immer kalt ist.«
»Fühlt er die Kälte oder ist es, weil seine Haut so war?«
»Wenn er tot ist, fühlt er auch. Wenn er tot ist, fühlt er ein ganz kleines bisschen. Wenn er ganz tot ist, fühlt er nichts mehr.«
G.P. (6 Jahre): »Er streckte seine Arme aus und legte sich hin. Du konntest seine Arme nicht herunterdrücken. Er kann nicht sprechen. Er kann sich nicht bewegen. Er kann nicht sehen. Er kann seine Augen nicht öffnen, er liegt da vier Tage lang.«
»Warum vier Tage lang?«
»Weil die Engel noch nicht wissen, wer er ist. Die Engel graben ihn aus und nehmen ihn dann mit. Sie geben ihm Flügel und fliegen weg.«46
Diese Aussagen sind höchst informativ. Man ist erstaunt über die inneren Widersprüche durch den Wechsel der Wissensebenen, die sogar in diesen kurzen Exzerpten offensichtlich sind. Die Toten fühlen, aber sie fühlen nicht. Die Toten wachsen, aber irgendwie bleiben sie im gleichen Alter und passen in den Sarg von derselben Größe. Ein Kind begräbt einen Schoßhund, aber hinterlässt Nahrung auf dem Grab, weil der Hund ein wenig hungrig sein mag.47 Das Kind scheint an mehrere Stufen des Todes zu glauben. Die Toten können »ein ganz kleines bisschen« fühlen (oder mögen Traummomente haben); aber jemand, der »ganz tot ist, fühlt nichts mehr.« (Nebenbei werden diese Zitate von Nagy als Beweis dafür vorgelegt, dass ein Kind den Tod als temporär betrachtet oder ihn völlig verleugnet, indem es ihn mit Abreise oder Schlaf gleichsetzt. Wieder einmal scheint die Voreingenommenheit des Beobachters offensichtlich zu sein; für mich weisen die Passagen darauf hin, dass die Kinder umfassendes Wissen hatten.
Wenn man von Würmern gefressen wird, wenn man für immer unter dem Dreck bleibt, wenn man »ganz tot« ist und »nichts mehr fühlt«, dann ist daran nichts temporär oder unvollständig.
Die Gleichsetzung des Kindes von Schlaf und Tod ist wohlbekannt. Der Zustand des Schlafs ist für das Kind die Erfahrung, die dem Nicht-Bewusstsein am nächsten liegt, und ist der einzige Schlüssel des Kindes dazu, was es bedeutet, tot zu sein. (In der griechischen Mythologie waren der Tod, Thanatos, und der Schlaf, Hypnos, Zwillingsbrüder.) Diese Assoziation hat Implikationen für Schlafstörungen, und viele Kliniker haben darauf hingewiesen, dass Todesangst ein wichtiger Faktor bei Schlaflosigkeit von Kindern und Erwachsenen ist. Viele ängstliche Kinder betrachten den Schlaf als gefährlich. Denken Sie an das Kindergebet:
Now I lay me down to sleep,
I pray the Lord my soul to keep;
If I should die before I wake,
I pray the Lord my soul to take.
(Nun leg ich mich zum Schlafen hin,
Ich bitte den Herrn, meine Seele zu bewahren;
Wenn ich sterben sollte, bevor ich aufwache, bitte ich den Herrn, meine Seele zu sich zu nehmen.)
Die Aussagen, die Nagy sammelte, machen es auch sonnenklar, dass die Kinder den Tod als schrecklich und furchterregend betrachten, auch wenn ihr Wissen unvollständig ist. Die Vorstellungen, in einem zugenagelten Sarg gefangen zu sein, ganz allein unter der Erde zu weinen, hundert Jahre lang begraben zu sein und dann zu Holz zu werden, von Würmern gefressen zu werden, die Kälte zu spüren, blau und grün zu werden oder unfähig zu sein zu atmen, sind tatsächlich erschreckend.
Diese frühen Ansichten vom Tod bleiben mit erstaunlicher Beharrlichkeit im Unbewussten. Elliot Jaques beschreibt beispielsweise den folgenden Traum von einer klaustrophobischen Patientin mittleren Alters: »Sie lag in einem Sarg. Sie war in kleine Stücke geschnitten worden und war tot. Aber es gab spinnwebdünne Nervenfäden, die durch jedes Stück liefen und es mit ihrem Gehirn verbanden. Als Folge davon konnte sie alles erfahren. Sie wusste, dass sie tot war. Sie konnte sich nicht bewegen oder einen Ton von sich geben. Sie konnte nur in der klaustrophobischen Dunkelheit und Stille des Sarges liegen.«48
Die Ansichten von Kindern über den Tod sind ernüchternd, besonders für Eltern und Erzieher, die es vorziehen, die Unerfreulichkeit des gesamten Themas zu ignorieren. »Was sie nicht wissen, wird ihnen nicht weh tun«, ist die Argumentation hinter dem offiziell geduldeten Schweigen. Aber was die Kinder nicht wissen, das erfinden sie; und wie wir in den Beispielen sehen, sind die Erfindungen scheußlicher als die Wahrheit. Ich werde später mehr über die Todeserziehung zu sagen haben, aber für den Moment ist es offensichtlich, dass der Glaube der Kinder über den Tod wirklich erschreckend ist, und dass die Kinder sich gezwungen sehen, Wege zu finden, um ihren Geist zu beruhigen.
Verleugnung: Die zwei grundlegenden Bollwerke gegen den Tod. Das Kind hat zwei grundlegende Abwehrmöglichkeiten gegen den Schrecken des Todes – Abwehrmöglichkeiten, die aus dem ersten Lebensabschnitt stammen: Tiefer Glaube sowohl an seine persönliche Unverletzbarkeit als auch an die Existenz eines einzigartigen persönlichen letzten Retters. Dieser Glaube wird durch die direkte elterliche und religiöse Unterweisung, in Mythen über das Leben nach dem Tod, in Form der Existenz eines alles beschützenden Gottes und in der Wirksamkeit persönlicher Gebete unterstützt, und er gründet auch in der frühen Lebenserfahrung des Kleinkindes.
Besonderheit. Jeder von uns, erst als Kind und dann als Erwachsener, hängt an einem irrationalen Glauben an seine Besonderheit. Begrenzungen, Alt-Werden, Tod mag für die da gelten, aber nicht für einen selbst, nicht für mich. Auf einer tiefen Ebene ist man überzeugt von seiner persönlichen Unverletzlichkeit und Unvergänglichkeit. Die Ursprünge dieses originären Glaubens (oder der »Ur-Abwehrmechanismen«, wie Jules Masserman sie nennt49) können in der Morgendämmerung des Lebens gefunden werden. Für jeden von uns ist das frühe Leben eine Zeit intensiver Egozentrik. Man ist das Universum: Es gibt keine Grenzen zwischen uns und anderen Objekten und Wesen. Jede unserer Launen wird ohne persönliche Anstrengung befriedigt: Unser Gedanke löst die Tat aus. Man ist durchdrungen von einem Gefühl der Besonderheit, und man greift diesen leicht verfügbaren Glauben als Schild gegen die Todesangst auf.
Der letzte Retter. Hand in Hand mit dieser anthropozentrischen Illusion (und ich verwende das Wort nicht in einem abfälligen Sinn, denn es ist eine weit verbreitete, vielleicht universelle Illusion) geht der Glaube an den letzten Retter. Dieser Glaube hat seine Grundlage auch in der Morgendämmerung des Lebens zur Zeit der Schattengestalten der Eltern, jenen wundersamen Anhängseln des Kindes, die nicht nur mächtige Beweger, sondern auch ewige Diener sind. Der Glaube an den externen Diener wird verstärkt durch die sorgenvolle Aufmerksamkeit der Eltern während der Kleinkind-Zeit und der Kindheit. Von Zeit zu Zeit wagt sich das Kind zu weit heraus, stößt an den grausamen Palisadenzaun der Realität und wird durch riesige mütterliche Flügel gerettet, die es mit körperlicher Wärme umfangen.
Der Glaube an die Besonderheit und den letzten Retter dient der Entwicklung des Kindes sehr: Er ist die unabdingbare Grundlage der Abwehrstrukturen, die der Mensch gegen den Todesschrecken errichtet. Sekundäre Abwehrmechanismen werden darauf errichtet, die beim erwachsenen Patienten oft die ursprünglichen Ur-Abwehrmechanismen sowie die Natur der ursprünglichen Angst verdecken. Diese beiden grundlegenden Abwehrkräfte sind tief verwurzelt (Zeugnis für ihre Dauerhaftigkeit legen die Unsterblichkeitsmythen und der Glaube an einen persönlichen Gott in praktisch jedem größeren Religionssystem ab) und üben bis ins Erwachsensein, wie ich im nächsten Kapitel ausführen werde, einen dauerhaften und mächtigen Einfluss auf die Charakterstruktur und Symptombildung aus.
Es ist wichtig zu unterstreichen, dass der psychodynamische Wert oder Sinn der Religion nicht notwendigerweise die intrinsische Wahrheit religiöser Ansichten umgeht. Oder, wie Viktor Frankl es formuliert: »Um frühreife sexuelle Neugier zu befriedigen, erfinden wir die Geschichte, dass Störche Babys bringen. Aber daraus folgt nicht, dass die Störche nicht existieren!«50
Verleugnung: Der Glaube, dass Kinder nicht sterben. Ein verbreiteter Trost, von dem Kinder bereits sehr früh in ihrem Leben Gebrauch machen, ist der Glaube, dass Kinder gegen den Tod immun sind. Junge Menschen sterben nicht; der Tod trifft nur die Alten, und das Alter ist sehr, sehr weit weg. Einige Beispiele:
S.: (5 Jahre, 2 Monate): Wo ist deine Mami?
Mutter: Im Himmel. Sie starb vor einiger Zeit. Ich glaube, sie war so um die siebzig. S.: Sie muss achtzig oder neunzig gewesen sein. Mutter: Nein, nur siebzig.
S.: Nee, die Menschen leben, bis sie neunundneunzig sind. Wann wirst du sterben? Mutter: Oh, ich weiß nicht, wenn ich um die siebzig oder achtzig oder neunzig bin.
S.: Oh, (Pause) wenn ich groß bin, werde ich mich nicht rasieren, und dann werde ich einen Bart haben, nicht wahr? [In einer vorhergehenden Unterhaltung sagte S., dass er wisse, dass Männer graue Bärte hätten, wenn sie sehr, sehr alt würden. Später wurde klar, dass er auf die Idee kam, das Rasieren sein zu lassen, weil er sich bemühte, den Tod unendlich weit hinauszuschieben!]51
Ruth (4 Jahre, 7 Monate): Wirst du sterben, Vater?
Vater: Ja, aber nicht, bevor ich alt werde.
Ruth: Wirst du alt werden?
Vater: Ja, ja.
Ruth: Werde ich auch alt werden?
Vater: Ja.
Ruth: Ich fürchte mich jeden Tag vor dem Sterben. Ich wünschte, ich würde niemals alt werden, denn dann würde ich niemals sterben, nicht wahr?52
Interviewer: Kann ein Kind sterben?
G.M. (6 Jahre): Nein, Jungen sterben nicht, wenn sie nicht überfahren werden. Wenn sie in ein Krankenhaus gehen, denke ich, kommen sie lebendig wieder heraus.
E.G. (5 Jahre): Ich werde nicht sterben. Wenn du alt bist, dann stirbst du. Ich werde nie sterben. Wenn die Menschen alt werden, sterben sie. [Später sagt er, dass er sterben wird, wenn er sehr, sehr alt sein wird.]53
In der Beantwortung des Geschichten-Vervollständigungs-Tests ziehen es die meisten Kinder vor, lange Zeit Kind zu bleiben, statt schnell erwachsen zu werden. Ein neuneinhalbjähriger Junge äußerte, dass er aufhören wolle zu wachsen, um ein Kind zu bleiben, weil »wenn jemand älter wird, ist weniger Leben in ihm.«54
Der tatsächliche Tod eines Kindes stellt für Kinder natürlich ein ernstes Problem dar, welches sie oft lösen, indem sie eine Unterscheidung zwischen sterben und getötet werden machen. Ein Junge stellte fest, »Jungen sterben nicht, wenn sie nicht erstochen werden oder von einem Auto überfahren werden.« Ein anderes Kind sagte, »Wenn du zehn Jahre alt bist, weiß ich nicht, wie du sterben könntest, wenn dich nicht jemand tötet.«55 Ein anderes (6 Jahre): »Ich werde nicht sterben, aber wenn du in den Regen rausgehst, kannst du sterben.«56 Alle diese Kommentare besänftigen die Angst, indem sie dem Kind versichern, dass der Tod kein unmittelbares oder zumindest kein unvermeidbares Problem ist. Entweder der Tod wird auf das Alter geschoben – eine Zeit jenseits der Vorstellungskraft des Kindes – oder aber er kann durch Zufall eintreten, jedoch nur, wenn man »sehr, sehr« unvorsichtig ist.
Verleugnung: Personifizierung des Todes. Die meisten Kinder zwischen fünf und neun Jahren gehen durch eine Periode, in der sie den Tod anthropomorphisieren. Dem Tod wird Form und Wille gegeben: Er ist der schwarze Mann, der grimmige Sensenmann, ein Skelett, ein Geist, ein Schatten; oder er wird einfach in Zusammenhang mit den Toten gebracht. Zahlreiche Beispiele dazu:
B.G. (4 Jahre, 9 Monate): »Der Tod macht was falsch.«
»Wie macht er was falsch?«
»Ersticht dich mit einem Messer.«
»Was ist Tod?«
»Ein Mann.«
»Was für ein Mann?«
»Ein Todes-Mann.«
»Woher weißt du das?«
»Ich habe ihn gesehen.«
»Wo?«
»Im Gras. Ich hab’ gerade Blumen gepflückt.«
B.M. (6 Jahre, 7 Monate): »Der Tod schleppt die bösen Kinder weg. Er fängt sie und nimmt sie mit.«
»Wie sieht er aus?«
»Weiß wie Schnee. Der Tod ist ganz weiß. Er ist böse. Er mag Kinder nicht.«
»Warum?«
»Weil er böse ist. Der Tod nimmt auch Männer und Frauen mit.«
»Warum?«
»Weil er sie nicht sehen mag.«
»Was ist weiß an ihm?«
»Das Skelett. Das Knochenskelett.«
»Aber ist das in Wirklichkeit auch so, oder sagen sie das nur so?«
»Es ist auch wirklich so. Ich habe einmal darüber geredet, und in der Nacht kam der richtige Tod. Er hat einen Schlüssel für überallhin, so dass er die Tür gut öffnen kann. Er kam herein und wühlte überall herum. Er kam zum Bett heran und fing an, die Bettdecke wegzuziehen. Ich habe mich fest zugedeckt. Er konnte sie nicht wegziehen. Dann ging er wieder.«
P.G. (8 Jahre, 6 Monate): »Der Tod kommt, wenn jemand stirbt, und er kommt mit einer Sense, haut ihn um und nimmt ihn mit. Wenn der Tod weggeht, hinterlässt er Fußabdrücke. Als die Fußabdrücke verschwunden waren, kam er wieder und haute noch mehr Leute um. Und dann wollten sie ihn fangen, und er verschwand.«
B.T. (9 Jahre, 11 Monate): »Der Tod ist ein Skelett. Er ist so stark, dass er ein Schiff umwerfen könnte. Der Tod kann nicht gesehen werden. Der Tod ist in einem Versteck. Er versteckt sich auf einer Insel.«
V.P. (9 Jahre, 11 Monate): »Der Tod ist sehr gefährlich. Du weißt nie, in welcher Minute er dich mit sich fortnehmen wird. Der Tod ist unsichtbar, etwas, das nie jemand je auf der Welt gesehen hat. Aber in der Nacht kommt er zu jedem und trägt sie mit sich weg. Der Tod ist wie ein Skelett. Alle seine Teile sind aus Knochen gemacht. Aber wenn es hell wird, wenn der Morgen kommt, bleibt keine Spur von ihm. So gefährlich ist er, der Tod.«
M.I. (9 Jahre, 9 Monate): »Sie malen den Tod immer mit einem Skelett und einem schwarzen Umhang. In Wirklichkeit kann man ihn nicht sehen. In Wirklichkeit ist er nur eine Art Geist. Er kommt und nimmt die Leute mit. Er kümmert sich nicht drum, ob es ein Bettler ist oder ein König. Wenn er will, lässt er sie sterben.«57
Obwohl diese Feststellungen erschreckend zu sein scheinen, ist der Prozess der Todespersonifizierung ein Mittel, um die Angst zu mildern. Die Vision eines schleichenden Skeletts, das nachts aus der Friedhofserde auftaucht, gibt, so grimmig das auch sein mag, im Gegensatz zur Wahrheit eine Sicherheit. Solange das Kind glaubt, dass der Tod durch eine äußere Kraft oder Gestalt gebracht wird, ist es sicher vor der wirklich schrecklichen Wahrheit, dass der Tod nicht äußerlich ist – dass man von Lebensbeginn an die Sporen seines eigenen Todes in sich trägt. Wenn der Tod außerdem ein empfindungsfähiges Wesen ist, wenn – wie das Kind im letzten Beispiel sagte – die Situation so ist: »wenn er will, lässt er sie sterben«, dann kann der Tod vielleicht dahingehend beeinflusst werden, dass er nicht will. Vielleicht kann der Tod als Knopfmacher, Ibsens Todesmetapher in Peer Gynt, hinausgezögert, besänftigt oder – wer weiß? – sogar ausgetrickst oder vernichtet werden. Indem das Kind den Tod personifiziert, durchläuft es die kulturelle Evolution: Jede primitive Kultur anthropomorphisiert die blinden Kräfte der Natur in dem Bemühen, größere Kontrolle über ihr eigenes Schicksal erfahren zu können.
Koochers Studie (1974) über die Todeseinstellungen amerikanischer Kinder58 erhärtet nicht die Ergebnisse von Nagy (mit ungarischen Kindern) über die Personifizierung des Todes. Vielleicht gibt es bedeutsame kulturelle Unterschiede, aber der Unterschied in der Methodologie der zwei Studien macht einen Vergleich schwierig: In der amerikanischen Untersuchung war das Interview stark strukturiert mit wenig Nachfragen oder Versuchspersonen-Interviewer-Interaktion, während das Interview im ungarischen Projekt weit offener, intensiver und persönlicher war.
Die anthropomorphisierte Furcht vor dem Tod begleitet uns unser ganzes Leben hindurch. Der Mensch ist selten, der nicht auf irgendeiner Bewusstheitsebene weiterhin Angst hat vor Dunkelheit, Dämonen, Geistern oder irgendwelchen Repräsentationen des Übernatürlichen. Sogar ein maßvoller, gut gemachter Film über Übernatürliches oder Geister spricht, wie die Filmemacher sehr wohl wissen, tiefe Saiten bei den Zuschauern an.
Verleugnung: Verspotten des Todes. Das ältere Kind versucht die Todesfurcht zu besänftigen, indem es sich seiner Lebendigkeit versichert. Neun- und Zehnjährige spotten oft über den Tod. Sie machen höhnische Bemerkungen über ihren alten Feind. Eine Sprachstudie von Schulkindern enthüllte viele Todesspötteleien, die ihnen urkomisch erschienen; zum Beispiel:
You gonna be burned or buried.
(Du wirst verbrannt oder begraben werden.)
It’s not the cough that carries you off, it’s the coffin they carry you off in.
(Es ist nicht der Husten, der dich umbringt, sondern es ist der Sarg, in dem sie dich wegbringen.)
Now I lay me down to sleep,
A bag of bananas at my feet.
If I should die before I wake,
You’ll know it was the tummy ache.
(Nun lege ich mich schlafen,
Ein Sack Bananen zu meinen Füßen.
Wenn ich sterben sollte, bevor ich aufwache,
Wirst du wissen, dass es das Bauchweh war.)
The worms crawl in,
The worms crawl out,
You’II hardly know what it’s all about.59 (Die Würmer kriechen rein,
Die Würmer kriechen raus,
Du weißt kaum, warum all das geschieht.)
Viele Kinder, besonders Jungen, lassen sich auf rücksichtslose, tollkühne Kunststücke ein. (Möglicherweise reflektiert einiges des delinquenten Verhaltens von Erwachsenen das Fortbestehen dieser Abwehr gegen die Todesangst.) Junge Mädchen tun das weniger häufig, entweder wegen der Anforderungen an ihre soziale Rolle oder weil, wie Maurer vorschlägt,60 sie von der Todesfurcht aufgrund ihres Wissens um ihre biologische Rolle als Mütter, und das heißt, als Schöpfer, weniger bedrängt sind.
Verleugnung der Todesbewusstheit in der Literatur über Kinderpsychiatrie. Trotz der zwingenden und überzeugenden Argumente und der sie unterstützenden Beweise, dass Kinder den Tod in einem sehr frühen Alter entdecken und durchgängig damit beschäftigt sind, sucht man vergebens nach einer ausgewogenen Berücksichtigung der Todesfurcht in der psychodynamischen Formulierung der Persönlichkeitsentwicklung oder in der Psychopathologie. Warum gibt es eine Diskrepanz zwischen klinischer Beobachtung und dynamischer Theorie? Dazu ist, glaube ich, ein »Wie« und ein »Warum« zu erwägen.
Wie? Ich glaube, dass der Tod aus der psychodynamischen Theorie durch einen simplen Mechanismus ausgeschlossen wird: Der Tod wird übersetzt in »Trennung«, und diese nimmt die Rolle des Todes in der dynamischen Theorie ein. John Bowlby präsentiert in seiner imposanten Arbeit über Trennung61 überzeugende ätiologische, experimentelle und empirische Beweise, die zu umfangreich sind, als dass sie hier genauer erörtert werden könnten; sie weisen darauf hin, dass die Trennung von der Mutter ein katastrophales Ereignis für das Kleinkind ist und dass die Trennungsangst während der Zeit vom sechsten bis zum dreizehnten Monat deutlich erkennbar ist. Bowlby schließt daraus – und diese Schlussfolgerung wird durch die Kliniker weithin akzeptiert –, dass die Trennung die ursprüngliche Erfahrung bei der Entstehung von Angst ist: Trennungsangst ist die grundlegende Angst; und andere Quellen der Angst, einschließlich der Todesangst, erhalten ihre emotionale Bedeutung durch die Gleichgewichtung mit der Trennungsangst. Mit anderen Worten, der Tod ist bedrohlich, weil er die Trennungsangst wieder hervorruft.
Bowlbys Arbeit enthält zum überwiegenden Teil elegante Argumentationen. Jedoch bei der Betrachtung der Todesangst scheint seine Vorstellungskraft seltsam eingeschränkt zu sein. Beispielsweise zitiert er Jersilds Untersuchung, in welcher vierhundert Kinder nach ihren Ängsten gefragt wurden.62 Jersild fand heraus, dass spezifische Ängste vor dem Krankwerden oder dem Sterben auffällig selten waren: Sie wurden durch keines der zweihundert Kinder unter neun Jahren und nur von sechs der zweihundert Kinder von neun bis zwölf Jahren erwähnt. Bowlby schließt aus diesen Daten, dass die Todesfurcht bei Kindern unter zehn Jahren nicht vorhanden ist, dass sie eine spätere und gelernte Angst ist und dass sie wichtig ist, weil sie mit Trennung gleichgesetzt wird.63 Jersilds Untersuchung zeigt, dass das, wovor die Kinder Angst haben, Tiere, Dunkelheit, Höhen sind oder in der Dunkelheit durch solche Geschöpfe wie Geister oder Kindesentführer angegriffen zu werden. Nicht gestellt wird jedoch die offensichtliche Frage: Was ist die Bedeutung für Kinder von Dunkelheit oder Geistern oder wilden Tieren oder in der Dunkelheit angegriffen zu werden? Mit anderen Worten, was ist die darunterliegende Bedeutung, die geistige Repräsentation dieser Ängste?
Rollo May argumentiert in seinem brillanten Buch über die Angst, dass Jersilds Studie lediglich zeigt, dass Angst in Furcht verwandelt wird.64 Die Furcht eines Kindes ist oft unvorhersagbar, verändert sich und hat keinen Bezug zur Realität (das Kind hat zum Beispiel mehr Furcht vor entfernten Tieren wie Gorillas und Löwen als vor vertrauten). Was auf einer oberflächlichen Ebene unvorhersagbar erscheint, so argumentiert May, ist auf einer tieferen Ebene ganz schlüssig: Die Ängste eines Kindes sind »objektivierte Formen von darunterliegender Angst«. May teilt mit, dass »Jersild mir gegenüber in einem persönlichen Gespräch bemerkt hat, dass diese (der Kinder) Ängste wirklich Angst ausdrückten. Er war überrascht, dass er das zuvor nie gesehen hatte. Ich glaube, die Tatsache, dass er das nicht sah, zeigt, wie schwer es ist, aus unseren traditionellen Denkgewohnheiten herauszukommen.«65
Die Verhaltensforschung hat viele Situationen dargestellt, die bei Menschenkindern Furcht auslösen. Die gleiche Frage kann in Bezug auf diese experimentellen Daten gestellt werden. Warum fürchtet sich das Kind vor Fremden oder einer »visuellen Klippe« (einem Glastisch mit etwas, das wie ein Abgrund darunter aussieht) oder vor einem sich nähernden Gegenstand (der plötzlich auftaucht) oder vor Dunkelheit? Offensichtlich stellt jede dieser Situationen – wie auch Tiere, Geister und Trennung – eine Bedrohung für das Überleben dar. Aber mit der Ausnahme von Melanie Klein und D. W. Winnicott, die hervorheben, dass ursprüngliche Angst die Angst vor der Vernichtung, der Ich-Auflösung ist oder davor, verschlungen zu werden,66 wird die Frage, warum sich das Kind vor diesen lebensbedrohenden Situationen fürchtet, selten gestellt. Die Theoretiker der Kindesentwicklung oder Kinder- und Jugendpsychoanalytiker ziehen oft sehr spekulative Schlussfolgerungen über das Innenleben des Kindes, wenn es sich um Objektbeziehungen oder kleinkindliche Sexualität handelt; aber wenn sie den Todesbegriff des Kindes betrachten, setzt ihre Intuition und Vorstellungskraft aus.
Der Beweis für das Vorhandensein der Trennungsangst gründet auf soliden Verhaltensbeobachtungen. Bei der gesamten Spezies der Säugetiere bekundet ein Kind, das von seiner Mutter getrennt wird, Zeichen der Besorgnis – sowohl äußere motorische Zeichen als auch innere physiologische. Es besteht auch kein Zweifel daran, wie Bowlby nachdrücklich zeigt, dass die Trennungsangst früh im Leben des menschlichen Kleinkindes erkennbar ist und dass Sorgen über Trennungen ein Hauptmotiv in der inneren Welt der Erwachsenen bleibt.
Aber was die Verhaltensforschung nicht enthüllen kann, ist die Natur der inneren Erfahrung des jungen Kindes oder, wie Anna Freud es ausdrückte, der »mentalen Repräsentation« der Verhaltensreaktionen.67 Wir können etwas darüber wissen, was die Furchtsamkeit auslöst, aber nicht, was die Furchtsamkeit ist. Die empirische Forschung zeigt, dass das Kind furchtsam ist, wenn es getrennt wird, aber sie zeigt auf keine Art und Weise, dass die Trennungsangst die ursprüngliche Angst ist, von der die Todesangst abgeleitet ist. Auf einer vorgedanklichen und vorsprachlichen Ebene erfährt das Kind vielleicht die urwüchsige Angst des Nicht-Seins; und diese Angst tendiert sowohl beim Kind als auch beim Erwachsenen dazu, zur Furcht zu werden: Sie wird in der einzigen »Sprache«, die dem Kind zur Verfügung steht, gebunden an und transformiert in die Trennungsangst. Die Entwicklungstheoretiker verwerfen die Idee, dass ein Kleinkind – sagen wir jünger als dreizehn Monate – Todesangst erfahren könnte, weil das Kind nur einen geringen Begriff vom Selbst hat, das von den ihn umgebenden Objekten getrennt ist. Aber das gleiche kann über die Trennungsangst gesagt werden. Was ist es, das das Kind erfährt? Sicherlich nicht Trennung, denn ohne ein Selbstkonzept kann das Kind Trennung nicht begreifen. Was ist es dann schließlich, das wovon getrennt wird?
Unserem Wissen über eine innere Erfahrung, die nicht beschrieben werden kann, sind Grenzen gesetzt, und ich laufe in dieser Diskussion Gefahr, die Gedanken des Kindes zu »erwachsenen Gedanken« zu machen. Man muss sich bewusst sein, dass der Begriff »Trennungsangst« eine Konvention ist, ein Begriff, auf den man sich auf der Grundlage empirischer Forschung geeinigt hat und der sich auf einen unaussprechlichen inneren Zustand der Furchtsamkeit bezieht. Aber für den Erwachsenen ergibt es überhaupt keinen Sinn, Todesangst in Trennungsangst zu übersetzen (oder »Furcht vor dem Objektverlust«), oder zu behaupten, dass die Todesangst von einer »grundlegenderen« Trennungsangst abgeleitet ist. Wie ich in dem vorhergehenden Kapitel ausgeführt habe, muss man zwischen zwei Bedeutungen von »grundlegend« unterscheiden: »grundlegend« und »chronologisch zuerst«. Selbst wenn wir die Behauptung akzeptieren, dass Trennungsangst chronologisch die erste Angst ist, würde daraus nicht folgen, dass Todesangst »wirklich« die Furcht vor dem Objektverlust ist. Die grundlegendste Angst entsteht aus der Bedrohung des Selbstverlusts; und wenn man den Objektverlust fürchtet, dann deshalb, weil der Verlust dieses Objekts eine Bedrohung für sein Überleben ist (oder eine solche symbolisiert).
Warum? Das Auslassen der Todesfurcht aus der dynamischen Theorie ist offensichtlich kein Versehen. Es gibt auch, wie wir gesehen haben, keinen überzeugenden Grund, der die Übersetzung dieser Furcht in andere Begriffe rechtfertigt. Ich glaube, dass ein aktiver Verdrängungsprozess wirksam ist – ein Prozess, der von der universellen Tendenz der Menschheit (einschließlich der Verhaltensforscher und Theoretiker), den Tod zu verleugnen, stammt – ihn sowohl persönlich als auch in seiner Lebensarbeit zu verleugnen. Andere, die die Todesfurcht erforscht haben, kamen zu einer ähnlichen Schlussfolgerung. Anthony bemerkt dazu:
Das Unlogische und die offensichtliche Unsensibilität (der Kindesentwicklungsforscher) gegenüber dem Phänomen der Furcht des Menschen vor dem Tod, die von der Anthropologie und Geschichte als eine der verbreitetsten und stärksten menschlichen Motivationen aufgezeigt wurden, kann nur der konventionellen (das heißt kulturell induzierten) Verdrängung dieser Furcht durch die Autoren selbst und jene, über deren Forschungen sie berichten, zugeschrieben werden.68
Charles Wahl kommentiert in einer ähnlichen Richtung:
Es ist eine überraschende und bedeutsame Tatsache, dass das Phänomen der Todesfurcht oder der Angst davor (Thanatophobie, wie sie genannt wird) in der psychiatrischen oder psychoanalytischen Literatur fast nicht beschrieben wird, während sie doch sicherlich keine klinische Seltenheit ist. Sie fällt durch ihre Abwesenheit auf. Könnte dies bedeuten, dass die Psychiater nicht weniger als andere sterbliche Menschen eine Abneigung davor haben, ein Problem zu betrachten oder zu erforschen, das so eng und persönlich bezeichnend für die Kontingenz der menschlichen Situation ist? Vielleicht scheinen sie, ebenso wie ihre Patienten, La Rochefoucaulds Beobachtung bestätigen zu wollen, dass »man nicht direkt sowohl auf die Sonne als auch auf den Mond schauen kann.«69