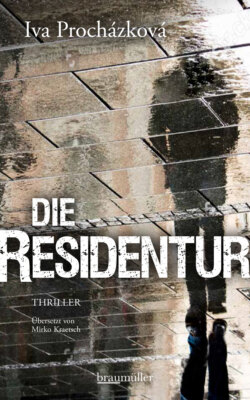Читать книгу Die Residentur - Iva Prochazkova - Страница 11
ОглавлениеVeronika sah Adam sofort, als sie von der Bühne kam. Er stand im Flur zwischen den Schauspielergarderoben und nicht nur in seinem Gesicht, sondern in seiner ganzen Haltung konnte sie das Wort Niederlage lesen. Wäre er zum Casting für einen Loser-Typen gekommen, hätte er die Rolle sofort kriegen müssen. Aber er war nicht zum Vorsprechen da.
„Sag das Erste, was dir einfällt“, forderte er sie ohne Begrüßung auf.
„Kacke am Dampfen.“ Dass er hier war, konnte nichts anderes bedeuten. „Was ist los?“
Sie zog ihn ein Stück weiter, weil in der Pause Hochbetrieb herrschte und sie unnötig Aufmerksamkeit erregten. Angespannt sah sie ihm in die Augen. „Wieso bist du überhaupt hier?“
„Rat mal. Nimm’s als Intelligenztest.“
„Adam, hör auf!“ Manchmal fand sie seine Kommentare ziemlich witzig, aber heute hatte sie nicht den geringsten Sinn für so was. „Du solltest gerade ganz woanders sein! Also, was ist passiert?“
„Nichts. Außer …“ Er verstummte, sein Blick war unruhig wie bei einem Hund, der was angestellt hatte.
„Du hast dir’s anders überlegt.“ Jetzt kapierte sie. Und ihr fiel auf, dass sie kein bisschen überrascht war. Seit dem Moment, als Richard ihr den Plan anvertraut hatte, hatte sie gespürt, dass Adam dabei das schwächste Glied war. „Wann hast du dich umentschieden?“
„Ich bin mit den Jungs nicht mal mit in die Slowakei gefahren.“
„Dann warst du in der Schule? Hast du etwa mit der Formánková geredet?“
„Die hat mich heute Vormittag am Tor abgepasst.“
Das versetzte Veronika in Panik. Früher war sie mal Adams Fast-Mitschülerin gewesen. Bevor sie ans Schauspielkonservatorium gegangen war, hatte sie vier Jahre dasselbe Gymnasium besucht, nur eine Klasse tiefer, und sie hatte die Formánková in Geschichte gehabt. Sie wusste, wie unerbittlich sie sein konnte. Angst hatten sie vor ihr gehabt. Ihren Haarknoten hatten sie Lügendetektor genannt und allzu übertrieben war diese Bezeichnung nicht gewesen.
„Hat sie was aus dir rausgekriegt?“
„Für wen hältst du mich denn?“
„Wenn du das verrätst, dann …“ Ihr schoss durch den Kopf, was das alles bedeuten würde. Das ganze, lange geplante Vorhaben könnte sogar noch scheitern.
„Sie hat mich gefragt, ob ich was von Martin und Richard weiß, und ich hab Nein gesagt. Sie wollte wissen, wo ich sie zuletzt gesehen hab, da hab ich gesagt, am Freitag in der Schule. Sie hat mich gefragt, ob sie sich normal benommen haben, da hab ich Nein gesagt.“
„Nein?“
„Ich hab gesagt, dass sie so durchgeknallt gewesen sind wie immer. Eine andere Antwort wär ihr verdächtig vorgekommen.“
Da musste sie ihm recht geben. Adam war nicht umsonst der Sohn eines Juristen, er hatte das raffinierte Argumentieren in den Genen. „Und dann?“
„Direkt danach hat sich Richards Mutter gemeldet. Dieselben Fragen, dieselben Antworten. Hat sie dich auch angerufen?“
Veronika nickte. Noch jetzt schämte sie sich beim Gedanken an ihr Ausweichmanöver, aber sie hätte nichts anderes tun können. Wenn sie Richards Mutter am Telefon nicht weggedrückt hätte, dann hätte sie sich bestimmt verquatscht, und das durfte sie sich nicht erlauben.
„Adam, wir müssen jetzt da durch! Es ist total wichtig, dass keiner was weiß, bis wir von den Jungs Bescheid kriegen.“ Sie packte ihn an den Schultern und sah ihm mit ihrem Kobrablick in die Augen. Den hatte sie vorm Spiegel geübt und wusste, dass er funktionierte. Er gehörte zu den wichtigen Elementen ihres bisher nicht allzu reichhaltigen schauspielerischen Arsenals. Oft benutzte sie die Kobra auch im Alltag, wenn sie etwas erreichen musste. „Das ist dir doch hoffentlich klar?“
Er wandte den Blick ab.
„Veronika, was denkst du über mich? Aber ehrlich.“
„Ich wusste von Anfang an, dass das nix für dich ist. Du bist … Du hast …“ Sie kam ins Stocken. Sie wollte sein Selbstbewusstsein nicht noch weiter untergraben.
„Die Hosen voll? Deiner Meinung nach hab ich einfach Schiss.“
„Du hast Angst, jemandem wehzutun.“
Sie hatte ihn sichtlich überrascht. Eine Weile schwieg er nachdenklich, dann fragte er: „Und Richard hat keine Angst? Auf bestimmte Weise tut er schließlich auch dir weh, oder?“
„Du kennst doch Richard. Er kann keine Kompromisse machen“, sagte sie und wusste, dass ihr genau diese Eigenschaft an ihm am meisten imponierte, obwohl sie nicht gerade positiv war. Ein Kompromiss war ein Zugeständnis. Und Zugeständnisse zu machen, bedeutete für Richard nicht, jemandem entgegenzukommen, sondern von der Wahrheit abzuweichen. Dazu war er nicht in der Lage. Er hielt die Wahrheit nicht für etwas, wozu man Alternativen schaffen konnte, er behandelte sie als Tatsache. Wer sie abstritt, war seiner Meinung nach entweder ein Lügner oder ein Idiot.
„Auch wenn er wollte, er kann sich nicht anders verhalten“, erläuterte sie. „Eigentlich ist für ihn alles ganz einfach.“
Aus heiterem Himmel tauchte hinter Adams Rücken Richards Mutter auf, sie war durch die Tür aus dem Foyer in den Flur gekommen. Veronika zuckte innerlich zusammen.
„Die Chytilová“, flüsterte sie.
„Wo?“ Adam wollte sich umdrehen, aber Veronika zerrte ihn hastig um die Ecke.
„Verdrück dich, aber hintenrum, damit sie dich nicht sieht.“
Sie brachte ihn an der Maske und am Technikerkabuff vorbei zum Hinterausgang und überlegte dabei, ob sie schnell genug reagiert hatte. Es wäre nicht gut, wenn Alena sie mit Adam zusammen gesehen hätte. Sie würde das in einen Zusammenhang mit Richards Verschwinden bringen und nur umso stärkeren Druck auf Veronika ausüben.
„Komm nicht mehr zu mir“, sagte sie, bevor sie Adam ins Treppenhaus ließ. „Und bis es nicht raus ist, erzähl nirgends was rum.“
„Wann willst du denn die Briefe abschicken?“
„Wenn Richard mir Bescheid gibt.“
„Hat er dich heute nicht angerufen?“
„Nein.“
„Nein?“ Adams Miene verriet Misstrauen.
„Warum soll ich dich anlügen?“
„Weil du mir nicht mehr glaubst.“ Er verzog das Gesicht und fügte selbstgeißlerisch hinzu: „Hast ja recht, Schissern kann man nicht glauben. Wahrscheinlich würde ich das genauso machen, wenn ich an deiner Stelle wäre.“
Veronika schwieg. Er tat ihr leid, aber gleichzeitig konnte sie sich nicht gegen ihren Widerwillen wehren. Ihre innere Kompassnadel navigierte sie seit jeher zu stolzen, selbstbewussten und aufrechten Männern. Sie liebte das Drama, sie liebte das Pathos – im Leben und auf der Bühne. Wenn ihr Vater seine Stimme auf dem Zwerchfell abstützte und „E lucevan le stelle“ sang, lief es ihr kalt den Rücken runter und vor Erregung bohrte sie sich die Fingernägel in die Handflächen. Als Richard am Tag vor seiner Abreise zwei Ringe gekauft hatte, hatten sie sie sich gegenseitig auf den Finger geschoben und anschließend schweigend miteinander geschlafen, das war stärker gewesen als jedes Versprechen, das sie sich hätten geben können. Worte hätten alles nur banalisiert und verwaschen. Ohne hatte Veronika viel genauer gewusst, wie Richard zumute gewesen war. Auch wie Adam jetzt zumute war, konnte sie sich vorstellen. Und wie morgen. Sie wollte nicht in seiner Haut stecken. Er drehte sich um und stieg schweigend die Stufen hinunter.
„Was soll ich mit deinem Brief machen?“, rief sie ihm hinterher.
„Ins Klo schmeißen“, antwortete er, ohne sich umzudrehen.
„Wird erledigt“, sagte sie. „Und du mach lieber krank. Vielleicht lassen sie dich dann in Ruhe.“
Sie schloss die Tür. Die Uhr an der Wand zeigte halb neun. Bis zum Anfang vom dritten Akt waren es noch zehn Minuten. Zu lange, um sich vor Richards Mutter zu verstecken. Auch wenn sie’s geschafft hätte, würde sie nach der Vorstellung draußen auf sie warten, und dort würde ihr Veronika noch schlechter entkommen können. Nein, lieber wollte sie die Unterhaltung jetzt gleich hinter sich bringen.
Ihre Blicke trafen sich, als sie um die nächste Ecke bog.
„Ahoj Alena!“, spielte sie die Überraschte. „Kommst du zu mir?“
Es wurmte sie, dass Richards Mutter nicht dem Klischee der bösen Schwiegermutter entsprach. Dann wäre das Lügen einfacher. Nein, sie war nett und konnte Veronika offensichtlich gut leiden. Vor Kurzem hatten sie sich bei den Chytils in der Küche aufs Du geeinigt. Sie hatten angestoßen, sich ein Küsschen gegeben, ein Gläschen Fernet gekippt (etwas anderes war nicht zur Hand gewesen), Veronika hatte sich dabei verschluckt und ihre Bluse eingesaut. Gemeinsam hatten sie die Flecken im Geschirrspülbecken ausgewaschen und dabei gelacht wie die Verrückten. Jetzt lag in Alenas Gesicht kein Molekül von Lachen. Sie saugte sich mit einem flehentlichen Blick an Veronikas Augen fest.
„Wo ist Richard?“
„Ich weiß es nicht.“
„Habt ihr euch gestritten?“
Veronika schüttelte entschieden den Kopf.
„Getrennt?“
„Nein, alles in Ordnung.“
Alena starrte sie ungläubig an. „In Ordnung?“
„Ich schwör’s. Wir haben uns nicht gestritten und auch nicht getrennt.“
„Erzähl keine Märchen. Wenn zwischen euch alles in Ordnung wär, dann würd er dir doch was sagen. Dann wär er nicht so heimlich verschwunden wie … wie so ’n Halbstarker.“
„Ich verdrück mich auch manchmal für ’ne Weile und sag niemand was. Ist doch ganz normal.“
„Das ist nicht normal, so benimmt man sich nicht zueinander.“ In Alenas Augen glitzerten Tränen. Veronika schaute schnell woandershin. Beim Gedanken daran, was für ein Schock das für sie wäre, wenn die Bombe platzen würde, bekam sie einen flauen Magen. Sie spürte tiefes Mitgefühl. Über das Unglück, das Alena vor Jahren zugestoßen war, wusste sie natürlich Bescheid. Richard sagte, dass er sich kein bisschen an seine Schwester erinnern könne, als sie gestorben war, sei er noch viel zu klein gewesen; aber dass er immer brav sein musste, damit seine Mutter nicht traurig war, das war fest in seinen Erinnerungen verankert. Sein Vater muss es ihm andauernd wieder gesagt haben. Die Vorstellung, wie der kleine Richard sich um jeden Preis bemühte, artig zu sein, während seine Mutter in Verzweiflung versank, deprimierte Veronika.
„Er ist neunzehn“, sagte sie sanft. „Ein Haufen Leute in seinem Alter machen schon längst, was sie wollen. Manche wohnen nicht mal mehr zu Hause.“
„Aber Richard wohnt doch bei uns.“
„Ja, allerdings hat er sein eigenes Leben. Er will sich da nicht reinreden lassen. Er will seine Probleme selber lösen.“
„Probleme? Hat er Probleme?“ Diesmal lag in Alenas Stimme unverhüllte Panik. Sie presste Veronikas Hand so stark, dass sich der Ring von Richard in den Nachbarfinger eingrub. „Egal, was es ist, er muss doch deswegen nicht abhauen!“
„Er ist nicht abgehauen.“ Veronika schaute ihr in die bettelnden Augen und dachte fieberhaft nach, wie viel sie sagen durfte, um sie zu beruhigen, dabei aber keinen Verrat zu begehen, als sie die Durchsage der Inspizientin rettete.
„Das war das zweite Zeichen, die Pause ist zu Ende“, kam es aus dem Lautsprecher über ihren Köpfen. „Fortsetzung der Vorstellung in fünf Minuten.“
„Ich muss mich fertigmachen.“ Veronika ging rückwärts los. Dann machte sie wieder einen Schritt nach vorn und umarmte Richards Mutter ganz fest. Sie hatte das nicht vorgehabt, konnte sich aber der Flut von Emotionen nicht erwehren. Sie durchlebten einen außergewöhnlichen Augenblick, einen Schlüsselmoment ihres Lebens, sie musste ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Es war unmöglich, das nüchtern zu spielen. Alena hatte die breiten Schultern einer Schwimmerin, aber ihre Ohnmacht weckte in Veronika den Beschützerinstinkt.
„Mach dir keine Sorgen“, flüsterte sie ihr ins Ohr. „Er meldet sich.“
„Wann denn?“
„Weiß nicht, bestimmt … bestimmt bald.“ Aus Furcht, noch mehr zu verraten, löste sie die Umarmung und stürzte in ihre Garderobe. Sie schloss die Tür hinter sich und lehnte sich mit dem Rücken dagegen. Dass die Unterhaltung mit Richards Mutter ihr so zu schaffen machen würde, hätte sie nicht gedacht; sie war der Meinung gewesen, gut darauf vorbereitet zu sein. Aber eine Sache war es, die einzelnen Schritte im Voraus zu planen, eine ganz andere Sache, sie auch umzusetzen. Und die Hauptaktion stand ihr erst noch bevor. Für einen Moment bekam sie vor Angst weiche Knie, aber sofort rief sie sich zur Räson. Zur Angst gab es keinen Grund. Sie war mit Richard alles detailliert durchgegangen, auf alle Fragen hatte er ihr eine Antwort gegeben, jede Unsicherheit zerstreut. Er wusste, was er tat und warum er es tat, und Veronika hatte seine Gründe akzeptiert. Nicht ohne anfängliche Einwände, aber er hatte sie überzeugt. Wo Worte nicht ausreichten, hatte er sie durch die Sprache seines Körpers ersetzt. Und durch sein vielsagendes Pfeifen – damit hatte er sie noch jedes Mal rumgekriegt. Ein Rest von Zweifel war trotzdem in ihr zurückgeblieben, und je länger das Schweigen dauerte, desto mehr Raum gewann die Ungewissheit. Richard hätte vor der Vorstellung anrufen sollen, aber das hatte er nicht. Sie hoffte, dass er sich danach melden würde. Wenn nicht, musste irgendwo ein Fehler passiert sein.
Quae bello est habilis, veneri quoque convenit aetas.
(Nur Jugend, die zum Kriege taugt, eignet sich auch zur Liebe.)
Quamlibet extinctos iniuria suscitat ignes.
(Unrecht schürt selbst längst verloschene Flammen.)
Ille movet bella, qui narrat falsa novella.
(Wer falsche Kunde gibt, löst Kriege aus.)
Lateinzitate für die Oberstufe
Richard stieg die steilen Stufen zum Unterdeck hinab und suchte mit den Augen zwischen den geparkten Autos den grauen Opel. Vor Lewan und Martin hatte er so getan, als gehe er nur seine Zigaretten holen, aber in Wirklichkeit wollte er sich überzeugen, dass alles in Ordnung war. Gestohlen wurde überall, zweifellos auch auf Fährschiffen. Die Regina Aquae war außerdem wahrlich kein Schiff der Luxusklasse und tat auch nicht so. Sie gehörte einer Billigfährlinie, der Fahrpreis war bis an die unterste Grenze gedrückt und die Zusammensetzung der Passagiere, die Sicherheitsvorkehrungen und die angebotenen Dienstleistungen waren dementsprechend. „Was zu verzollen?“, plärrte beim Einschiffen ein Mann in verschossener Uniform durch jedes Autofenster. Die Antwort wartete er nicht ab, zeigte nur mit der Hand, wo man hinfahren sollte, und wandte sich schon dem Nächsten zu. „Wir haben’s geschafft. Beim Ausschiffen wird keiner mehr nach irgendwas fragen“, sagte Lewan, der diese Überfahrt nicht zum ersten Mal absolvierte. Auf seine Informationen konnte man sich verlassen und der zeitliche Ablauf war bis jetzt absolut perfekt. Richard verspürte ihm gegenüber immer größeren Respekt – und gleichzeitig Scham. Er schämte sich auch vor Martin. Alle beide hatte er im Unklaren gelassen.
Das Parkdeck war still und nur spärlich beleuchtet. Als er zwischen den Autos durchging, sah er hier und da einen schlafenden Fahrer, in einigen Transportern waren die Vorhänge zugezogen und es drangen Geräusche nach draußen, bei denen er sich ausmalen konnte, was drinnen vor sich ging. Die Fähre war ein Ort reger Geschäfte, sie verschaffte auch Prostituierten regelmäßige Einnahmen. Meist stiegen sie zu den Fahrern in die LKW-Kajüten ein, aber wenn sie sich einen Klienten anlachten, der keine Kajüte hatte, fanden sie eine andere Lösung. Lewan zufolge (der behauptete, das nicht aus persönlicher Erfahrung zu wissen) waren sie in dieser Hinsicht außerordentlich erfindungsreich. Richard hatte zuvor ein paar von ihnen an der Bar sitzen sehen. Die unterschiedlichsten Typen, Nationalitäten und Altersstufen, von ganz jungen Frauen bis hin zu solchen, denen die Regina Aquae offenbar als letzte Karrierestation diente. Eine von ihnen hatte Richard angelächelt, als er an ihr vorbeigekommen war, und ihm von ihrem Barhocker aus fröhlich etwas in einer Sprache zugerufen, die er nicht verstand. Sie hatte ein breites tatarisches Gesicht mit schwarzen Augen und schien den Schelm im Nacken zu haben. In diesem Moment hatte sie ihr Tagespensum hinter irgendwelchen zugezogenen Gardinen wahrscheinlich schon absolviert.
Lewans Opel stand am entgegengesetzten Ende des Parkbereichs. Nach der mehrstündigen Fahrt durch Regen und Schneematsch war er bis ans Dach mit Schlamm bespritzt. Richard schloss auf, beugte sich in den Wagen und ließ seinen Blick durch das Innere gleiten. Alles schien unangetastet zu sein. Er nahm ein Päckchen Zigaretten aus dem Handschuhfach, ging um das Auto herum und öffnete die Heckklappe. Die Decke, mit der sie die Ladung abgedichtet hatten, rutschte ihm auf die Füße und die Lampe, die ihm entgegenkam, fing er im letzten Moment auf, ansonsten waren alle Sachen in Ordnung und an ihrem Platz. Ganz obenauf lag der dunkelgrüne Bodyguard, Martins struppiges Plüschkrokodil, das sie aus Jux mitgenommen hatten, mit seinen phosphoreszierenden Augen überwachte es das Ganze. Richard schob es beiseite und griff zwischen die Isomatten. Er ertastete den Verbandskasten, lüftete den Deckel und schaute hinein. Der Anblick erfüllte ihn mit tiefer Zufriedenheit. Dort waren Dinge, von denen er wusste, dass sie ihm zupasskommen würden und dass er mit ihnen umgehen könnte. Die Expedition nach Kambodscha letztes Jahr hatte ihm nicht nur Inspiration geboten, sondern auch reichlich Praxis.
Er griff nach dem Beutel mit Reis, schnürte ihn auf und steckte die Hand hinein. Eine Weile tastete er mit den Fingern zwischen den Körnern herum, bis er die Pistole gefunden hatte. Er holte sie nicht heraus, es genügte ihm, zu wissen, dass sie da war. Sie war die Quelle seiner Sicherheit und seiner Nervosität. Wenn sie bei der Zollkontrolle gefunden worden wäre, hätte das ihrer ganzen Aktion höchstwahrscheinlich den Todesstoß versetzt.
Er zog die Hand aus dem Reisbeutel und band ihn wieder zu. Vorzumachen brauchte er sich nichts; er hatte sich benommen wie der letzte Trottel. Unbesonnen hatte er gehandelt, nicht alle möglichen Konsequenzen bedacht – sein größter und häufigster Fehler. Den er andauernd wieder machte, und auch die sechsmonatige Ausbildung bei der Patrola hatte ihm nicht geholfen, ihn abzustellen. „Obacht bei Entscheidungen. Du hast die Tendenz, voreilig Schlüsse zu ziehen, manchmal sind das bei dir wirklich Kurzschlusshandlungen. In Krisensituationen kann das nicht nur dich das Leben kosten, sondern auch andere“, hatte Cehlár gesagt, als er ihm das Diplom überreichte. Dabei hatte er ihn durchdringend angesehen, als würde er bis ins Mark seiner Knochen schauen können. Richard würde interessieren, ob er von ihrem Plan etwas ahnte.
Er schloss das Auto ab und machte sich auf den Rückweg. Dabei überlegte er, wann er Martin und Lewan das mit der Pistole sagen sollte und wie sie’s auffassen würden. Martin dürfte eine Grimasse ziehen und die ganze Angelegenheit mit ein paar Sticheleien abtun. Lewans Reaktion war schwer abzuschätzen. Er nahm nichts auf die leichte Schulter. Jeden Schritt durchdachte er weit im Voraus, bis ins kleinste Detail und in vielen Varianten. Mathematiker, Perfektionist, Schachspieler. Dank der Umsicht, die er offenbar in seiner DNA hatte, konnte er Gefahren erfolgreich eingrenzen, verhindern konnte er sie aber nicht. Beweis dafür war eine brutale Prügelattacke vor einem halben Jahr gewesen. Ausfälligkeiten per Telefon oder in den sozialen Netzwerken war Lewan gewohnt. Er kannte die Arbeit von Trollen, kannte auch die hasserfüllten Reaktionen manipulierter Gehirne. Jede Art von Fake News, jede Desinformation war geeignet, seinem Renommee zu schaden. Sie hatten ihn schon lange im Visier. Je mehr er sich engagierte, desto mehr bewarfen sie ihn mit Dreck. Todesdrohungen waren an der Tagesordnung. Trotzdem hatte er nicht damit gerechnet, dass sich mitten im Zentrum von Prag, ein Stück vom Altstädter Ring entfernt, wo es von Polizeistreifen nur so wimmelte, zwei Vermummte auf ihn stürzen, ihm die Brieftasche rauben und ihn so zurichten würden, dass er beinahe hops gegangen wäre. „Das mit der Brieftasche war nur Tarnung“, verkündete er, nachdem die Ärzte ihn halbwegs wieder zusammengeflickt hatten. „Um Geld ist es den Schweinen nicht gegangen. Das sollte eine letzte Warnung für mich sein.“
Wenn wir uns mit der Abreise nicht beeilt hätten, dann hätte Lewan ein ähnliches Ende gefunden wie Geworg, von Schüssen durchlöchert neben Müllcontainern, dachte Richard, während er die Stufen hinaufstieg. Martin fand er auf dem Mitteldeck. Er saß im Speiseraum neben einer jungen Frau in einer Motorrad-Lederjacke.
„Das ist Swetlana aus Kiew“, begrüßte er Richard. „Sie studiert Mikrobiologie, letztes Jahr ist sie über ein Stipendium bei uns in Tschechien gewesen. Sie ist wahnsinnig schlau, du kannst mit ihr in jeder Sprache reden, in der du willst.“
Sein Tonfall legte nahe, dass er und Swetlana sich bereits intensiv angefreundet hatten. Dazu hatten ihm knapp zwanzig Minuten gereicht. Martin hatte irgendwas (Richard wusste nicht, ob es das kommunikative Talent war, der vorlaute Charme oder irgendeine andere, weniger augenfällige Eigenschaft, vielleicht der Geruch seines Schweißes), dem das andere Geschlecht nur schwer widerstehen konnte.
„Freut mich sehr, Swetlana aus Kiew“, sagte Richard auf Tschechisch. „Ich bin Richard aus Prag.“
Sie grinste ihn an.
„Strč prst skrz krk!“, skandierte sie den wohl berühmtesten tschechischen Zungenbrecher vom Finger, der durch den Hals gesteckt wird. Aber noch ehe er ihre Sprachkenntnisse würdigen konnte, presste sie sich – wie um das Gesagte zu unterstreichen – die Hand auf den Mund, sprang auf und rannte aus dem Raum.
„Das ist schon das zweite Mal. Sie verträgt das Geschaukel nicht“, erklärte Martin. „Deswegen hat sie einen flauen Magen.“
„Und warum steigt sie dann auf ein Schiff?“ Richard setzte sich ihm gegenüber.
„Sie hat in Kasmenien eine Großmutter. In Gregoripol. Die will sie auf ihr Motorrad setzen und mit nach Kiew nehmen. Sie hat Angst um sie. Angeblich wird schon in den Bergen hinter der Stadt geschossen. Bloß macht das Motorrad der Großmutter mehr Angst als der Krieg, und Swetlana weiß jetzt nicht, ob sie sie überreden kann.“
„Wenn die Front schon bei Gregoripol ist, dann müssen wir unsere Pläne ändern, oder?“
„Hat Lewan auch gesagt.“
„Wo ist er?“
„Telefonieren … Irgendwo draußen.“
„Ich schau mal nach ihm.“ Richard stand auf. „Bleibst du hier?“
„Glaub schon, Swetlana will mir ihre Schweinchen zeigen.“
Richard hatte das Gefühl, sich verhört zu haben. „Was will sie dir zeigen?“
„Sie sammelt Glücksschweine. Dreihundert hat sie schon. Aus Plüsch, Porzellan, Seife, Marzipan … Eins hat sogar Vitali Klitschko für sie gezeichnet. Sie zeigt mir die Fotos in ihrem Handy.“
„Dreihundert Glücksschweine?“ Richard war immer wieder baff, auf was für Schwachsinn scheinbar rationale Menschen (eine Mikrobiologin!) so abfuhren.
„Na dann wünsch ich gute Unterhaltung.“
„Gib mir mal die Autoschlüssel. Ich will ihr als Revanche meinen Bodyguard zeigen.“
Richard musterte Martins Gesicht, aber das deutete in keinster Weise an, dass er etwas anderes im Sinn hätte, als das Gesagte. Er reichte ihm den Schlüssel.
„Vergiss nicht, wieder abzuschließen“, erinnerte er ihn noch beim Weggehen. „Wir treffen uns dann hier.“
Draußen wehte ein kalter Wind, an Deck waren ein paar vereinzelte Passagiere. Richard ging zwischen ihnen hindurch Richtung Heck. An der Passage von Odessa nach Jeremesch bestand bei Weitem nicht so großes Interesse wie an der in die Gegenrichtung. Heutzutage flohen die Menschen aus Kasmenien; früher fuhren sie dorthin in Urlaub, um die schöne Natur zu erleben, im Hochgebirge wandern zu gehen oder uralte Kulturdenkmäler zu besichtigen. In letzter Zeit war niemand scharf auf dieses Reiseziel. Es war eine Überfahrt gegen den Strom.
Lewan stand an der Reling und telefonierte mit angespannter Miene. Genauso wie damals, als … Richard kam der Samstagmorgen im September plötzlich in allen Details wieder ins Gedächtnis zurück. Er hatte verschlafen und war leicht verspätet an der Sporthalle eingetroffen, wo sie immer Basketball trainieren gingen. Martin, Adam und die anderen waren schon da. Sie standen am Eingang herum und Richard sah ihnen ihre Aufregung an. Lewan drehte sein Handydisplay zu ihm hin. Kasmenischer Journalist Arojan heute Nacht in Prager Außenbezirk erschossen, meldete die Überschrift. Richard blickte in Geworgs markantes Gesicht und in seinem Kopf lief im Verlauf von wenigen Sekunden ihre ganze Freundschaft ab wie ein Film. Vom ersten Zweikampf um den Ball unterm Korb hier in der Halle über die Debatten in der Küche von Lewans Mutter bei frisch gebackenem Chatschapuri oder in Geworgs kleiner Wohnung (die gleichzeitig als Redaktion und Aufnahmestudio diente) bis zu dem Moment, als Richard seinen ersten Text mitbrachte. Er war stilistisch holprig gewesen und unnötig aggressiv, aber Geworg hatte nur gesagt: „Beim nächsten Mal besser formulieren und weniger um dich beißen, du Haifisch“, und dann den Beitrag unverändert auf seinem Portal veröffentlicht. Seit dem Tag hatte Richard ihm unter dem Pseudonym RiShark zig weitere geliefert. Als er an jenem Vormittag vor der Sporthalle die Abbildung von Geworg angesehen hatte, hatte er direkt körperlich gespürt, wie es sein eigenes Leben aus den Angeln hob.
Er ging bis ans Heck der Fähre und griff zum Telefon. Es war Zeit, Veronika anzurufen. Er hatte vorgehabt, ihr schon im Hafen eine Nachricht zu schicken, aber aus Aberglauben hatte er es immer wieder verschoben. Bis wir an Bord sind, bis wir ablegen, bis sicher ist, dass uns nichts mehr aufhalten kann, hatte er sich gesagt. Jetzt, mit Blick auf die dunklen Wassermassen tief unter sich, spürte er diese Sicherheit. Er rauchte fertig, schnippte die Kippe über die Reling, und während das Telefon schon Veronikas Nummer wählte, stieg er die hintere Treppe zum Oberdeck hinauf. Es war leer, hier war der Wind noch stärker als unten.
Veronika ging nach dem ersten Läuten ran. „Und wie steht’s?“, stieß sie hervor.
„Gut steht’s.“ Der Wind pfiff ihm um die Ohren, er konnte sich kaum selber hören. „Wir sind auf der Fähre.“
„Wie war …“ Er konnte sich denken, dass sie nach dem bisherigen Verlauf der Reise fragte.
„Bis jetzt läuft alles glatt. Wie sieht’s bei euch aus?“
„Die Formánková hat Adam in die Mangel genommen. Bis jetzt hat er sich nicht verquatscht – behauptet er zumindest.“
„Und Mama?“ Normalerweise benutzte er diesen Ausdruck sozusagen in Anführungszeichen. Bei „Mama“ musste man ein Auge zudrücken, „Mama“ machte sich übertriebene Sorgen, für „Mama“ war er immer noch ein Küken, über das sie ihre schützenden Flügel ausbreitete. „Mama“, sagte er zu ihr oft mit einer Mischung aus Liebe und Ironie, wenn sie grundlos in Panik verfiel. „Mama, immer schön ruhig bleiben, okay? Einfach mal tief durchatmen.“ Jetzt war von Ironie in seiner Stimme keine Spur mehr. Geblieben war nur die Liebe und das Bedürfnis, das Wort laut auszusprechen.
„Zuerst hat sie mich angerufen und dann ist sie zu mir ins Theater gekommen. Ein bisschen …“ Veronika zögerte.
„Was?“
„Sie war echt runter mit den Nerven.“
„Hat sie geheult?“
„Fast. Sie hat mir erklärt, dass Abhauen zu nichts führt. Ich hab ihr erklärt, dass du nicht abgehauen bist, dass du dir nur über was klar werden willst und dich bei ihr meldest. Machst du das?“
„Mal sehn.“ Sie würde am Telefon weinen und versuchen, ihn zu überreden. Schon von ihren Emojis war ihm ganz blümerant, Tränen und Bitten würde er nicht ertragen. „Ich meld mich bei ihr, wenn wir in Gregoripol sind.“
„Und das ist wann?“
„Nicht so schnell, wie wir dachten.“ Über die sich ausdehnende Frontlinie und über Bombardierungen wollte er mit Veronika nicht reden. Bis jetzt war sie zwar ziemlich cool gewesen, aber er wollte nicht sondieren, wie belastbar die äußere Hülle ihrer Coolness war.
„Und die Briefe“, fragte sie. „Wann soll ich die verteilen?“
„Weiß nicht, das muss ich noch mit den Jungs diskutieren. Ich schick dir ’ne Nachricht.“
„Schick mir ’n Selfie.“
„Nein.“
„Warum denn nicht?“
„Das Thema hatten wir doch schon.“ Die Abmachung war klar und alle hatten eingewilligt: ein Minimum an Telefonaten, keine Videos, keine Fotos. Schon Nikola, ein Basketballkumpel, der in gewisser Weise ihre Vorhut war und ihnen eine Menge wertvolle Tipps gegeben hatte, hatte sie gewarnt, dass man aus unschuldigen Selfies eine ganze Menge Informationen rauslesen konnte, und Informationen konnten missbraucht werden, man musste auf sie aufpassen. Auch mit Nachrichten wäre bald Schluss. Lewans Onkel Erasim hatte sie darauf aufmerksam gemacht, dass bei einigen Einheiten Handys verboten waren und dass in vielen Hochtälern überhaupt kein Empfang war. Davon hatte Richard Veronika nichts erzählt. Er wollte sie nicht unter Stress setzen. Sie stammte aus einer Familie von Theaterleuten, ihr Horizont und ihre Emotionalität waren definiert von den Brettern, die die Welt bedeuteten. Am eigenen Leib hatte sie wenig erfahren, aber sie hatte alles bereits auf der Bühne gesehen. Richard hatte sie unter Verdacht, dass sie sich den Krieg wie eine Inszenierung vorstellte – wem’s nicht gefiele, der könnte sich in der Pause seine Sachen schnappen und nach Hause gehen.
„Fotos sind ein Risiko“, erinnerte er sie.
„Zugvögel auch?“
Ehe er fragen konnte, wie sie das gemeint hatte, meldete sein Handy schon eine neue Nachricht.
„Ich hab das Gefühl, dass sie schon bei dir gelandet ist“, sagte Veronika. „Willst du nicht nachsehen?“
Er sah nach. Und sein Puls beschleunigte sich. Der Anblick der Schwalbe, die sich Veronika auf den Nacken tätowieren lassen hatte, rief die unmittelbare Erinnerung an ihre letzte gemeinsame Nacht hervor. An einige Momente, die für ihn (und er glaubte, dass das auch für sie galt) die Entdeckung neuer Welten bedeutet hatten. Sie waren so fantastisch gewesen, dass er seine bevorstehende Abreise kurz bereut hatte.
„Ist sie eingetrudelt?“
„Sie ist da.“
„Schwalben sind treu, aber eifersüchtig“, ermahnte sie ihn. „Also sei auf der Hut!“
„Du auch“, zickte er zurück. Mit gespieltem Misstrauen fügte er hinzu: „Wo bist du überhaupt, was machst du dort, und wer macht mit?“
Sein Verhör amüsierte sie. „Ich steh vorm Theater an der Haltestelle und wart auf meine Bahn. Außer mir sind ’n paar Touris hier, die starren in ihre Handys und wollen den Weg zum Vyšehrad erklärt haben. Willst du’s ihnen nicht sagen? Dein Englisch ist besser.“
Ihr leicht heiserer Kontra-Alt bescherte Richard eine Gänsehaut. „Die sollen sich in die Siebzehn setzen“, empfahl er. „Take tram number seventeen, das kriegst du auch hin. Ach so, und noch was … Du weißt schon.“
„Was?“
Er berührte den Ring; unbewusst drehte er ihn am Finger einmal herum. „Das weißt du nicht?“
Einen Moment war Ruhe, dann sagte sie: „Ich dich auch.“
An der Grenze zum Flüstern war ihre Stimme ohne Konkurrenz.
„Gute Nacht, meine Liebste“, verabschiedete er sich (Gänsehaut überall) und beendete das Telefonat. Noch ein paar Sekunden hielt er das Handy ans Ohr gepresst, um Zeit zu gewinnen, damit er von der Prager Straßenbahnhaltestelle zurück auf das windige Schiffsdeck umschalten konnte. Dann ging er zu Lewan.
„Wie sieht’s aus?“, fragte er. „Hast du mit deinem Onkel gesprochen?“
„Angeblich kommen wir nicht über die Kural-Talsperre.“
„Wieso?“
„Die wird von Soldaten bewacht.“
„Haben die Angst, dass die jemand in die Luft jagt?“
„Einen Versuch hat’s schon gegeben. Da haben sie lieber die ganze Gegend abgeriegelt.“
„Gibt es einen anderen Weg, wie wir nach Gregoripol kommen?“
„Mein Onkel schlägt vor, dass wir uns gleich, wenn wir von Bord sind, rekrutieren lassen. Direkt in Jeremesch. Das bedeutet …“
„Dass wir mit der Armee weiterfahren“, begriff Richard. „Genial!“
Ihm wurde klar, dass sich die Zeit, die er als Zivilist verbrachte, dadurch erheblich verkürzen würde. Ihm blieben eher Stunden als Tage. Er spürte ein Stechen unter den Rippen. „Genial“, sagte er noch einmal.
Der brutale Überfall auf den Friedensaktivisten Lewan Manusch nach seinem Auftritt bei der Prager Demonstration gegen die weltweite Aufrüstung im letzten Jahr ist bis heute nicht aufgeklärt worden. Das ist nur ein weiterer Fall, der den Unwillen unserer Polizei beweist, sich mit einer Art von Kriminalität zu befassen, deren Opfer Angehörige ethnischer Minderheiten in Tschechien sind. Das augenfälligste Beispiel für diese Einstellung ist der Mord am Journalisten Geworg Arojan, bei dem der Täter nach wie vor nicht ermittelt wurde. Unfähigkeit, Schlamperei oder Absicht?
www.kritische-ansichten.cz
Seine Augen waren müde, obwohl er nicht durch optische Brillengläser schaute. Heute war er nicht Johnny, sondern Jewgeni. Fast den ganzen Tag hatte er am Rechner gesessen – eine bombensichere Methode, sich die Augen zu ruinieren. Jetzt therapierte er sie mit dem Blick auf unbewegliche Objekte. Kilometerweise beige Fliesen, eine Batterie von Kassen, Hunderte Dosen mit Hundefutter, endlose Reihen Tiefkühltruhen.
Er mochte Orte, die nicht schliefen. Manchmal nachts fuhr er in einen Hypermarkt, einfach so, nicht um einzukaufen. Er ging dann immer durch die langen Reihen zwischen den Regalen und dachte über die Menschen nach, denen er hier begegnete. Es waren überraschend viele. Sonderlinge, Workaholics, denen tagsüber keine Zeit zum Einkaufen blieb, Schlaflose, Eigenbrötler. Er überlegte, in welche Kategorie er sich selbst einordnen würde. Ein bisschen in alle. An Insomnie litt er zwar nicht, aber er hatte ein außerordentlich geringes Schlafbedürfnis, einen Teil der Nacht war er regelmäßig auf. Manchmal nutzte er diese Zeit zum Lesen, am liebsten von Lyrik (die Verse von Puschkin verschwanden niemals von seinem Nachttisch), wenn nötig, arbeitete er, ab und an übte er Deutsch, aber meist sortierte er seine Gedanken. Jewgeni schlief nicht, schweifte nur durch die Gedanken wie durch einen Hain … In der Stille der Nacht ließ sich so eine mentale Durchsicht am besten bewerkstelligen. Anschließend kam er sich jedes Mal so vor, als hätte er in sich drin aufgeräumt. Heute Nacht allerdings räumte er nicht auf, heute hatte er zu tun.
Am Ende des Gangs mit den Haushaltwaren blieb er stehen und schickte einen kurzen Blick zur Heimwerkerabteilung. „Sein Mann“ war bereits da. Er stand bei den Bohrmaschinen, eine hielt er in der Hand und betrachtete sie. Es sah so aus, als hätte er tatsächlich Interesse an ihr. Als er die näherkommenden Schritte hörte, schaute er hoch.
„Sieht ganz praktisch aus“, bemerkte er. „Finden Sie nicht?“
„Ehrlich gesagt, verstehe ich nichts von Bohrmaschinen“, antwortete Jewgeni und sah auf den Preis. Er war herabgesetzt, ein auffälliger Schriftzug wies darauf hin, dass das Angebot nur noch bis zum Monatsende galt. „Man müsste mal checken, ob der Rabatt hier auch kein Beschiss ist.“
„Online ist sie zweihundert Kronen billiger.“
„Dann kaufen Sie sie doch online.“
„Ich brauch sie aber nicht.“
Er legte die Bohrmaschine zurück ins Regal und schaute wieder hoch.
„Jewgeni, wie geht’s Ihnen?“
„Ach, Ludvík, ich kann mich nicht beklagen. Und Ihnen?“
Beide wussten sie, dass die Namen, mit denen sie sich ansprachen, nicht ihre richtigen waren, aber sie hatten sich daran gewöhnt; sie verwendeten sie ganz normal und ohne jede Spur von Verlegenheit, wenn sie sich unterhielten. Jemanden mit Namen anzusprechen, hatte eine wichtige Funktion: Es erleichterte nicht nur den Kontakt, sondern es stärkte das gegenseitige Vertrauen.
„Mir geht’s entsprechend meinen Leistungen und Verdiensten ganz gut“, erwiderte Ludvík in seiner trockenen Art, mit der er alles und jeden kommentierte, sich selbst nicht ausgenommen. Zu Beginn ihrer Zusammenarbeit, als sie sich ein wenig angetestet hatten, war Jewgeni das unangenehm gewesen, aber mit der Zeit hatte ihn Ludvíks reservierter Stil immer weniger gestört, er hatte ihn sogar schätzen gelernt. „Was sagen Sie zu unserem neuen Ermittlerteam?“
„Jukl scheint fähig zu sein“, antwortete Jewgeni. „Meinen Informationen nach hat er, als er beim BIS war, Leute aus dem Russischen Kulturzentrum und aus der Geschäftswelt auf dem Schirm gehabt. Zwei sind damals wegen Spionage aus Tschechien ausgebürgert worden.“
Ludvík verzog das Gesicht. „Ein ITler.“ Sein Tonfall verriet, was er von dieser Sorte Menschen hielt.
„Der hat seine Finger in der Katalogisierung von kremlfreundlichen Websites.“
„In einem Mordfall ermitteln ist was andres, als Propaganda im Internet aufdecken.“
„Darf ich das so verstehen, dass uns sein Einstieg in die Ermittlungen keine Sorgen bereiten muss?“
„Da braucht man sich nichts vormachen, ohne Jukl wär’s natürlich besser, aber die haben ihn vom organisierten Verbrechen rübergeschickt. Keine Chance, dagegen was zu tun.“
„Was ist mit der Rieger-Affäre?“, fragte Jewgeni. Die Enthüllung dieses Korruptionsskandals interessierte ihn, denn darin lag der Schlüssel zu Jukl und seinen Methoden. „Kriegt der Herr Hejtman ordentlich was aufgebrummt?“
„Da saßen noch paar andere mit im Boot, die werden schon zusehen, dass der Rieger sie nicht mit in die Tiefe reißt. Ein paar Firmen, die zum Konzern von unserem Regierungschef gehören, haben mit Riegers Aufträgen Milliarden zusammengerafft. Jetzt hat der Premier natürlich das größte Interesse zu beweisen, dass das alles sauberes Geld war. Er wird tun, was er kann, damit er den Rieger da raushaut. Und er kann ’ne Menge, das braucht man ja wohl nicht extra betonen.“
„Also hat Jukl seine Zähne ganz umsonst eingebüßt? Und seine so mühsam beschafften Beweise befördern Rieger nicht in den Knast?“
„Mühsam beschaffte Beweise?“ Über Ludvíks Gesicht huschte ein amüsiertes Lächeln. „An die ist er durchs Bett von Madame Riegrová rangekommen. Besonders geschuftet haben wird der nicht.“
Die beiden gingen nicht dicht nebeneinander her, aber auch nicht in allzu großem Abstand, damit sie nicht unnötig laut sprechen mussten. Sie verließen den Gang mit dem Werkzeug und betraten die Lebensmittelabteilung: zwei Kunden, deren Wege sich zufällig gekreuzt hatten und die demnächst wieder unterschiedliche Richtungen einschlagen würden.
„Kriminalhauptkommissarin Alte“, kam Jewgeni auf ihr ursprüngliches Thema zurück. „Wer ist das? Zu der hab ich nirgends was gefunden.“
„Die hat noch nie was Größeres als ‚Hausschlachtungen‘ gemacht.“
„Und wird sie jetzt loslegen?“
„Sie hat keine Anhaltspunkte.“
„Haben wir was, das wir gegen sie verwenden könnten?“
„Sie hatte ’ne geheime Affäre mit ’nem verheirateten Mann, angeblich soll sogar ein Kind unterwegs gewesen sein, aber das ist schief gegangen, der brave Gemahl ist zurück an den heimischen Herd und von dem Kind keine Spur. Gerade ist sie, glaub ich, Single. Sieht so aus, als ob sie ihre ganze Energie in die Arbeit steckt. Aber mit der Geschichte jetzt kommt sie garantiert nicht zurande. Der Arojan-Fall ist gleich mehrere Nummern größer als alles, was sie jemals gemacht hat.“
„Also kein Grund zur Beunruhigung?“
„Ich red noch mal mit ihr und mit Jukl.“ Ludvík war bei den italienischen Spezialitäten stehengeblieben. Er nahm eine Dose Dorschleber aus dem Regal. „Die mag meine Frau so gern“, sagte er. Jewgeni schnappte sich eine Packung Nudeln und ein Glas Oliven. Beides legte er in seinen Wagen und ging in Richtung Kasse. Wie üblich bemühte er sich, das Treffen nicht in die Länge zu ziehen. Alles Nötige hatten sie besprochen. Über manche Dinge hatte er mit Ludvík absichtlich nicht geredet, nach anderen hatte er nicht gefragt, weil er dazu Informationen aus anderen Quellen hatte. Blieb nur noch ein Punkt.
„Und die Vergütung ist in Ordnung?“, fragte er.
„Mehr als das“, antwortete Ludvík.
Jewgeni lächelte. „Jedem nach seinen Leistungen und Verdiensten“, griff er Ludvíks Ausspruch auf und fügte ernst hinzu: „Ich bedanke mich für die fruchtbare Zusammenarbeit.“
Ludvík überholte ihn, am Ende des Gangs blieb er stehen und sah sich um. „Ich hab zu danken“, sagte er. Es klang wie üblich trocken, aber der Gesichtsausdruck, mit dem er seine Worte begleitete, war diesmal kein bisschen reserviert.
„Also, Ludvík, machen Sie’s gut.“ Jewgeni hob zum Abschied die Hand.
„Sie auch.“
Ihre Wege trennten sich. Ludvík bog in den nächsten Gang ein, Jewgeni ging zur Kasse. Als er bezahlt hatte und gerade hinausgehen wollte, sah er, wie Ludvík in der Textilabteilung stand und einen Morgenmantel anprobierte. Auch von Weitem sah man, dass er die richtige Wahl getroffen hatte. Unauffälliges Kakaobraun stand ihm gut.