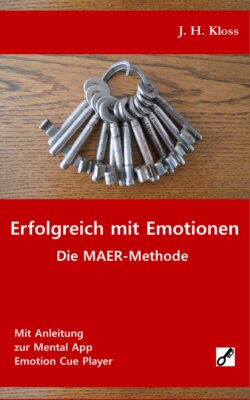Читать книгу Erfolgreich mit Emotionen - J. H. Kloss - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. MAER: Methodik und Begriffe
ОглавлениеDer AER-Ansatz macht sich die Erkenntnisse und Gemeinsamkeiten aus den oben genannten, exemplarischen Einsatzgebieten zu Nutze. In den beschriebenen Fällen, in denen wir von unseren Emotionen profitieren, sind diese mit positiven Erlebnissen aus unserer Vergangenheit verknüpft. Der Abruf dieser Erinnerungen ruft in uns ähnliche positive Emotionen hervor, wie in der ursprünglich erlebten Situation, die diesen Erinnerungen zugrunde liegt. Damit wir uns an ein Erlebnis erinnern und damit Zugang zu der damit verknüpften Emotion erhalten, benötigen wir den passenden Schlüssel, wie beispielsweise ein Musikstück aus dieser Zeit.
Mit der abgeleiteten Methode des Media-supported Active Emotion Retrievals (MAER) werden diese Zusammenhänge zu einer praktisch anwendbaren Methodik kombiniert, die den Anwendern einen systematischen, zielgerichteten und vorteilhaften Zugriff und Umgang mit ihren eigenen Emotionen ermöglicht.
2.1 Active
Der Abruf der Erinnerungen an positive Erlebnisse aus der Vergangenheit ist beim MAER ein aktiver Prozess. Erinnerungen und folglich die entsprechenden Emotionen entstehen nicht zufällig, spontan oder unbewusst, sondern sind das Ergebnis einer bewussten Auswahl, also willentlichen Selektion, die Sie selbst treffen. Damit können Sie einerseits den Einfluss von negativen Emotionen reduzieren, indem Sie diesen ganz bewusst positive entgegensetzen. Andererseits bringen Sie sich selbst durch die aktive Auswahl positiver Emotionen in die ‚richtige Stimmung‘, die Ihnen in der aktuellen Situation und bei der Bewältigung einer anstehenden Herausforderung zuträglich ist.
2.2 Emotion
Auch wenn sich sicher jeder etwas unter dem Begriff „Emotion“ vorstellen kann, so spiegelt sich die landläufige Weisheit „ein Gefühl lässt sich schwer in Worte fassen“ durchaus auch in den Ansätzen wissenschaftlicher Definitionen wider. Einen Auszug aus den Ergebnissen der zahlreichen Studien zur Emotionsforschung in den verschiedenen psychologischen Teildisziplinen liefert z.B. Wikipedia:
„Emotion bezeichnet eine Gemütsbewegung im Sinne eines Affektes. Sie ist ein psychophysiologisches, auch psychisches Phänomen, das durch die bewusste oder unbewusste Wahrnehmung eines Ereignisses oder einer Situation ausgelöst wird. Das Wahrnehmen geht einher mit physiologischen Veränderungen, spezifischen Kognitionen, subjektivem Gefühlserleben und reaktivem Sozialverhalten. […] Der Lebenszyklus einer Emotion unterteilt sich in sensorische, kognitive, physiologische, motivationale und expressive Komponenten“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Emotion, 23.11.14)
2.2.1 Komponenten
Entscheidend für den Effekt der MAER-Methodik sind die Komponenten des angesprochenen Lebenszyklus einer Emotion. Jede Emotion ist demnach mit mindestens einem sensorischen Reiz verbunden, also etwas, das wir im Zusammenhang mit dem erlebten Ereignis gesehen, gehört oder auch gerochen haben. Bei der kognitiven Verarbeitung, also der Wahrnehmung, dem subjektiven Erkennen, Interpretieren und geistigen Abspeichern des Ereignisses als Erinnerung, werden auch die sensorischen Reize mitgespeichert.
Die subjektive Interpretation des Ereignisses führt zur Erregung bestimmter Hirnregionen (v.a. des limbischen Systems und der Amygdala) sowie Ausschüttung entsprechender Neurotransmitter bzw. Hormone und löst dabei mehr oder weniger spürbare physiologische, also körperliche Reaktionen, wie beispielsweise Herzklopfen bei Freude, Gänsehaut bei Erregung, Tränen bei Rührung, oder Schwitzen bei Aufregung aus. In diesen Reaktionen zeigt sich der Kern der empfundenen Emotion.
Hinzu kommt die größtenteils unbewusste, triebgesteuerte Motivation zu einer Handlungsreaktion als Folge der Interpretation des Ereignisses, wie beispielsweise Flucht- oder Angriffsverhalten als Folge der Emotion Angst. Diese wird begleitet von unwillkürlichen, expressiven Verhaltensweisen, also beispielsweise nonverbalen Ausdrucksformen wie Mimik oder Gestik. Als Teil der nonverbalen Kommunikation führen diese Ausdrucksformen bei den beobachtenden Menschen (Empfänger) in der Regel zu Reaktionen, die die auslösende Emotion (beim Sender) eventuell noch verstärken können.
Anhand der Komponenten einer Emotion wird deutlich, dass es sich dabei keineswegs um ein rein mentales, psychologisches Phänomen handelt, sondern diese mit teilweise deutlichen körperlichen Reaktionen und Auswirkungen auf unser Sozialverhalten einhergeht. Umso wichtiger, dass wir lernen, mit der Kraft unserer Emotionen umzugehen und diese zu unserem Vorteil zu nutzen.
2.2.2 Emotionen und Stimmungen
In der Fachliteratur wird bisweilen zwischen Emotion und Stimmung (engl. mood) unterschieden. Dabei unterscheidet sich die Stimmung von der Emotion vor allem dadurch, dass erstere über einen längeren Zeitraum andauert, wie beispielsweise das Hochgefühl in einem Urlaub. Oftmals geht das Phänomen der Emotion mit dem der Stimmung jedoch einher, ineinander über oder verstärkt sich wechselseitig. Die MAER-Methode unterscheidet nicht zwischen den beiden Phänomen, sondern macht sich beide gleichermaßen zunutze.
2.3 Retrieval
Sucht man nach der Definition des Begriffs „Retrieval“ (engl. für Abruf) wird man sowohl im Bereich Psychologie als auch Informatik fündig. In beiden Disziplinen ist dabei oft vom Information Retrieval die Rede, also dem Abruf gespeicherter Informationen. In der Informatik werden Informationen von einem Computer, Server oder Speichermedium abgerufen, in der Psychologie aus dem Gehirn bzw. dem Gedächtnis.
Die Analogie zwischen diesen beiden Disziplinen und deren Terminologie lässt sich fortsetzen. Um Informationen aus einer Datenbank oder dem Internet bzw. Web abzurufen, geben die Nutzer Suchbegriffe in Suchmaschinen wie Google oder Bing ein. Die Suchmaschine liefert dann aus der riesigen Menge vorhandener Informationen die passenden Informationen, Webseiten oder auch multimediale Daten wie Videos zurück, die im Browser angezeigt bzw. abgespielt werden. Alle Informationen und Daten, die im Web vorhanden sind, wurden zuvor von jemandem auf den Servern gespeichert, programmiert oder in kompatible Multimedia-Formate (JPG, WAV, MP3 etc.) konvertiert.
2.3.1 Phasen der Informationsverarbeitung
Analog hierzu werden in der Kognitiven Psychologie, also der Psychologie der Wahrnehmung, Erkenntnis- und Wissensverarbeitung, im Wesentlichen drei Phasen bei der menschlichen Informationsverarbeitung unterschieden: die Enkodierung (engl. encoding), Speicherung (engl. storing) und der Abruf (engl. retrieval).
Bei der Enkodierung von Informationen, die wir Menschen über unsere Sinnesorgane (Auge, Ohren, Nase etc.) wahrnehmen, werden diese in ein internes mentales Repräsentationsformat umgewandelt, das neben der interpretierten Bedeutung auch die relevanten, unmittelbar wahrgenommenen Sinneseindrücke (visuell, akustisch, olfaktorisch etc.) sowie die dabei empfundenen Emotionen umfasst. Diese Repräsentationen sind in der Regel kein 1-zu-1-Abbild der Realität, sondern das Ergebnis subjektiver Interpretation der situativ wahrgenommenen Information.
Die Informationen bzw. deren Repräsentationen werden vorübergehend im Kurzzeit- und schließlich dauerhaft im Langzeitgedächtnis gespeichert. Einige Theorien gehen davon aus, dass die einmal im Langzeitgedächtnis gespeicherte Informationen niemals vergessen, sondern lediglich nicht mehr gefunden werden.
2.3.2 Retrieval Cues
Der Abruf bzw. das Retrieval der im Langzeitgedächtnis gespeicherten Repräsentationen erfolgt über die passenden Informationselemente bzw. Schlüssel (analog zu den Suchbegriffen in der Suchmaschine), den sogenannten Retrieval Cues. In vielen Fällen erweisen sich dabei die sensorischen Elemente der Repräsentationen als besonders effiziente Schlüssel, die eine höhere Erfolgsquote als die interpretierten bzw. semantischen Schlüssel versprechen. Dies liegt u.a. daran, dass die sensorischen Informationen vergleichsweise unverfälscht gespeichert bzw. repräsentiert werden, deren Abgleich mit einem sensorischen Schlüssel also mit weit weniger Interpretationsaufwand und -unschärfe erfolgen kann.
Darüber hinaus werden autobiografische Informationen, also solche mit persönlichem emotionalen Bezug, in der Regel besser erinnert, als neutrale Sachinformationen. So können wir tendenziell eine Liste mit Zahlen schlechter erinnern, als eine Wortliste aus Substantiven, oder aber eine Liste der Möbel in den Räumen unserer Wohnung. Diese Tendenz machen sich Gedächtniskünstler beim Lernen langer Zahlen- oder Begriffslisten zu Nutze, in dem sie diese mental, also vor ihrem inneren Auge, als konkrete Gegenstände visualisieren und in den Räumen ihrer Wohnung platzieren. Bei der Wiedergabe der Listen in der korrekten Reihenfolge ‚gehen‘ die Gehirnakrobaten dann im Geiste durch ihre Wohnung und nennen einfach die Gegenstände, die sie ‚sehen‘.
2.3.3 Reaktivierung und Rekonstruktion
In weiteren psychologischen Theorien werden beim Retrieval bzw. Erinnern zusätzliche Teilphasen unterschieden: Zugriff (access), Auswahl (selection) und Reaktivierung (reactivation) bzw. Rekonstruktion (reconstruction) der gespeicherten internen Repräsentationen. Besonders die Reaktivierung und die teilweise erneut subjektiv und situativ geprägte Rekonstruktion der vergangenen Situation kann zu den gleichen neuronalen Erregungsmustern im Gehirn führen, wie in der ursprünglichen Situation selbst, so dass der erinnernde Mensch die damalige Situation quasi erneut durchlebt, mitsamt den Emotionen und deren Komponenten, wie den oben beschriebenen körperlichen und sozialen Reaktionen.
Zur Vertiefung der Ansätze und Theorien rund um das Thema Emotionales Gedächtnis sei der Überblicksartikel „Retrieval of Emotional Memories“ von Tony W. Buchanan empfohlen (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2265099, 23.11.14). Der Schwerpunkt liegt dabei jedoch auf der Erforschung des Einflusses von Emotionen auf den Prozess der Enkodierung und des Retrievals. Bei der MAER-Methode steht dagegen der Abruf bzw. das erneute Erleben der mit den Informationsrepräsentationen enkodierten und gespeicherten Emotionen über sensorische bzw. modale Retrieval Cues im Vordergrund.
2.4 “M” wie …
Bei der Erläuterung des vorangestellten Buchstaben “M”, der aus dem theoretischen AER-Ansatz die praktisch umsetzbare MAER-Methode macht, bildet der gewählte Begriff “Medien-gestützt” (media-supported) einen Mittelweg, die Methodik angemessen einzugrenzen und zugleich flexibel zu halten.
2.4.1 Multimodal
Die vom Menschen wahrgenommen sensorischen Ereignisse, die den Auftakt im Lebenszyklus einer Emotion bilden, werden über verschiedene Sinnesorgane erfasst, als sogenannte Sinnesmodalitäten. Klassischerweise werden fünf Sinne, Sinnesmodalitäten und -organe unterschieden:
Hören (auditiv): Ohren
Sehen (visuell): Augen
Fühlen (haptisch): Haut
Riechen (olfaktorisch): Nase
Schmecken (gustatorisch): Zunge
Die moderne Wahrnehmungspsychologie und –physiologie differenziert die Sinnesmodalitäten weiter. So wird z.B. bei der haptischen Wahrnehmung als Tastsinn im Allgemeinen zwischen den äußeren taktilen Wahrnehmungen für Berührung, Druck, Temperatur und Schmerz v.a. über die Haut sowie den inneren propriozeptorischen Wahrnehmungen für Körperlage, Kraft und Bewegung v.a. über Muskeln und Gelenke unterschieden. Dem Gehörsinn wird zudem der Gleichgewichtssinn zugeordnet, aufgrund der Lage des Gleichgewichtsorgans (Vestibularapparat) im Innenohr (http://de.wikipedia.org/wiki/Wahrnehmung, 06.12.14).
Die Wahrnehmung eines Ereignisses erfolgt in der Regel nicht nur über ein einzelnes Sinnesorgan, sondern über mehrere zugleich, ist also multimodal. Entsprechend erfolgt auch das Abspeichern der inneren Repräsentation des Ereignisses im Langzeitgedächtnis in der Regel multimodal. Denken Sie beispielsweise an Ihren ersten Sprung vom Fünfmeterturm im Schwimmbad, die Offroad-Fahrt oder das Kitesurfing im letzten Sommerurlaub. Eventuell ‚hören‘ Sie noch das Rauschen des Windes und ‚spüren‘ die enorme Beschleunigung? Vielleicht haben auch gerade diese Sinneseindrücke das vergangene autobiografische Erlebnis und die damit verbundene Emotion ausgemacht?
Die modalen Eigenschaften bzw. Elemente der im Langzeitgedächtnis gespeicherten Repräsentationen eines vergangenen autobiografischen Erlebnisses bilden starke und effiziente Retrieval Cues zum Abruf der Erinnerungen und der damit verbundenen Emotionen. Nicht umsonst setzen moderne Warenhäuser im Rahmen ihrer Verkaufspsychologie gezielt Gerüche, Verkostungen und Produktmuster ein, um Assoziationen und Stimmungen beim Kunden hervorzurufen, die zum Kaufen anregen sollen.
2.4.2 Multimedial
Um die im Langzeitgedächtnis gespeicherten Repräsentationen vergangener Erlebnisse anhand ihrer multimodalen sensorischen Schlüssel abzurufen, können die auslösenden physikalischen Situationen bzw. Stimulationen entweder aufwendig nachgestellt oder aber mit Hilfe entsprechender Medien reproduziert bzw. simuliert werden. Je nach modalem Sinnesreiz kann der Aufwand hierfür extrem variieren. So ist es wesentlich aufwendiger, z.B. an einem trüben Herbsttag die Erinnerung an den Surf-Kurs im letzten Sommerurlaub anhand eines Indoor-Wellenbads physikalisch nachzubauen, als einfach den Sommerhit aus diesem Urlaub einzuspielen. Auch die Simulation der Wellenbewegungen durch hydraulische Apparate, des salzigen Geschmacks oder des Geruchs des Meerwassers durch abenteuerliche Stimulatoren erscheint ungleich aufwendiger, wenn nicht gar unmöglich.
Auch wenn es mit dem Informatikbereich der Virtuellen Realität und Simulatoren erfolgreiche und aufwendige Ansätze gibt, die multimodalen Reize Sehen, Hören, Fühlen - und in experimentellen Systemen auch Riechen und Schmecken - digital ganzheitlich zu simulieren, so beschränken sich die gängigen Multimedia-Systeme in der Regel auf das Hören und Sehen. Der Aufwand zur Anregung der auditiven und visuellen Sinne durch elektronische Medien ist dabei vergleichsweise gering und hat sich mit der Einführung multimediafähiger Smartphones mittlerweile auf ein Minimum reduziert. Praktisch überall und jederzeit steht uns mit dem Smartphone und dessen Musik-, Foto- und Video-Player ein Simulator auditiver und visueller Retrieval Cues zur Verfügung.
2.4.3 Musik
Wie das oben genannte Beispiel des Abrufs positiver Emotionen durch Erinnerung an den Surf-Kurs im letzten Urlaub anhand des Sommerhits zeigt, ist Musik ein einfacher, effektiver und mächtiger Schlüssel zu Ihren Erinnerungen. Wenn auch nur indirekt mit dem eigentlichen Ereignis verknüpft (im Gegensatz zur direkten Verknüpfung des auditiven Wasserrauschens), erscheint die Verbindung zu den ebenfalls in der Ereignisrepräsentation verankerten Emotionen näher und unmittelbarer.
Dies liegt wohl vor allem an dem, was Musik von einer simplen Aufeinanderfolge auditiver Sinnesreize unterscheidet und zu weit mehr als der Summe ihrer Einzeltöne macht. Die Komposition von Musik ist bereits ein emotionaler Akt und findet den unmittelbaren Zugang zu den Emotionen der Zuhörer ohne aufwendige kognitive Transferleistungen. Die Musik kann somit - losgelöst von weiteren äußeren Reizen und Ereignissen - eigenständig Emotionen hervorrufen, mit allen oben beschriebenen physiologischen Begleiterscheinungen. Damit kann Musik selbst zu einem emotionalen Erlebnis werden, an das wir uns erinnern und das wir abrufen können.
Musik scheint in vielerlei Hinsicht prädestiniert als Retrieval Cue für Emotionen zu sein. Dies wird auch im Zusammenspiel mit einem weiteren Medium deutlich, dem Spielfilm. Obwohl dieser primär ein visuelles Ereignis zu sein scheint, funktioniert ein Film ohne auditive Reize nur sehr bedingt. So ist der Ton einerseits für das inhaltliche Verständnis der Dialoge und die akustische Kulisse relevant, aber ohne passende Filmmusik wird die Dramaturgie zu einer eher intellektuellen Interpretation. Mit der Filmmusik werden Gefühle der Zuschauer gesteuert, werden Spannung, Begeisterung und Tragik erzeugt. Die Relevanz der Musik für das Filmerlebnis können Sie leicht ausprobieren: schalten Sie bei einem Drama oder einem Horrorfilm einfach mal den Ton aus. Nicht zu vergessen, dass der Stummfilm ausschließlich von Musik begleitet wurde und ebenfalls seine Zuschauer fand.