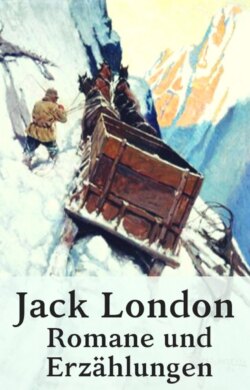Читать книгу Jack London - Romane und Erzählungen - Jack London - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zweiter Teil
ОглавлениеDer Rest des Tages verging, ohne daß sich etwas ereignet hätte. Der frische Wind mit seinen Regenschauern legte sich. Der vierte Maschinist und die drei Heizer wurden nach einer heftigen Auseinandersetzung mit Wolf Larsen neu eingekleidet, erhielten ihre Plätze unter den Jägern in verschiedenen Booten und in den Schiffswachen angewiesen und wurden dann in die Back geschickt. Sie wagten nicht zu protestieren. Was sie von Wolf Larsen gesehen, hatte sie eingeschüchtert, und was sie in der Back über ihn hörten, benahm ihnen die letzte Lust zur Auflehnung. Miß Brewster – ich hatte ihren Namen von dem Maschinisten erfahren – schlief immer noch. Beim Abendbrot bat ich die Jäger, leiser zu sprechen, um sie nicht zu stören, und erst am nächsten Morgen kam sie zum Vorschein. Ich hatte ihr das Essen gesondert bringen lassen wollen. Aber Wolf Larsen durchkreuzte meine Absicht. Wer sie wäre, daß sie zu gut für den Kajütstisch und die Kajütsgesellschaft sei, hatte er gefragt.
Aber ihr Erscheinen bei Tisch hatte eine seltsame Wirkung. Die Jäger wurden stumm wie die Fische. Nur Jock Horner und Smoke ließen sich nicht einschüchtern, warfen verstohlene Blicke auf sie und beteiligten sich selbst an der Unterhaltung. Die vier anderen hoben nicht die Augen von ihren Tellern, sie kauten unaufhörlich mit nachdenklicher Gründlichkeit, und ihre Ohren bewegten sich im Takt mit ihren Kinnladen wie bei fressenden Tieren.
Auch Wolf Larsen sagte anfangs nicht viel; er antwortete nur, wenn man sich an ihn wandte. Nicht etwa, daß er verlegen gewesen wäre. Weit entfernt! Diese Frau war für ihn nur ein neuer Typ, völlig verschieden von dem Schlage, den er bisher kennengelernt hatte, und er war neugierig. Er studierte sie, seine Augen ließen kaum von ihrem Gesicht, es geschah denn, um die Bewegungen ihrer Hände und Schultern zu beobachten. Ich selbst studierte sie ebenfalls, und obwohl ich die Kosten der Unterhaltung trug, war ich doch ein wenig schüchtern. Er hingegen war die Ruhe, das unerschütterliche Selbstvertrauen selber; er fürchtete eine Frau nicht mehr als Sturm und Kampf.
»Und wann sind wir in Yokohama?« wandte sie sich an ihn und blickte ihm gerade in die Augen.
Das war die klare Frage. Die Kinnladen hörten zu arbeiten auf, die Ohren bewegten sich nicht mehr, und wenn auch die Augen weiter auf den Tellern haften blieben, lauschte doch jeder begierig auf die Antwort. »In vier Monaten, vielleicht auch in dreien, wenn die Jagdzeit früh vorüber ist«, sagte Wolf Larsen.
Sie schnappte nach Luft und stammelte: »Ich – ich dachte – man ließ mich in dem Glauben, daß Yokohama nur eine Tagereise entfernt sei. Das ...« Sie machte eine Pause und blickte von einem auf das andere dieser unsympathischen Gesichter im Kreise, die fest auf ihre Teller starrten. »Das kann nicht richtig sein«, schloß sie.
»Das ist eine Frage, die Sie mit Herrn van Weyden abmachen müssen«, erwiderte er, indem er mir augenzwinkernd zunickte. »Herr van Weyden ist so etwas wie eine Autorität in Fragen des Rechtes. Ich bin nur ein einfacher Seemann und sehe die Situation daher etwas anders an. Für Sie mag es vielleicht ein Unglück sein, daß Sie hierbleiben müssen, aber für uns ist es sicher ein Glück.«
Er sah sie lächelnd an. Ihre Augen senkten sich vor seinem Blick, aber sie hob sie wieder trotzig zu den meinen. »Was meinen Sie?« fragte sie.
»Daß es schlimm wäre, namentlich wenn Sie Verpflichtungen für die nächsten Monate übernommen hätten. Da Sie aber, wie Sie sagen, lediglich aus Gesundheitsrücksichten nach Japan reisen wollten, kann ich Ihnen versichern, daß Sie sich nirgends besser erholen können als an Bord der ›Ghost‹.«
Ich sah ihre Augen unwillig aufblitzen, und diesmal senkte ich den Blick und fühlte, daß ich unter dem ihren errötete. Ich war feige, aber was hätte ich tun sollen.
»Herr van Weyden ist Autorität auf diesem Gebiete«, lachte Wolf Larsen.
Ich nickte, und sie blickte mich, jetzt wieder beherrscht, erwartungsvoll an.
»Nicht, daß er gerade schon damit prahlen könnte«, fuhr Wolf Larsen fort, »aber er hat sich prachtvoll erholt. Sie hätten ihn sehen sollen, als er an Bord kam. Ein jämmerlicheres Exemplar der Gattung Mensch hätte man schwerlich finden können. Stimmt das, Kerfoot?«
Kerfoot war bei dieser direkten Anrede so bestürzt, daß er das Messer zu Boden fallen ließ, aber es gelang ihm, zustimmend zu grunzen.
»Hat sich herausgemacht, durch Kartoffelschälen und Tellerwaschen, was, Kerfoot?«
Wieder grunzte der Würdige.
»Und schauen Sie ihn sich jetzt an! Er ist zwar nicht das, was man muskulös nennt, aber er hat doch Muskeln, und das konnte man nicht von ihm sagen, als er an Bord kam. Und dazu hat er gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Wenn Sie ihn jetzt sehen, glauben Sie es vielleicht nicht, aber im Anfang war er ganz außerstande dazu.«
Die Jäger kicherten, sie aber sah mich mit einem Mitgefühl an, das Wolf Larsens Unverschämtheit reichlich aufwog. Wahrlich: so lange hatte ich kein Mitgefühl gefunden, daß mir ganz weich ums Herz wurde. In diesem Augenblick wurde ich – und zwar freudig – ihr willfähriger Sklave. Aber ich war zornig auf Wolf Larsen. Mit seinen geringschätzigen Bemerkungen forderte er meine Männlichkeit, forderte er die Selbständigkeit heraus, die er mir verschafft hatte.
»Ich habe vielleicht gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen,« entgegnete ich, »aber noch nicht, auf die anderer zu treten.«
Er warf mir einen höhnischen Blick zu. »Dann ist Ihre Erziehung erst halb vollendet«, sagte er trocken und wandte sich wieder an sie.
»Wir sind sehr gastfreundlich auf der ›Ghost‹. Herr van Weyden kann das bestätigen. Wir tun alles, um es unseren Gästen angenehm zu machen, nicht wahr, Herr van Weyden?«
»Ja, bis zu Kartoffelschälen und Tellerwaschen,« antwortete ich, »gar nicht davon zu reden, daß einem aus lauter Freundschaft der Hals umgedreht wird.«
»Ich bitte Sie, sich durch Herrn van Weyden keine falschen Vorstellungen machen zu lassen,« legte er sich mit angenommener Ängstlichkeit dazwischen, »Sie werden bemerkt haben, Miß Brewster, daß er ein Messer im Gürtel trägt, etwas – hm – etwas ganz Ungewöhnliches für einen Schiffsoffizier. Herr van Weyden ist zwar sehr ehrenwert, aber, wie soll ich sagen, ein wenig streitsüchtig und gebraucht scharfe Mittel. In ruhigen Augenblicken ist er ganz vernünftig und umgänglich, und da er jetzt ruhig ist, wird er nicht leugnen, daß er mir gestern an den Kragen wollte.«
Ich wollte vor Wut ersticken, und meine Augen schossen Blitze. Er fuhr fort:
»Schauen Sie ihn jetzt an. Er kann sich kaum in Ihrer Gegenwart beherrschen. Er dürfte nicht gewohnt sein, sich in Gesellschaft von Damen zu bewegen. Ich werde mich bewaffnen müssen, ehe ich wagen kann, mit ihm an Deck zu gehen.«
Er schüttelte traurig den Kopf und murmelte: »Schlimm, schlimm!«, während die Jäger in schallendes Gelächter ausbrachen.
Die rauhen Stimmen dieser Seebären hallten polternd und brüllend in dem engen Raum wider und taten eine merkwürdige Wirkung. Die ganze Umgebung war wild und unheimlich, und als ich nun diese fremde Frau betrachtete und mir vorstellte, wie wenig sie hier hereinpaßte, wurde mir zum erstenmal klar, wie sehr ich selbst es tat. Ich kannte diese Männer und ihr Seelenleben, und ich war selbst einer der Ihren, lebte das Leben, aß die Kost und dachte die Gedanken der Robbenfänger. Für mich war nichts Merkwürdiges mehr an ihren rauhen Kleidern, ihren gemeinen Gesichtern, dem wilden Gelächter, an den schwankenden Kajütenwänden oder den schwingenden Schiffslampen. Als ich mir ein Stück Butterbrot schmierte, fiel mein Blick zufällig auf meine Hände. Die Knöchel waren hautlos und entzündet, die Finger geschwollen, die Nägel schwarzrandig. Ich fühlte die dichten Bartstoppeln auf meinem Halse und wußte, daß ein Ärmel meiner Jacke zerrissen war und ein Knopf an meinem blauen Hemde fehlte. Das Messer, das Wolf Larsen erwähnt hatte, hing in einer Scheide an meiner Hüfte. Es war sehr natürlich, daß es dort hing – wie natürlich, war mir nicht eingefallen, bis ich es jetzt mit ihren Augen ansah und mir bewußt wurde, wie seltsam ihr dies und alles andere vorkommen mußte.
Aber sie erriet den Spott in Wolf Larsens Worten und sandte mir wieder einen mitleidigen Blick. Gleichzeitig las ich jedoch Bestürzung in ihren Augen. Seine Neckereien machten die Situation nur noch verwirrender für sie.
»Ein vorbeifahrendes Schiff kann mich vielleicht aufnehmen«, schlug sie vor.
»Es gibt keine vorbeifahrenden Schiffe außer anderen Robbenschonern«, gab Wolf Larsen zur Antwort.
»Ich habe keine Kleider, nichts«, wandte sie ein. »Sie denken sicher nicht daran, daß ich kein Mann und das unstete Leben, das Sie und Ihre Leute führen, nicht gewohnt bin.«
»Je eher Sie sich daran gewöhnen, desto besser«, sagte er.
»Ich werde Sie mit Stoff, Nadel und Faden versehen«, fügte er hinzu. »Ich hoffe, es wird Ihnen nicht allzuviel Mühe machen, sich ein oder zwei Kleider zu nähen.« Sie verzog den Mund, um ihre Unerfahrenheit im Schneidern kundzutun. Daß sie ängstlich und verwirrt war und tapfer versuchte, es zu verbergen, war mir ganz klar.
»Ich nehme an, daß Sie ebenso wie Herr van Weyden dort gewohnt sind, alles durch andere für sich tun zu lassen. Nun, ich denke, Ihnen wird kein Stein aus der Krone fallen, wenn Sie einmal selbst etwas für sich tun müssen. Womit erwerben Sie sich übrigens Ihren Unterhalt?«
Sie sah ihn mit unverhohlenem Erstaunen an.
»Ich will Sie nicht beleidigen, glauben Sie mir. Man ißt, daher muß man arbeiten. Diese Männer hier schießen Robben, um zu leben; aus demselben Grunde führe ich diesen Schoner, und Herr van Weyden verdient sich, wenigstens jetzt, sein Brot, indem er mir hilft. Nun, und was tun Sie?«
Sie zuckte die Achseln.
»Ernähren Sie sich selbst, oder werden Sie durch andere ernährt?«
»Ich fürchte, den größten Teil meines Lebens hat mich ein anderer ernährt«, lachte sie, indem sie einen tapferen Versuch machte, auf den neckischen Ton Wolf Larsens einzugehen, obgleich ich wachsendes Entsetzen in ihren Augen aufsteigen sah.
»Ich nehme an, daß ein anderer auch das Bett für Sie macht?«
»Ich habe mir mein Bett gemacht«, erwiderte sie.
»Oft?«
Sie schüttelte den Kopf mit verstellter Reue.
»Wissen Sie, was man in den Staaten mit Armen tut, die wie Sie nicht für ihren Unterhalt arbeiten?«
»Ich bin sehr unwissend«, erwiderte sie, »was tut man mit meinesgleichen?«
»Man sperrt sie ein. Das Verbrechen, seinen Lebensunterhalt nicht zu verdienen, wird Landstreicherei genannt. Wäre ich Herr van Weyden, der sich andauernd mit der Frage beschäftigt, was Recht und Unrecht ist, so würde ich fragen, mit welchem Recht Sie leben, wenn Sie nichts tun, um Ihren Unterhalt zu verdienen?«
»Da Sie aber nicht Herr van Weyden sind, brauche ich Ihnen nicht zu antworten, nicht wahr?«
Sie sandte ihm aus ihren angstvollen Augen einen strahlenden Blick, der so rührend war, daß es mir ins Herz schnitt. Ich mußte irgendwie versuchen, dem Gespräch eine andere Wendung zu geben.
»Haben Sie je einen Dollar durch eigene Arbeit verdient?« fragte er triumphierend, im voraus seiner Sache sicher.
»Ja, das habe ich«, antwortete sie langsam, und ich hätte fast über sein verlegenes Gesicht lachen können. »Ich erinnere mich, daß mein Vater mir einmal, als ich ein kleines Mädchen war, einen Dollar gab, weil ich fünf Minuten lang still war.«
Er lächelte nachsichtig.
»Aber das ist lange her«, fuhr sie fort. »Und Sie werden wohl kaum verlangen, daß ein neunjähriges Mädchen sich seinen Lebensunterhalt selbst verdient.
»Gegenwärtig aber«, fuhr sie nach einer kurzen Pause fort, »verdiene ich ungefähr achtzehnhundert Dollar jährlich.«
Alle Augen hoben sich auf einmal von den Tellern und hefteten sich auf sie. Eine Frau, die achtzehnhundert Dollar jährlich verdiente, war wert, angeschaut zu werden. Wolf Larsen verhehlte seine Bewunderung nicht.
»Gehalt oder Akkordarbeit?«
»Akkordarbeit«, antwortete sie rasch.
»Achtzehnhundert«, rechnete er. »Das macht hundertundfünfzig monatlich. Nun, Fräulein Brewster, wir sind nicht kleinlich auf der ›Ghost‹. Betrachten Sie sich für die Dauer Ihres Aufenthalts als mit demselben Gehalt angestellt.«
Sie sagte nichts. Sie war seine Einfälle noch nicht so gewohnt, daß sie sie mit Gleichmut hingenommen hätte.
»Ich vergaß zu fragen,« fuhr er liebenswürdig fort, »welcher Art Ihre Beschäftigung ist. Was für Werkzeuge und Material brauchen Sie?«
»Papier und Tinte«, lachte sie. »Ach, und auch eine Schreibmaschine. «
»Sie sind Fräulein Maud Brewster«, sagte ich langsam und sicher, als beschuldigte ich sie eines großen Verbrechens.
Ihre Augen hoben sich neugierig zu den meinen. »Woher wissen Sie das?«
»Stimmt es nicht?« fragte ich.
Sie nickte zustimmend. Jetzt war die Reihe, verblüfft zu sein, an Wolf Larsen. Ihm bedeutete der Name nichts. Ich war stolz darauf, daß er mir etwas bedeutete, und zum erstenmal seit langer Zeit wurde ich mir meiner Überlegenheit über ihn bewußt.
»Ich erinnere mich, eine Besprechung über ein Bändchen von Ihnen geschrieben zu haben – –«, begann ich, aber sie unterbrach mich.
»Sie!« rief sie. »Sie sind – –«
Jetzt nickte ich meinerseits zustimmend.
»Humphrey van Weyden!« schloß sie – dann fügte sie mit einem Seufzer der Erleichterung hinzu, ohne daran zu denken, daß Wolf Larsen ihn bemerken mußte: »Wie mich das freut!«
»Ich entsinne mich recht wohl der Besprechung«, fuhr sie fort, als sie sich bewußt wurde, wie seltsam ihre Bemerkung wirken mußte. »Sie war wirklich zu schmeichelhaft.«
»Keineswegs«, verneinte ich schnell. »Sie setzen meine nüchterne Urteilskraft herab und entwerten meine Kritik. Im übrigen stimmen alle Kritiker mit mir überein. Hat Lang nicht Ihr Gedicht ›Der geduldete Kuß‹ zu den vier größten Sonetten gezählt, die von Frauen in englischer Sprache geschrieben worden sind?«
»Sie sind sehr gütig«, murmelte sie, und gerade das Konventionelle ihrer Worte und der ganze Schwarm von Vorstellungen des früheren Lebens auf der andern Seite der Welt durchzuckten mich – reich an Erinnerungen, aber auch stechend vor Heimweh.
»Also Sie sind Maud Brewster«, sagte ich feierlich und blickte sie an.
»Und Sie sind Humphrey van Weyden«, sagte sie und erwiderte meinen Blick ebenso feierlich und furchtsam. »Wie seltsam! Es ist mir alles ganz unverständlich. Wir haben sicherlich eine wildromantische Seegeschichte von Ihnen zu erwarten.«
»Nein, ich sammle keinen Stoff, das versichere ich Ihnen«, lautete meine Antwort. »Ich habe weder Geschick, noch Neigung für phantastische Literatur.«
»Sagen Sie mir: warum haben Sie sich immer in Kalifornien begraben?« fragte sie nun. »Das war wirklich nicht nett von Ihnen. Wir im Osten haben so wenig von Ihnen zu sehen bekommen – viel zu wenig – von dem großen amerikanischen Kritiker.«
Ich lehnte das Kompliment mit einer Verbeugung ab. »Ich hätte Sie fast einmal in Philadelphia getroffen, Sie wollten Browning oder etwas Ähnliches vortragen. Aber mein Zug hatte vier Stunden Verspätung.«
Und dann vergaßen wir ganz, wo wir waren, und ließen Wolf Larsen stumm und wie ein gescheitertes Schiff inmitten der Brandung unserer Unterhaltung. Die Jäger standen auf und gingen an Deck, und wir sprachen immer noch. Nur Wolf Larsen blieb. Plötzlich wurde ich seiner Anwesenheit inne, er saß zurückgelehnt am Tisch und lauschte neugierig unsern fremdartigen Reden über eine Welt, die er nicht kannte.
Ich brach mitten im Satze ab. Die Gegenwart mit all ihren Gefahren und Schrecken lähmte mich. Fräulein Brewster mußte es ähnlich gehen, ein unbestimmtes namenloses Entsetzen trat in ihre Augen, die jetzt auf Wolf Larsen fielen.
Er erhob sich und lachte verlegen mit einem seltsamen, metallischen Klang.
»Oh, kümmern Sie sich nicht um mich«, sagte er mit einer Handbewegung, als wolle er seine eigene Unterwürfigkeit kundgeben. »Ich zähle nicht mit. Bitte, fahren Sie nur fort.«
Aber die Tore der Beredsamkeit waren geschlossen. Auch wir erhoben uns und lachten verlegen.
Der Verdruß, den Wolf Larsen empfand, weil Maud Brewster und ich ihn in unserer Unterhaltung bei Tisch ignoriert hatten, mußte sich irgendwie Luft machen, und Thomas Mugridge sollte der Sündenbock sein. Trotz seiner gegenteiligen Behauptung hatte er weder sein Benehmen noch sein Hemd gewechselt. Dieses Kleidungsstück widerlegte ihn ebensosehr, wie die Fettablagerungen auf Ofen, Töpfen und Pfannen, die aller Begriffe von Reinlichkeit spotteten.
»Ich habe dich gewarnt, Köchlein«, sagte Wolf Larsen, »und jetzt hilft's dir nichts mehr, jetzt kriegst du deine Medizin.«
Mugridge wurde kreideweiß unter der Rußschicht, und als Wolf Larsen nach einem Tau und ein paar Mann rief, schoß der verzweifelte Cockney in wilder Flucht aus der Kombüse, machte weite Sätze über das Deck und duckte sich, um der Verfolgung der grinsenden Mannschaft zu entgehen. Der hätte kaum etwas größeres Vergnügen machen können, als ihn ein bißchen ins Schlepptau zu nehmen, denn was er der Mannschaft an Essen und Trinken vorgesetzt hatte, war einfach scheußlich gewesen. Auch die äußeren Verhältnisse begünstigten das Unternehmen. Die ›Ghost‹ glitt mit nur drei Meilen Fahrt durch das Wasser, und die See war ziemlich ruhig. Aber Mugridge verspürte nur geringe Neigung, untergetaucht zu werden. Höchstwahrscheinlich hatte er schon früher mitgemacht, wie Leute ins Schlepptau genommen wurden. Zudem war das Wasser furchtbar kalt und er alles andere eher, als abgehärtet.
Wie gewöhnlich, wenn Aussicht auf eine Belustigung war, kamen die andere Wache und die Jäger an Deck. Mugridge schien eine verzweifelte Angst vor dem Wasser zu haben und zeigte eine Gewandtheit und Schnelligkeit, die niemand ihm zugetraut hätte. Als er in dem Winkel zwischen Kombüse und Ruff in die Klemme getrieben wurde, sprang er wie eine Katze auf das Kajütendach und rannte nach achtern. Seine Verfolger kamen ihm zuvor, aber er entwischte ihnen und erreichte das Deck mit Hilfe der Zwischendecksluke. Jetzt rannte er vorwärts, der Bootspuller Harrison dicht hinter ihm her. Plötzlich aber machte Mugridge einen Sprung und packte die Klüverbaum-Toppenant. Es war das Werk eines Augenblicks. Er hing an den Armen und beschrieb mit den ausgestreckten Beinen einen Kreis in der Luft. Der anstürmende Harrison wurde mitten in den Leib getroffen, brüllte unwillkürlich auf und stürzte rücklings auf das Deck. Händeklatschen und schallendes Gelächter begrüßten diese Heldentat, während Mugridge, die Hälfte seiner Verfolger am Fockmast lassend, wie ein Läufer beim Fußball nach achtern rannte. Direkt nach achtern ging es, nach der Ruff und die Ruff entlang zum Heck. So groß war seine Schnelligkeit, daß er, als er um die Kajüte ausbog, ausrutschte und fiel. Im Fallen traf er die Beine Nilsons, der am Rande stand. Sie stürzten übereinander, doch nur Mugridge erhob sich wieder. Durch eine Laune des Schicksals hatte sein schwächlicher Körper das Bein des starken Mannes wie ein Pfeifenrohr geknickt.
Parsons ergriff das Rad, und die Verfolgung wurde wieder aufgenommen. Immer ums Deck herum ging es. Erst Mugridge, vor Angst fast von Sinnen, und hinterdrein die Matrosen, die sich schreiend die Richtung angaben, und die Jäger, die sie mit brüllendem Gelächter anfeuerten. Auf der Vorderluke fiel dann Mugridge mit drei Mann über sich. Aber er wand sich wie ein Aal heraus und sprang zur Haupttakelung, während ihm das Blut aus dem Munde troff und das anstoßerregende Hemd in Fetzen riß. Hinauf ging es, geradeswegs hinauf, unter den Püttingswanten zum Großmasttopp.
Ein halbes Dutzend Matrosen setzte ihm nach, mußte aber an den Dwarssalingen zurückbleiben bis auf zwei, Oofty-Oofty und Black, den Bootssteuerer Latimers, die ihn weiter die dünnen, stählernen Stags hinauf verfolgten und sich mit den Armen immer höher schwangen.
Es war ein gefährliches Unternehmen, denn in einer Höhe von über hundert Fuß über Deck und nur an den Händen hängend, konnten sie sich nur schwer vor Mugridges Füßen schützen. Und Mugridge trat um sich wie ein Wilder, bis der Kanake, der sich mit der einen Hand festhielt, mit der andern den Fuß des Cockneys packte. Black tat dasselbe mit dem andern Fuß. Eine Weile hingen alle drei und wanden sich in einem unentwirrbaren Klumpen, bis sie, immer noch kämpfend, hinunterrutschten und in die Arme ihrer Kameraden auf den Dwarssalingen fielen.
Die Schlacht in der Luft war vorbei, und Thomas Mugridge wurde, wimmernd und heulend, mit blutigem Schaum vor dem Munde, aufs Deck geschleppt. Wolf Larsen steckte eine Bugleine durch eine Tauschlinge, die er ihm unter den Armen um den Leib legte. Dann wurde er nach achtern geschleppt und ins Wasser geworfen. Vierzig – fünfzig – sechzig Fuß Leine waren bereits ausgelaufen, als Wolf Larsen »Festmachen!« rief. Oofty-Oofty legte eine Schlinge um einen Pöller, die Leine straffte sich, und durch die andauernde Fahrt der ›Ghost‹ wurde der Koch an die Oberfläche gerissen.
Es war ein mitleiderregender Anblick. Wenn er auch nicht ertrinken konnte und dazu zäh wie eine Katze war, erlitt er doch die Qualen eines Ertrinkenden. Die ›Ghost‹ fuhr sehr langsam, und wenn ihr Heck sich auf einer Welle hob und sie vorwärts glitt, zog sie den Unglücklichen an die Oberfläche, daß er einen Augenblick Atem schöpfen konnte. Wenn aber das Heck sank und der Bug träge die nächste Woge erklomm, wurde die Leine wieder schlaff, und er sank unter. Ich hatte ganz Maud Brewsters Existenz vergessen und fuhr daher erschrocken zusammen, als sie mit leichten Schritten neben mich trat. Seit sie an Bord gekommen war, befand sie sich das erstemal an Deck. Totenstille begrüßte ihr Erscheinen.
»Worüber freuen sich alle so?« fragte sie.
»Fragen Sie Kapitän Larsen«, antwortete ich gefaßt und kühl, obwohl mir das Blut bei dem Gedanken kochte, daß sie Zeuge einer solchen Roheit werden sollte.
Sie wollte meinem Rat folgen und wandte sich um, als ihr Blick auf Oofty-Oofty fiel, der mit anmutig gestrafftem Körper vor ihr stand und die Tauschlinge hielt.
»Fischen Sie?« fragte sie.
Er antwortete nicht. In seine Augen, die sich fest auf die See achtern hefteten, trat plötzlich ein Schimmer. »Hai ahoi, Kapitän!« schrie er.
»Hiv ein! Schnell alle Mann!« rief Wolf Larsen und sprang selbst vor allen andern an die Leine.
Mugridge hatte den Warnruf des Kanaken gehört und schrie wie ein Besessener. Ich konnte eine schwarze Flosse sehen, die das Wasser durchschnitt, und zwar mit größerer Schnelligkeit, als er eingehahlt wurde. Ein Wettrennen zwischen dem Hai und uns begann, aber alles vollzog sich in wenigen Augenblicken. Als Mugridge gerade unter uns war, sank das Heck in ein Wellental, wodurch der Hai einen Vorsprung gewann. Beinahe ebenso, aber nicht ganz so schnell war Wolf Larsen. Seine ganze Kraft äußerte sich in einem gewaltigen Ruck. Der Körper des Kochs schoß aus dem Wasser, der Hai hinterdrein.
Mugridge zog die Füße hoch, deren einen der Menschenfresser nur eben zu berühren schien. Dann sank er klatschend ins Wasser zurück. Aber bei der Berührung stieß Thomas Mugridge einen lauten Schrei aus. Dann wurde er wie ein Fisch an der Angel hochgezogen, streifte leicht die Reling und stürzte kopfüber aufs Deck.
Doch ein Strom von Blut ergoß sich über die Planken. Der rechte Fuß fehlte, fast am Knöchel amputiert. Ich blickte Maud Brewster an. Sie war leichenblaß, ihre Augen weiteten sich vor Entsetzen. Sie sah nicht Thomas Mugridge, sondern Wolf Larsen an. Und er bemerkte es, denn er sagte mit kurzem Lachen:
»Männerspiel, Miß Brewster. Wohl etwas rauher, als Sie es gewöhnt sein mögen, aber immerhin – Männerspiel. Der Hai war nicht mit in der Rechnung. Es –« Bei diesen Worten hatte Thomas Mugridge den Kopf gehoben und war sich über den Verlust, den er erlitten hatte, klar geworden. Jetzt kroch er über das Deck und schlug plötzlich seine Zähne in Wolf Larsens Bein. Der aber bückte sich ruhig zum Cockney nieder und preßte mit Daumen und Zeigefinger von hinten die Kinnladen des Mannes unterhalb der Ohren zusammen. Die Kiefer öffneten sich widerstrebend, und Wolf Larsen war frei.
»Wie gesagt«, fuhr er fort, als ob nichts Besonderes geschehen sei: »Der Hai war nicht mit in der Rechnung. Es war – hm – sagen wir, göttliche Vorsehung.« Sie gab kein Zeichen, daß sie ihn gehört hatte, aber die Angst in ihren Augen wich unaussprechlichem Ekel, und sie wandte sich, um zu gehen. Sie hatte indessen kaum einen Schritt getan, als sie wankte und die Hand schwach nach mir ausstreckte. Ich fing sie gerade noch rechtzeitig auf und half ihr, sich auf die Kajütstreppe zu setzen. Ich glaubte, sie würde sofort in Ohnmacht fallen, aber sie beherrschte sich.
»Herr van Weyden, wollen Sie eine Aderpresse holen«, rief Wolf Larsen mir zu.
Ich zögerte. Ihre Lippen bewegten sich, und obgleich sie kein Wort hervorbrachte, bat sie mich mit den Augen so deutlich wie mit Worten, dem Unglücklichen zu helfen. Mit Anstrengung flüsterte sie »bitte!«, und mir blieb nichts übrig, als zu gehorchen.
Ich hatte allmählich solche Geschicklichkeit als Chirurg erlangt, daß Wolf Larsen mir nach kurzer Beratung die Behandlung überlassen konnte, wobei mir ein paar Matrosen halfen. Für seinen Teil wählte er sich die Rache an dem Hai. Ein schwerer Wirbelhaken, an dem als Köder ein Stück Pökelfleisch hing, wurde über Bord geworfen, und als ich gerade damit fertig war, die gefährdeten Venen und Arterien zusammenzupressen, holten die Matrosen singend das Ungeheuer ein. Ich sah es nicht selbst, aber meine Assistenten verließen mich abwechselnd, um mitschiffs zu laufen und zu sehen, was vorging. Der 16 Fuß lange Hai wurde in die Haupttakelung geheißt. Sein Rachen war weit aufgerissen, und jetzt wurde eine an beiden Seiten zugespitzte Eisenstange hineingestellt, so daß sie sich in die Kiefer, wenn sie sich schließen wollten, einbohren und sie festhalten mußte. Als dies vollbracht war, wurde der Haken herausgeschnitten. Der Hai sank ins Meer zurück, hilflos und doch im Besitz seiner vollen Kraft, zu langsamem Hungertode verurteilt, den weniger er verdiente als der Mann, der ihm diese Strafe zuerteilte.
Als ich sie auf mich zukommen sah, wußte ich, was sie wollte. Ich hatte sie zehn Minuten lang ernst mit dem Maschinisten sprechen sehen, und jetzt zog ich sie außer Hörweite des Rudergastes, indem ich ihr ein Zeichen machte, zu schweigen. Ihr Antlitz war blaß und entschlossen, ihre großen Augen, die die Entschlossenheit noch größer machte, sahen fest in die meinen. Mir war nicht sehr wohl zumute, denn sie kam, um meine Seele zu erforschen, und ich besaß, seit ich auf die ›Ghost‹ gekommen war, nichts mehr, auf das ich besonders stolz hätte sein können. Wir gingen zum Rande der Achterhütte, wo sie sich umwandte und mir ins Gesicht blickte. Ich sah mich um, um mich zu vergewissern, daß niemand in Hörweite war.
»Was gibt es?« fragte ich sanft, aber der entschlossene Ausdruck wich nicht von ihrem Gesicht.
»Ich kann begreifen, daß das, was heute morgen geschah, in der Hauptsache ein Unglücksfall war, aber ich habe mit Herrn Haskins gesprochen, und er erzählt mir, daß an dem Tage, als wir gerettet wurden, während ich in der Kajüte war, zwei Menschen ertränkt, mit Vorbedacht ertränkt – ermordet wurden.«
In ihrer Stimme lag eine Frage, und sie sah mich anklagend an, als ob ich schuldig oder doch wenigstens mitschuldig an der Tat wäre.
»Das ist ganz richtig«, antwortete ich. »Die beiden Männer wurden ermordet.«
»Und das haben Sie zugelassen?« rief sie.
»Ich war nicht imstande, es zu verhindern, so muß es wohl heißen«, entgegnete ich, immer noch sanft.
»Aber haben Sie wenigstens den Versuch gemacht, es zu verhindern?« Sie legte den Ton auf das Wort ›Versuch‹, und ein flehender Klang war in ihrer Stimme. »Ach, Sie haben es nicht getan«, fuhr sie fort, da sie meine Antwort erriet ... »Aber warum nicht?«
Ich zuckte die Achseln. »Sie dürfen nicht vergessen, Fräulein Brewster, daß Sie ein neuer Bewohner dieser kleinen Welt sind und noch nicht die Gesetze, die hier herrschen, verstehen. Sie haben gewiß edle Begriffe von Menschlichkeit, Männlichkeit, Benehmen und ähnlichem mitgebracht, aber Sie werden bald erkennen, daß das alles hier keine Geltung hat. Mir ging es ebenso«, fügte ich, unwillkürlich seufzend, hinzu. Ungläubig schüttelte sie den Kopf.
»Was würden Sie mir denn raten?« fragte ich. »Soll ich ein Messer, ein Gewehr oder eine Axt nehmen und diesen Mann töten?«
Sie wich zurück. »Nein, das nicht!«
»Was sollte ich sonst tun? Mich selbst töten?«
»Sie betrachten die Dinge von einem rein materiellen Standpunkt«, hielt sie mir entgegen. »Es gibt einen sittlichen Mut, und ein solcher sittlicher Mut ist nie wirkungslos.«
»Ach,« lächelte ich, »ich soll weder ihn noch mich töten, sondern mich von ihm töten lassen.« Sie wollte sprechen, aber ich hob die Hand. »Sittlicher Mut ist etwas ganz Wertloses auf dieser schwimmenden kleinen Welt. Leach, der eine der beiden Ermordeten, besaß sittlichen Mut in außergewöhnlich hohem Maße. Ebenso der andere, Johnson. Er hat ihnen nicht nur nichts genützt, er hat sie sogar vernichtet. Und so würde es mir auch geschehen, wenn ich das bißchen sittlichen Mut, das ich besitze, gebrauchen wollte.
Sie müssen verstehen, Fräulein Brewster, völlig verstehen, daß dieser Mann ein Ungeheuer ist. Er besitzt kein Gewissen. Nichts ist ihm heilig, nichts ist so furchtbar, daß er es nicht täte. Eine Laune von ihm hielt mich an Bord zurück. Eine Laune von ihm hat mich am Leben gelassen. Ich tue nichts, kann nichts tun, denn ich bin der Sklave dieses Ungeheuers, wie Sie jetzt seine Sklavin sind, weil ich leben möchte, wie Sie leben möchten, weil ich nicht kämpfen und ihn überwältigen kann, gerade wie Sie nicht imstande wären, ihn zu bekämpfen und zu überwältigen.«
Sie schwieg, wartete offenbar, daß ich fortfahren sollte.
»Was soll ich noch sagen? Mir ist die Rolle des Schwachen zugeteilt. Ich schweige und erdulde die Schmach, wie auch Sie schweigen und dulden werden. Das ist das Beste, was wir tun können, wenn wir am Leben bleiben wollen. Der Kampf entscheidet sich nicht stets für den Starken. Wir haben nicht die Kraft, mit diesem Manne zu kämpfen. Wir müssen heucheln, und wenn wir gewinnen, tun wir es durch Verschlagenheit Wenn Sie sich von mir raten lassen wollen, so richten Sie sich hiernach. Ich weiß, daß meine Lage gefährlich ist, und die Ihre, das kann ich offen sagen, noch gefährlicher. Wir müssen zusammenhalten, müssen ein geheimes Bündnis schließen, ohne daß jemand es merkt. Mir wird es nicht möglich sein, offen Ihre Partei zu ergreifen, und was Unwürdiges mir auch immer auferlegt wird: Sie müssen schweigen. Wir dürfen es nicht auf einen Streit mit diesem Manne ankommen lassen, und wir dürfen seinen Willen nicht durchkreuzen. Wir müssen lächeln und freundlich zu ihm sein, so widerwärtig es uns auch sein mag.«
Sie strich sich mit der Hand über die Stirn und sagte verwirrt: »Es ist mir immer noch unverständlich.«
»Sie müssen tun, wie ich sage«, unterbrach ich sie gebieterisch, denn ich sah, wie Wolf Larsens Blick uns traf, während er mit Latimer mittschiffs auf und ab wanderte. »Tun Sie, wie ich sage, und Sie werden bald sehen, daß ich recht habe.«
»Was soll ich denn tun?« fragte sie, als sie den ängstlichen Blick bemerkte, den ich auf den Gegenstand unserer Unterhaltung warf, und – so schmeichle ich mir – durchdrungen von dem Ernst meiner Worte. »Lassen Sie alle Ihre Begriffe von sittlichem Mut fahren«, sagte ich rasch. »Reizen Sie nicht den Unwillen dieses Mannes. Seien Sie ganz freundlich zu ihm, sprechen Sie mit ihm, streiten Sie sich mit ihm über Literatur und Kunst – er liebt diese Dinge. Sie werden in ihm einen aufmerksamen, verständnisvollen Zuhörer finden. Und um Ihrer selbst willen vermeiden Sie es, soweit möglich, Zeuge der Brutalitäten zu sein, die auf diesem Schiffe geschehen. Das wird es Ihnen erleichtern, Ihre Rolle zu spielen.«
»Ich soll also lügen«, sagte sie fest und mit Empörung in der Stimme. »Lügen in Wort und Tat.«
Wolf Larsen hatte Latimer stehen lassen und kam auf uns zu. Ich erschrak tief.
»Bitte, bitte, mißverstehen Sie mich nicht«, sagte ich rasch, indem ich die Stimme senkte. »Alle Ihre Menschenkenntnis, alle Ihre Erfahrungen sind hier wertlos. Sie müssen ganz umlernen. Ich weiß – ich kann es sehen: Sie haben in anderen Verhältnissen gelebt, sind gewohnt, Menschen mit Ihren Augen zu beherrschen, durch sie gewissermaßen Ihren sittlichen Mut sprechen zu lassen. Sie haben mich bereits mit Ihren Augen beherrscht, mit ihnen über mich geboten. Aber versuchen Sie es nicht mit Wolf Larsen. Ebenso leicht könnten Sie einen Löwen beherrschen, und er würde sich nur über Sie lustig machen. Er würde – ich bin immer stolz darauf gewesen, daß ich ihn entdeckt habe«, sagte ich, indem ich den Gesprächsstoff wechselte, da Wolf Larsen in diesem Augenblick zu uns auf die Achterhütte trat. »Die Redakteure fürchteten ihn, und die Verleger wollten nichts mit ihm zu schaffen haben. Aber ich hatte ihn erkannt, und sein Genie und meine Urteilskraft wurden gerechtfertigt, als er den fabelhaften Erfolg mit seiner ›Schmiede‹ hatte.«
»Und dabei war es ein Zeitungsgedicht«, sagte sie, ebenfalls im Unterhaltungston.
»Es erschien zufällig in einer Zeitung«, erwiderte ich, »aber es hatte schon manchem Zeitschriftenredakteur vorgelegen.
Wir sprechen von Harris«, sagte ich zu Wolf Larsen. »Ach ja«, stimmte er zu. »Ich entsinne mich gut der ›Schmiede‹. Eine Fülle schöner Gefühle und ein allmächtiger Glaube an menschliche Illusionen. Aber Herr van Weyden, Sie sollten sich lieber nach Köchlein umsehen. Er klagt und ist unruhig.«
So wurde ich auf recht derbe Weise von der Achterhütte weggeschickt, und nur, um Mugridge in tiefem Schlummer zu finden nach dem Morphium, das ich ihm gegeben hatte. Ich beeilte mich nicht, wieder an Deck zu kommen, als ich es aber schließlich tat, sah ich zu meiner Freude Fräulein Brewster in angeregter Unterhaltung mit Wolf Larsen. Wie gesagt, freute ich mich über diesen Anblick. Sie befolgte also meinen Rat. Und doch durchzuckte mich ein leichter Schmerz, als ich sah, daß sie tat, um was ich sie gebeten, und was sie vorhin mit Abscheu von sich gewiesen hatte.
Günstige Winde trieben die ›Ghost‹ schnell nordwärts in die Robbengründe. Wir trafen die Herden auf dem 44. Breitengrad in einer rauhen, stürmischen See, über die der Wind die Nebelbänke in wilder Flucht hetzte. Tagelang konnten wir nicht die Sonne sehen und Beobachtungen machen. Dann aber fegte der Wind die Oberfläche des Ozeans rein, die Wellen kräuselten sich schimmernd, und wir konnten feststellen, wo wir waren. Ein klarer Tag, auch drei oder vier konnten folgen, dann senkte sich der Nebel wieder auf uns herab, anscheinend dichter als je.
Die Jagd war gefährlich, aber dennoch wurden die Boote Tag für Tag hinuntergelassen, von der grauen Finsternis verschlungen und erst bei herabsinkender Nacht, ja oft erst viel später wiedergesehen. Wie Seegespenster huschten sie dann eines nach dem andern aus dem Grau hervor. Wainwright – der Jäger, den Wolf Larsen mit Boot und Mannschaft gestohlen hatte – benutzte den Nebel, um zu entwischen. Er verschwand eines Morgens mit seinen beiden Leuten in den kreisenden Schwaden, und wir sahen sie nie wieder. Nach einigen Tagen erfuhren wir jedoch, daß sie von einem Schoner zum andern gegangen waren, bis sie endlich ihren eigenen wiedergefunden hatten. Das hatte ich selbst schon längst tun wollen, aber es bot sich mir nie eine Gelegenheit. Es war nicht Sache des Steuermanns, mit in die Boote zu gehen, und welche List ich auch anwandte, gab Wolf Larsen mir doch nie die Erlaubnis dazu. Hätte er es getan, so würde ich irgendwie versucht haben, Fräulein Brewster mitzunehmen. Näherten sich die Dinge doch einem Stadium, an das zu denken mir Grauen einflößte. Ich wollte nicht daran denken, aber immer wieder erhob sich der Gedanke wie ein Spukgespenst in meinem Kopfe und wich nicht.
Ich hatte früher Seegeschichten gelesen, in denen die einsame Frau unter einer Schar von Männern als das natürlichste von der Welt vorkam; jetzt aber erfuhr ich, daß ich nie die tiefere Bedeutung dieser Situation erfaßt hatte. Und hier stand ich dieser Situation nun Angesicht zu Angesicht gegenüber. Um sie so lebendig wie möglich zu gestalten, brauchte es nur, daß die Frau Maud Brewster war.
Kein größerer Gegensatz als der zwischen ihr und ihrer Umgebung hätte je ersonnen werden können. Sie war zart und ätherisch, geschmeidig und mit leichten, anmutigen Bewegungen. Ich hatte nie das Gefühl, als ob sie schritte, oder es doch wenigstens nach Art gewöhnlicher Sterblicher täte. Eine seltene Leichtigkeit lag über ihr, und sie bewegte sich mit einer unbeschreiblichen Anmut. Näherte sie sich einem, so geschah es wie ein Vogel, der auf geräuschlosen Schwingen herniederschwebte.
Sie war wie ein Gegenstand aus Meißener Porzellan, und ich wurde immer wieder betroffen von einem Eindruck von Zerbrechlichkeit, den sie auf mich machte. Wie damals, als ich ihren Arm ergriffen hatte, um ihr die Kajütstreppe hinunterzuhelfen, war ich jederzeit darauf vorbereitet, sie zerbrechen zu sehen, falls sie zu hart angepackt würde. Nie habe ich eine solche Harmonie zwischen Körper und Geist gesehen. Ihr Körper schien ein Teil ihrer Seele zu sein, schien die gleichen Eigenschaften zu besitzen und an das Leben nur durch die zartesten Ketten gefesselt zu sein. In der Tat: sie trat leicht über diese Erde, und nur ein Geringes von grobem Staube haftete ihr an.
Wolf Larsen bildete einen schreienden Gegensatz zu ihr. Ich beobachtete sie, wie sie eines Morgens zusammen über das Deck schritten, und ich verglich sie als die äußersten Endpunkte der menschlichen Entwicklung – er der Höhepunkt aller Barbarei, sie das vollendetste Produkt höchster Zivilisation. Wahrlich: Wolf Larsen besaß einen ungewöhnlichen Intellekt, aber er benutzte ihn einzig im Dienste seiner wilden Instinkte, was ihn nur um so schrecklicher und wilder machte. Er besaß prachtvolle Muskeln und war athletisch gebaut, aber obwohl er fest und bestimmt auftrat, haftete seinem Schritt keine Schwere an. An Dschungel und Wildnis gemahnten Heben und Senken seines Fußes. Geschmeidig und stark – vor allem stark – war sein Gang wie der einer Katze. Er glich einem großen Tiger, einem tapferen Raubtier. So wirkte er, und in seinen Augen leuchtete zeitweise derselbe durchdringende Glanz auf, den ich in denen eingesperrter Leoparden oder anderer beutesuchender Geschöpfe der Wildnis in ihren Käfigen gesehen hatte.
Sie kamen in die Nähe der Kajütskappe, wo ich stand. Obgleich sie es durch kein äußeres Zeichen verriet, spürte ich doch, daß sie sich in großer Erregung befand. Sie machte irgendeine nichtssagende Bemerkung, blickte mich an und lachte unbekümmert, dann aber sah ich, wie ihre Augen unwillkürlich, wie fasziniert, die seinen suchten; sie senkte sie wieder, aber doch nicht schnell genug, um das Entsetzen, das in ihnen geschrieben stand, zu verbergen.
In seinen Augen sah ich die Ursache ihrer Erregung. Sonst grau, kalt und hart, waren sie jetzt warm, sanft und golden, und es tanzten in ihnen winzige Lichter, die erloschen und schwanden, aber wieder aufflammten, bis sie die Augen ganz mit einem glühenden Leuchten erfüllten. Vielleicht verursachten sie den goldenen Schein. Jedenfalls waren seine Augen golden, verführerisch und herrisch, lockend und zwingend und verliehen einem Befehl, einem Schrei des Blutes Ausdruck, den kein Weib, am wenigsten Maud Brewster, mißverstehen konnte.
Ihre Angst steckte mich an, und in diesem Augenblick der Furcht – der entsetzlichsten Furcht, die ein Mann fühlen kann, wußte ich, daß sie mir unsäglich teuer war. Das Bewußtsein, daß ich sie liebte, überkam mich gleichzeitig mit der Angst, und beide Gefühle umkrallten mein Herz und ließen mein Blut gefrieren und zugleich aufrührerisch wallen. Ich fühlte mich von einer fremden Macht bezwungen und wandte mich wider Willen, um in Wolf Larsens Augen zu blicken. Aber jetzt hatte er seine Selbstbeherrschung wiedergefunden. Die goldene Farbe und das schimmernde Licht waren erloschen. Seine Augen funkelten kalt und grau, als er sich jetzt plötzlich mit einer unbeholfenen Bewegung abwandte.
»Ich fürchte mich,« flüsterte sie schaudernd, »ich fürchte mich so.«
Auch ich fürchtete mich und befand mich in starker Erregung über die Entdeckung, die ich gemacht hatte, aber es gelang mir, gelassen zu antworten:
»Es wird schon alles gut werden, Fräulein Brewster. Glauben Sie mir, es wird alles gut werden.«
Sie antwortete mit einem kleinen dankbaren Lächeln, das mein Herz klopfen ließ, und ging dann die Kajütstreppe hinunter.
Lange blieb ich dort stehen, wo sie mich verlassen hatte. Es war eine zwingende Notwendigkeit für mich, mich zu besinnen und mir klar darüber zu werden, welche Wendung die Dinge genommen hatten. Jetzt endlich war sie gekommen, die Liebe, war zu mir gekommen, nun, da ich es am wenigsten erwartet hatte, und unter den schwierigsten Verhältnissen.
Maud Brewster! Meine Erinnerung flog zurück zu dem ersten dünnen Bändchen auf meinem Schreibtisch, und ich sah zum Greifen deutlich die ganze Reihe schmaler Bändchen auf meinem Bücherbrett vor mir. Mit welcher Freude hatte ich jedes von ihnen begrüßt! Alljährlich war eines von ihnen erschienen, und jedesmal war es das Ereignis des Jahres für mich gewesen. Sie hatten eine verwandte Saite in meinem Geiste angeschlagen, und in diesem Sinne hatte ich sie kameradschaftlich begrüßt; aber jetzt hatten sie ihren Platz in meinem Herzen gefunden.
Und dann kehrte mein Geist – ungereimt und sinnlos – zu einer kleinen biographischen Bemerkung in dem roten Bande ›Wer ist's?‹ zurück. ›Sie ist in Cambridge geboren und 27 Jahre alt.‹ Und ich sagte mir: ›27 Jahre alt und doch noch frei?‹ Wie konnte ich wissen, ob sie noch frei war? Und der Stich neugeborener Eifersucht jagte allen Zweifel in die Flucht. Nein, es war sicher. Ich war eifersüchtig, also war ich verliebt. Und die, die ich liebte, war Maud Brewster. Obgleich ich stets von Frauen umgeben gewesen, hatte ich sie nur rein ästhetisch betrachtet, weiter nichts. Ich hatte wirklich manchmal geglaubt, daß die Regel keine Geltung auf mich hätte, daß ich ein Einsiedler wäre, dem das Glück der Liebe versagt sei. Und nun war es doch gekommen! In einer Art Ekstase verließ ich meinen Platz an der Kajütskappe und schritt über das Deck, indem ich die wundervollen Verse Elisabeth Brownings murmelte:
»Traumbilder waren viele Jahre lang
Genossen statt der Frau'n und Männer mir;
Die besten Kameraden seid doch ihr.
Kein süßer Lied ein andrer je mir sang.«
Jetzt aber erklang das süßere Lied in meinen Ohren, und ich war blind und taub für alles um mich her. Die scharfe Stimme Wolf Larsens rüttelte mich auf. »Zum Donnerwetter, was treiben Sie?«
Ich war nach vorn geschritten, wo die Matrosen mit Anstreichen beschäftigt waren, und bemerkte jetzt, daß ich mit dem Fuße fast einen Farbentopf umgestoßen hätte.
»Schlafwandeln, Sonnenstich – wie?« brummte er.
»Nein, Verdauungsstörung«, erwiderte ich und ging weiter, als ob mir nichts Ungewöhnliches begegnet wäre.
Zu den stärksten Eindrücken meines Lebens gehören die Ereignisse auf der ›Ghost‹ in den vierzig Stunden, die der Entdeckung meiner Liebe zu Maud Brewster folgten. Nach einem stillen, geruhigen Leben war ich mit 35 Jahren in eine Reihe der unwahrscheinlichsten Abenteuer verwickelt worden, die ich mir je hatte träumen lassen, aber nie habe ich so viele und so spannende Erlebnisse gehabt wie in diesen vierzig Stunden. Und auch heute noch kann ich meine Ohren nicht ganz der leisen Stimme des Stolzes verschließen, die mir zuflüstert, daß ich, alles in allem, nicht übel dabei abgeschnitten habe.
Das erste war, daß Wolf Larsen den Jägern beim Mittagessen mitteilte, sie sollten in Zukunft im Zwischendeck essen. Das war etwas ganz Unerhörtes auf Robbenschonern, wo die Jäger stets Offiziersrang bekleiden. Er gab keine Gründe an, sie waren aber klar genug. Horner und Smoke hatten angefangen, Maud Brewster den Hof zu machen; es war dies an und für sich nur lächerlich und durchaus nicht beleidigend für Fräulein Brewster, aber es störte Wolf Larsen offenbar.
Die Ankündigung wurde mit tiefem Schweigen entgegengenommen, wenn auch die vier andern Jäger bedeutungsvoll auf die beiden Schuldigen blickten. Jock Horner verzog, seiner ruhigen Art gemäß, keine Miene. Aber Smoke stieg das Blut zu Kopfe, und er öffnete den Mund, um etwas zu sagen. Wolf Larsen beobachtete ihn abwartend, den stahlharten Schimmer in den Augen, aber Smoke schloß wortlos wieder den Mund. »Wünschen Sie etwas?« fragte der Kapitän angriffslustig.
Das war eine Herausforderung, aber Smoke tat, als verstände er sie nicht.
»Was denn?« fragte er so unschuldig, daß Wolf Larsen aus der Fassung gebracht wurde, während die andern lächelten.
»Ach nichts«, sagte Wolf Larsen friedlich. »Ich dachte nur, Sie wollten gern eine 'runtergelangt haben.«
»Wofür?« fragte der unerschütterliche Smoke.
Jetzt lächelten Smokes Kameraden ganz unverhohlen. Der Kapitän hätte ihn töten mögen, und ich bin überzeugt, daß Blut geflossen sein würde, wenn Maud Brewster nicht dabeigewesen wäre. Ihre Anwesenheit hatte denn auch Smoke ermutigt. Er war zu vorsichtig, als daß er Wolf Larsens Zorn zu einem Zeitpunkt herausgefordert hätte, da dieser Zorn sich stärker als in Worten hätte äußern können. Ich fürchtete dennoch, daß es zum Kampfe kommen sollte, aber da ertönte ein Ruf vom Rudergast, der die Situation rettete.
»Rauch ahoi!« klang es die Kajütstreppe herab.
»Welche Richtung?« rief Wolf Larsen hinauf.
»Gerade achtern.«
»Vielleicht ein Russe«, meinte Latimer.
Bei seinen Worten zeigte sich Schrecken auf den Gesichtern der andern Jäger. Ein Russe konnte nur eins bedeuten: einen Kreuzer. Die Jäger hatten zwar nur eine annähernde Vorstellung, wo wir uns befanden, aber sie wußten doch, daß wir nicht weit von der Grenze des verbotenen Territoriums sein konnten, und alle kannten Wolf Larsens Ruf als Wilderer. Alle Augen richteten sich auf ihn.
»Wir sind vollkommen sicher«, beruhigte er sie lachend. »Diesmal gibt's keine Salzminen, Smoke. Aber ich will euch etwas sagen: ich will fünf gegen eins wetten, daß es die ›Macedonia‹ ist.«
Als keiner die Wette annahm, fuhr er fort: »Und wenn das stimmt, wette ich zehn gegen eins, daß wir Scherereien kriegen.«
»Nein, ich danke«, sagte Latimer freimütig. »Ich habe nichts dagegen, mein Geld zu verlieren, aber ich will wenigstens das Pferd laufen sehen. Es ist noch nie ohne Scherereien abgegangen, wenn Sie mit Ihrem Bruder zusammengetroffen sind, und ich will selbst zwanzig gegen eins darauf wetten.«
Seine Worte erregten allgemeine Heiterkeit, in die auch Wolf Larsen einstimmte, und die Mahlzeit verlief friedlich, obwohl er mich die ganze Zeit niederträchtig behandelte, mich höhnte und reizte, bis ich vor unterdrückter Wut zitterte. Aber ich wußte, daß ich mich um Maud Brewsters willen beherrschen mußte, und ich wurde belohnt, als ich einen ihrer Blicke erhaschte, der deutlicher als alle Worte sprach: ›Verlier den Mut nicht!‹
Wir standen von Tische auf und gingen an Deck, denn ein Dampfer war eine willkommene Unterbrechung des eintönigen Lebens auf See, und die Überzeugung, daß es Tod Larsen und die ›Macedonia‹ waren, vermehrte unsere Aufregung. Die steife Brise und die schwere See vom vergangenen Nachmittage hatten sich am Morgen etwas beruhigt, so daß es jetzt möglich war, die Boote hinabzulassen und zu jagen. Die Jagd versprach gut zu werden. Wir waren den ganzen Vormittag zwischen vereinzelten Robben hindurchgesegelt und liefen jetzt mitten in die Herde hinein.
Der Rauch war noch mehrere Meilen achternaus, näherte sich aber schnell, als wir die Boote hinabließen. Sie trennten sich und fuhren in nördlicher Richtung über das Meer. Hin und wieder sahen wir ein Segel niedergehen, hörten die Büchsen knallen und sahen die Segel wieder hochgehen. Es wimmelte von Robben. Der Wind legte sich ganz; alles schien einen großen Fang zu verkünden. Als wir ausliefen, um in Lee der Boote zu kommen, sahen wir, daß das Meer mit schlafenden Robben bedeckt war. Sie lagen da zu zweit, zu dritt, in ganzen Haufen, dichter, als ich sie je vorher gesehen, der Länge nach auf der Oberfläche ausgestreckt und fest schlafend, so sicher wie eine Schar träger junger Hunde.
Unter dem näherkommenden Rauche wurden jetzt Rumpf und Aufbau des Dampfers sichtbar. Es war die ›Macedonia‹. Ich las den Namen durch das Glas, als das Schiff uns, kaum eine Meile steuerbord, passierte. Wolf Larsen warf wilde Blicke auf den Dampfer, und Maud Brewster wurde neugierig.
»Was für Scherereien denken Sie zu bekommen, Kapitän?« fragte sie heiter.
Er blickte sie an, und ein freundlicher Blick huschte über seine Züge.
»Ja, was meinen Sie? Daß sie an Bord kommen und uns die Kehlen abschnitten?«
»Ja, etwas Derartiges«, gestand sie. »Die Robbenjäger sind ja etwas so Fremdes für mich, daß ich beinahe auf alles gefaßt bin.«
Er nickte. »Ganz recht, ganz recht. Sie haben sich nur geirrt, wenn Sie nicht das Schlimmste erwarteten.«
»Was kann denn noch schlimmer sein, als wenn einem die Kehle abgeschnitten wird?« fragte sie überrascht und mit kleidsamer Naivität.
»Wenn einem der Geldbeutel abgeschnitten wird«, antwortete er. »Die Menschen sind heutzutage so eingerichtet, daß ihre Lebensfähigkeit durch den Inhalt ihres Geldbeutels bestimmt wird.«
»Wer mir den Geldbeutel stiehlt, stiehlt wertlosen Plunder«, zitierte sie.
»Wer mir den Geldbeutel stiehlt, stiehlt mir das Recht, zu leben«, lautete seine Antwort. »Trotz aller Sprichwörter! Denn wer mir mein Geld stiehlt, stiehlt mir mein Brot, mein Fleisch, mein Bett und gefährdet daher mein Leben.«
»Aber ich kann nicht einsehen, wieso der Dampfer irgendwelche Absichten auf Ihren Geldbeutel haben sollte.«
»Warten Sie nur ab, dann werden Sie es schon sehen«, erwiderte er grimmig.
Wir brauchten nicht lange zu warten. Als die ›Macedonia‹ mehrere Meilen jenseits unserer Bootslinie war, begann sie, Boote auszusetzen. Wir wußten, daß sie vierzehn gegen unsere fünf hatte (eines war uns durch die Flucht Wainwrights abhanden gekommen), und sie begann damit weit in Lee unseres äußersten Bootes, kreuzte unsern Kurs und endete weit in Luv unseres ersten Luvbootes. Damit war die Jagd für uns verdorben. Hinter uns gab es keine Robben, und vor uns fegte die Linie der vierzehn Boote wie ein ungeheurer Besen die Herde vor sich hin.
Unsere Boote jagten über die paar Meilen zwischen der ›Macedonia‹ und ihren Booten und gingen dann zurück. Der Wind flüsterte nur noch leise, das Meer wurde immer ruhiger, und alles dies im Verein mit der großen Robbenherde machte den Tag zur Jagd wie geschaffen – es war einer der zwei oder drei ganz besonders bevorzugten Tage, die man in einer glücklichen Jagdsaison erwarten darf. Eine Schar zorniger Menschen, Puller, Steuerer und Jäger kletterte über die Reling. Jeder einzelne fühlte sich beraubt, und die Boote wurden unter Flüchen eingeholt, die Tod Larsen in alle Ewigkeit abgetan haben würden, wenn Flüche wirkliche Macht besäßen. »Tod und Verdammnis für ein Dutzend Ewigkeiten«, erklärte Louis und zwinkerte mir zu, als er sein Boot hochgeheißt und festgesurrt hatte.
»Hören Sie sie an und sagen Sie selbst, ob es schwer ist, den Lebensnerv ihrer Seele herauszufinden«, sagte Wolf Larsen. »Treue und Liebe? Hohe Ideale? Das Gute? Das Schöne? Das Wahre?«
»Ihr angeborener Rechtssinn ist gekränkt«, mischte Maud Brewster sich in die Unterhaltung.
»Sie sind sentimental,« höhnte er, »ebenso sentimental wie Herr van Weyden. Die Leute fluchen, weil ihre Wünsche durchkreuzt sind. Das ist alles. Was sie wünschen? Gutes Essen und weiche Betten, wenn sie an Land kommen und eine gute Löhnung erhalten – Weiber, Suff und Völlerei und das Tierhafte, das wahrlich das Beste in ihnen, ihr höchstes Ziel, ihr Ideal ist. Die Gefühle, die sie zeigen, sind wahrhaftig kein rührender Anblick, und doch sehen wir, wie tief diese Gefühle gehen, denn Hand an ihren Beutel, heißt Hand an ihre Seele legen.«
»Sie benehmen sich doch nicht so, als ob es Ihren Beutel betroffen hätte«, meinte sie lächelnd.
»Kann sein, daß ich mich anders benehme, denn es hat sowohl meinen Beutel wie meine Seele betroffen. Bei den derzeitigen Fellpreisen auf dem Londoner Markt und einer ungefähren Schätzung, was wir heute nachmittag gefangen hätten, wenn die ›Macedonia‹ es uns nicht weggeschnappt hätte, hat die ›Ghost‹ etwa 1500 Dollar eingebüßt.«
»Und das sagen Sie so ruhig –«, begann sie.
»Aber ich bin nicht ruhig; ich könnte den Mann töten, der mich beraubt hat«, unterbrach er sie. »Ja, ja, ich weiß, dieser Mann ist mein Bruder – wieder die alte Sentimentalität! Pah!«
Sein Gesicht veränderte sich plötzlich. Seine Stimme klang weniger barsch und ganz aufrichtig, als er jetzt sagte:
»Ihr müßt glücklich sein mit eurer Sentimentalität, wahrhaft glücklich, weil ihr vom Guten träumt und das Gute findet und deshalb selbst gut seid. Aber sagt, ihr beiden, findet ihr mich gut?«
»Sie sind gewissermaßen gut anzuschauen«, urteilte ich. »In Ihnen liegen alle Kräfte für das Gute«, lautete die Antwort Maud Brewsters.
»Da haben wir's!« rief er ärgerlich. »Leere Worte! Euer Gedanke, den ihr da aussprecht, ist unklar, unscharf und unbestimmt! Es ist in Wirklichkeit gar kein Gedanke. Es ist ein Gefühl, eine Empfindung, auf Illusionen aufgebaut, und entspringt nicht im geringsten eurem Intellekt.«
Während er sprach, wurde seine Stimme wieder sanfter und ein vertraulicher Klang kam in sie. »Wissen Sie, daß ich mich manchmal über dem Wunsch ertappe, auch blind für die Tatsachen des Lebens zu sein und nur seine Phantasien und Illusionen zu kennen. Die sind natürlich falsch, alle falsch und vernunftswidrig; aber jedesmal, wenn ich Angesicht zu Angesicht mit Ihnen stehe, sagt mir meine Vernunft, daß es doch die größte Freude sein muß, zu träumen und in Illusionen zu leben, und wenn sie noch so falsch sind! Und alles in allem ist die Freude ja doch der Lohn des Lebens. Ohne Freude ist das Leben wertloses Tun. Arbeiten und leben ohne Lohn ist schlimmer als tot sein. Wer der größten Freude fähig ist, lebt am stärksten, und eure Träume und Illusionen bereiten euch weniger Unruhe und befriedigen euch mehr als meine Tatsachen.«
Er schüttelte nachdenklich den Kopf.
»Ich zweifle oft, zweifle an dem Werte der Vernunft. Träume müssen wirklicher und befriedigender sein. Gefühlsmäßige Freude erfüllt mehr und währt länger als verstandesmäßige. Ich beneide Sie, beneide Sie!« Er schwieg, und sein Blick wanderte abwesend über sie hin und verlor sich auf dem ruhigen Meere. Die alte eingefleischte Schwermut senkte sich wieder über ihn, und er überließ sich ihr widerstandslos. Er hatte sich in eine Art Katzenjammer hineingeredet, und wir konnten sicher sein, daß in wenigen Stunden der Teufel in ihm wach wurde.
»Sie waren an Deck, Herr van Weyden,« sagte Larsen am nächsten Morgen beim Frühstück. »Wie sieht es aus?«
»Schön Wetter«, antwortete ich und blickte auf den Sonnenschein, der in die Kajüte hereinströmte. »Frische Brise aus West mit der Aussicht auf steifen Wind, wenn man Louis glauben kann.«
Er nickte vergnügt. »Anzeichen von Nebel?«
»Dichte Bänke in Nord und Nordwest.«
Er nickte wieder, anscheinend mit noch größerer Befriedigung als zuvor.
»Was Neues von der ›Macedonia‹?«
»Sie ist nicht zu sehen«, antwortete ich.
Ich hätte schwören mögen, daß sein Gesicht sich bei dieser Nachricht verdüsterte, aber den Grund seiner Enttäuschung konnte ich nicht erraten.
Ich sollte ihn indessen bald erfahren.
»Rauch ahoi!« ertönte es von Deck, und seine Züge erhellten sich wieder.
»Schön!« rief er aus und stand sofort auf, um sich an Deck und ins Zwischendeck zu begeben, wo die Jäger gerade ihr erstes Frühstück seit ihrer Vertreibung aus der Kajüte einnahmen.
Maud Brewster und ich berührten kaum die vor uns stehenden Speisen, wir starrten uns in stiller Besorgnis an und lauschten auf die Stimme Wolf Larsens, die gleich darauf das Schott zwischen Zwischendeck und Kajüte durchdrang. Er sprach lange, und seine Schlußworte wurden mit wildem Jubel begrüßt. Das Schott war zu dick, als daß wir ihn hätten verstehen können, was er aber auch gesagt haben mochte, so mußte es doch recht etwas nach dem Herzen der Jäger gewesen sein.
Aus dem Geräusch an Deck entnahm ich, daß die Matrosen herausgepurrt und im Begriff waren, die Boote hinabzulassen. Maud Brewster begleitete mich an Deck, aber ich ließ sie an der Achterhütte, von wo sie die Szene beobachten konnte, ohne selbst mitzuspielen. Die Matrosen mußten erfahren haben, was bevorstand, denn die Rührigkeit und Arbeitsfreudigkeit, die sie an den Tag legten, zeugten von Begeisterung. Die Jäger erschienen an Deck mit ihren Gewehren und Munitionskasten und – was ganz ungewöhnlich war – ihren Kugelbüchsen. Diese wurden sehr selten mit in die Boote genommen, denn wenn eine Robbe auf weite Entfernung mit der Büchse geschossen wurde, sank sie unweigerlich, ehe das Boot sie erreichen konnte. Aber heute nahm jeder Jäger seine Büchse und einen großen Vorrat an Patronen mit. Ich bemerkte, wie sie vergnügt grinsten, als sie den Rauch der ›Macedonia‹ erblickten, der immer höher stieg, je mehr sie sich von Westen näherte.
Die fünf Boote gingen wie der Wind über Bord, breiteten sich fächerförmig aus und setzten, wie am vergangenen Nachmittag, den Kurs nach Norden. Ich beobachtete sie eine Zeitlang gespannt, aber es war nichts Ungewöhnliches an ihnen zu bemerken. Sie ließen die Segel nieder, schossen Robben, heißten die Segel wieder und setzten ihren Weg fort, wie ich es immer hatte tun sehen. Die ›Macedonia‹ wiederholte ihr gestriges Manöver, indem sie ihre Boote vor den unseren und quer über unserm Kurs aussetzte. Vierzehn Boote erfordern ein ausgedehntes Gebiet, um bequem jagen zu können, und als die ›Macedonia‹ uns vollkommen abgeschlossen hatte, fuhr sie weiter nordwestlich, indem sie immer noch Boote aussetzte.
»Was haben Sie vor?« fragte ich Wolf Larsen, ganz unfähig, meine Neugier noch länger im Zaum halten zu können.
»Lassen Sie das meine Sorge sein«, antwortete er barsch. »Es wird keine tausend Jahre dauern, bis Sie es wissen. Beten Sie nur, daß wir guten Wind bekommen.«
»Übrigens kann ich es Ihnen auch gern erzählen«, sagte er einen Augenblick später. »Ich will meinem Bruder eine Dosis seiner eigenen Medizin verabreichen. Kurz, ich will ihm selbst mal den Fang ausspannen, und nicht nur für einen Tag, sondern für den ganzen Rest der Fangzeit – wenn wir Glück haben.«
»Und wenn wir keines haben?« fragte ich.
»Gar nicht auszudenken!« lachte er. »Wir müssen einfach Glück haben, sonst sind wir glatt geliefert.« Er stand am Rad, und ich ging nach meinem Lazarett in der Back, wo die beiden zu Schaden Gekommenen, Nilson und Mugridge, lagen. Nilson fühlte sich so wohl, wie man nur erwarten konnte, denn sein gebrochenes Bein heilte ausgezeichnet; der Cockney aber war niedergeschlagen und verzweifelt, und ich hatte das größte Mitleid mit dem unglücklichen Menschen. Es war ein reines Wunder, daß er noch lebte und am Leben hing. Die grausamen Jahre hatten seinen ausgemergelten Körper zu einem zersplitterten Wrack gemacht, und doch brannte der Lebensfunke in ihm so hell wie nur je.
»Mit einem künstlichen Fuß – man verfertigt jetzt ganz ausgezeichnete – kannst du bis ans Ende der Zeiten in Schiffskombüsen herumlaufen«, versicherte ich ihm freundlich.
Aber seine Antwort war ernst, ja fast feierlich. »Ich weiß nicht, ob es stimmt, was Sie sagen, Herr van Weyden, aber eines weiß ich: Ich werde keine glückliche Stunde haben, bis dieser Höllenhund tot zu meinen Füßen liegt. Er kann nicht so lange leben wie ich. Er hat kein Recht zu leben, und wenn das alte Wort sagt, daß er sicher sterben muß, so sage ich ›Amen‹ und ›möglichst bald!‹ dazu.«
Als ich wieder an Deck zurückkehrte, fand ich Wolf Larsen mit einer Hand steuernd und mit der andern ein Seeglas haltend und die Lage der Boote studierend, wobei er der ›Macedonia‹ besondere Aufmerksamkeit schenkte. Die einzige Veränderung an unsern Booten war, daß sie jetzt dicht am Winde lagen und mehrere Striche West zu Nord vorgerückt waren. Ich konnte aber noch nicht die Zweckmäßigkeit dieses Manövers einsehen, denn sie waren immer noch durch die fünf Luvboote der ›Macedonia‹, die sich ebenfalls dicht an den Wind gelegt hatten, vom offenen Meere abgeschnitten. Die zogen auf diese Weise langsam nach Westen und legten einen immer größeren Abstand zwischen sich und die übrigen Boote in der Linie. Auf unsern Booten wurden neben den Segeln auch die Riemen gebraucht. Selbst die Jäger pullten, und so überholten sie bald den – ich kann es wohl so nennen – Feind.
Der Rauch der ›Macedonia‹ war zu einem trüben Fleck am nordöstlichen Horizont eingeschrumpft. Vom Dampfer selbst war nichts zu sehen. Wir hatten uns bis jetzt, teilweise mit im Winde schlagenden Segeln, treiben lassen; zweimal hatten wir, mit kurzem Zwischenraum, beigelegt. Jetzt aber wurde es anders. Die Segel wurden getrimmt, und bald hatte Wolf Larsen die ›Ghost‹ in volle Fahrt gebracht. Wir liefen an unsern Booten vorbei und hielten auf das erste Luvboot der andern Linie.
»Runter mit dem Außenklüver, Herr van Weyden«, befahl Wolf Larsen. »Und halten Sie sich bereit, den Klüver herüberzuholen!«
Ich lief nach vorn und hatte den Außenklüver eben eingeholt, als wir einige hundert Fuß in Lee an dem Boot vorbeischossen. Die drei Insassen betrachteten uns mißtrauisch. Sie wußten, daß sie uns die Jagd verdorben hatten, und sie kannten Wolf Larsen jedenfalls dem Namen nach. Ich bemerkte, wie der Jäger, ein mächtiger Skandinavier, der im Bug saß, das Gewehr schußbereit über den Knien hielt – es hätte eigentlich an der Nagelbank hängen müssen. Als wir sie gerade hinter unserm Achtersteven hatten, winkte Wolf Larsen ihnen mit der Hand zu und rief:
»Kommt zu einem Schwätzchen an Bord.«
›Schwätzchen‹ bedeutet unter Robbenjägern soviel wie ›Besuch‹, ›Unterhaltung‹. Es bezeichnet die Schwatzlust der Seeleute und ist eine angenehme Unterbrechung des einförmigen Lebens auf diesen Schiffen.
Die ›Ghost‹ drehte sich in den Wind, und da ich gerade meine Arbeit vorn beendet hatte, lief ich nach achtern, um bei der Großschoot zu helfen.
»Sie sind wohl so freundlich, an Deck zu bleiben, Fräulein Brewster«, sagte Wolf Larsen, indem er nach vorn schritt, um seine Gäste zu begrüßen. »Und Sie auch, Herr van Weyden.«
Das Boot hatte seine Segel eingeholt und legte sich neben uns. Der Jäger, goldbärtig wie ein alter Seekönig, kletterte über die Reling an Deck. Aber trotz seinem riesigen Wuchse konnte er offenbar seine Furcht kaum verbergen. Zweifel und Mißtrauen zeigten sich deutlich auf seinen Zügen. Es war trotz seinem behaarten Schild ein offenes Gesicht, dem man sofort die Erleichterung ansah, als er Wolf Larsen und mich sah und sich klar wurde, daß er es nur mit zweien zu tun hatte. Unterdessen waren auch seine beiden Leute an Bord gekommen, und nun hatte er kaum Grund, sich zu fürchten. Er überragte Wolf Larsen wie ein Goliath. Er mußte wenigstens sechs Fuß und neun Zoll messen und wog – wie ich später erfuhr – zweihundertundvierzig Pfund. Und es war kein Fett an ihm. Alles nur Knochen und Muskeln!
Sein Argwohn erwachte indessen wieder, als Wolf Larsen ihn einlud, mit in die Kajüte zu kommen. Aber ein Blick auf seinen Wirt beruhigte ihn wieder. War der auch gewiß ein starker Mann, so erschien er doch neben diesem Riesen wie ein Zwerg. So schwanden denn seine Bedenken, und die beiden stiegen miteinander in die Kajüte hinab. Seine beiden Leute waren unterdessen nach Seemannsbrauch in die Back gegangen, um dort einen Besuch abzustatten.
Plötzlich ertönte ein entsetzliches Gebrüll aus der Kajüte, gefolgt von dem Getöse eines wütenden Kampfes. Der Leopard und der Löwe kämpften miteinander. Wolf Larsen war der Leopard.
»Da sehen Sie, wie heilig die Gastfreundschaft hier gehalten wird«, sagte ich bitter zu Maud Brewster. Sie nickte, um zu zeigen, daß sie hörte, und ich las in ihrem Gesicht, daß sie bei dem Geräusch des heftigen Kampfes ebenso litt, wie ich es bei derartigen Gelegenheiten in den ersten Wochen meines Aufenthaltes auf der ›Ghost‹ getan hatte.
»Wäre es nicht besser, wenn Sie nach vorn gingen – etwa zur Zwischendeckskappe – bis es vorbei ist?« schlug ich ihr vor.
Sie schüttelte den Kopf und sah mich mit einem mitleiderregenden Blick an. Sie fürchtete sich nicht, war aber entsetzt über diese menschliche Bestialität.
»Sie werden begreifen,« nahm ich die Gelegenheit wahr, »daß ich nur geringen Anteil an den Vorgängen an Bord nehme. – Es ist nicht schön für mich«, fügte ich hinzu.
»Ich verstehe Sie«, sagte sie mit schwacher Stimme, die klang, als käme sie aus weiter Ferne, und ihre Augen zeigten mir, daß sie mich verstand.
Das Getöse unten erstarb bald. Kurz darauf kam Wolf Larsen allein an Deck. Sein braunes Gesicht war leicht gerötet, sonst aber hatte der Kampf keine Spuren bei ihm hinterlassen.
»Schicken Sie die beiden Leute nach achtern, Herr van Weyden«, sagte er.
Ich gehorchte, und wenige Minuten später standen sie vor ihm.
»Holt euer Boot ein,« sagte er zu ihnen, »euer Jäger hat sich entschlossen, eine Weile an Bord zubleiben, und möchte nicht, daß es längsseits zerstoßen wird. – Holt euer Boot herein, sage ich«, wiederholte er schärfer, als sie zögerten, seinem Befehl Folge zu leisten.
»Wer weiß? Vielleicht werdet ihr eine Zeitlang mit mir fahren«, sagte er ganz freundlich, aber mit einem leisen, drohenden Klang, der seine Freundlichkeit Lügen strafte, als sie sich langsam in Bewegung setzten, um zu gehorchen. »Es ist schon am besten, wenn wir uns gleich freundschaftlich verständigen. Ein bißchen flink nun! Tod Larsen läßt euch ganz anders springen, das wißt ihr gut!«
Unter seiner Anleitung wurden ihre Bewegungen merklich schneller, und als das Boot über Bord schwang, wurde ich nach vorn geschickt, um den Klüver hochgehen zu lassen. Wolf Larsen stand am Rade und steuerte die ›Ghost‹ auf das zweite Luvboot der ›Macedonia‹.
Vorläufig gab es nichts für mich zu tun, und so wandte ich meine Aufmerksamkeit den Booten zu. Das dritte Luvboot der ›Macedonia‹ wurde von zweien der unsrigen angegriffen, das vierte von unsern andern drei, während das fünfte kehrtgemacht hatte; um seinem nächsten Gefährten zu Hilfe zu kommen. Die Schlacht war auf weite Entfernung eröffnet, und die Büchsen knallten unaufhörlich. Kurze, kräftige Seen, vom Winde aufgepeitscht, hinderten ein sicheres Schießen, und hin und wieder sahen wir beim Näherkommen die Kugeln von Welle zu Welle tanzen.
Das Boot, das wir verfolgten, hatte sich vor den Wind gelegt und versuchte, uns zu entwischen. Es nahm die Richtung auf die anderen Boote, um ihnen zu helfen, den allgemeinen Angriff zurückzuschlagen.
Da ich Segel und Schoote bediente, blieb mir wenig Zeit zu sehen, was vorging, als ich aber zufällig auf der Achternhütte war, hörte ich, wie Wolf Larsen den beiden fremden Matrosen befahl, sich nach vorn in die Back zu begeben. Sie gingen widerstrebend, aber sie gingen. Dann schickte er Fräulein Brewster hinunter und lächelte, als er den erschrockenen Ausdruck in ihren Augen sah.
»Sie werden nichts Schauerliches unten finden,« sagte er, »nur einen Mann, der sicher am Ringbolzen festgemacht, sonst aber unverletzt ist. Es ist möglich, daß Kugeln an Bord fliegen, und ich möchte nicht, daß Sie getötet werden.«
Er hatte noch nicht ausgesprochen, als eine Kugel zwischen seinen Händen hindurch gegen eine Messingspake des Steuerrades schlug und luvwärts durch die Luft pfiff.
»Da sehen Sie!« sagte er zu ihr, dann wandte er sich zu mir: »Herr van Weyden, wollen Sie das Rad nehmen.«
Maud Brewster war auf die Laufbrücke getreten, so daß nur ihr Kopf ausgesetzt war. Wolf Larsen hatte sich eine Büchse geholt und schob jetzt eine Patrone in den Lauf. Ich bat sie durch einen Blick, nach unten zu gehen, aber sie lächelte und sagte:
»Wir mögen ja schwache Landratten sein, die kaum auf eigenen Füßen zu stehen vermögen, aber wir können Kapitän Larsen wenigstens zeigen, daß wir tapfer sind.«
Er warf ihr einen schnellen bewundernden Blick zu. »Dafür gefallen Sie mir um hundert Prozent besser«, sagte er. »Bücher, Verstand und Mut. Sie sind wirklich vollkommen, trotz Ihrer Gelehrsamkeit, wert, das Weib eines Seeräuberhäuptlings zu sein. Na, darüber werden wir später reden«, lächelte er, als eine Kugel in die Kajütswand schlug.
Ich sah, während er sprach, den goldenen Schimmer in seinen Augen und das Entsetzen in den ihren.
»Wir sind tapfer«, beeilte ich mich zu sagen. »Ich für meinen Teil wenigstens weiß, daß ich tapferer bin als Kapitän Larsen.«
Jetzt beehrte er mich durch einen schnellen Blick. Machte ich mich über ihn lustig? Ich drehte das Rad einige Spaken weiter, um ein Gieren der ›Ghost‹ gegen den Wind zu verhindern, und machte es fest. Wolf Larsen wartete noch auf eine Erklärung von mir, und ich wies auf meine Knie herab.
»Sie werden hier«, sagte ich, »ein leises Zittern bemerken. »Das kommt daher, daß ich mich fürchte, mein Fleisch fürchtet sich, und meine Seele fürchtet sich, weil ich nicht sterben möchte. Aber mein Wille bemeistert das zitternde Fleisch und die ängstliche Seele. Ich bin mehr als tapfer – ich bin ein Held. Ihr Fleisch hingegen fürchtet sich nicht. Sie haben keine Furcht. Nicht nur kostet es Sie nichts, der Gefahr zu begegnen, es macht Ihnen sogar Freude. Ganz sicher sind Sie ein unerschrockener Mann, Herr Larsen, aber Sie müssen mir einräumen, daß ich der Mutigere von uns beiden bin.«
»Sie haben recht«, gab er sofort zu. »Von dieser Seite habe ich es noch nie angesehen. Aber ist dann das Gegenteil richtig? Wenn Sie mutiger sind als ich, bin ich dann feiger als Sie?«
Wir lachten beide über diese Absurdität, und er ließ sich aufs Deck nieder und legte seine Büchse auf die Reling. Die Kugeln, die wir bisher erhielten, hatten fast eine halbe Meile zurückzulegen gehabt, inzwischen hatte sich aber dieser Abstand auf die Hälfte verkürzt. Er zielte sorgsam und schoß dreimal. Der erste Schuß ging fünfzig Fuß in Luv des Bootes vorbei, der zweite dicht daneben, und beim dritten ließ der Bootssteurer das Ruder los und sank auf dem Boden des Bootes zusammen.
»Ich wette, das genügt«, sagte Wolf Larsen, indem er sich erhob. »Ich kann es mir nicht leisten, den Jäger zu treffen, und ich rechne damit, daß der Puller nicht steuern kann. Der Jäger kann nicht steuern und schießen zugleich.«
Seine Berechnung erwies sich als richtig, denn das Boot drehte sich sofort in den Wind, und der Jäger sprang nach achtern, um den Platz am Ruder einzunehmen. Wir merkten nichts mehr von der Schießerei, wenn auch die Büchsen von den andern Booten noch munter knallten.
Es war dem Jäger geglückt, das Boot wieder in den Wind zu bringen, aber wir machten ungefähr doppelt soviel Fahrt. Als wir noch etwa hundert Schritt entfernt waren, sah ich, wie der Puller dem Jäger eine Büchse reichte. Wolf Larsen begab sich mittschiffs und nahm eine Rolle Tauwerk vom Bolzen des Klaufalls. Dann lugte er mit erhobener Büchse über die Reling. Zweimal sah ich den Jäger mit einer Hand das Ruder loslassen und zur Büchse greifen – aber jedesmal bedachte er sich wieder. Dann waren wir neben ihnen und schossen schäumend vorbei.
»Hier!« rief Wolf Larsen plötzlich dem Puller zu. »Fang das Ende!«
Gleichzeitig warf er das Tau. Er traf so gut, daß es den Mann beinahe zu Boden riß, der aber gehorchte nicht, sondern blickte den Jäger an, um dessen Befehle abzuwarten. Der Jäger seinerseits bedachte sich einen Augenblick. Er hatte die Büchse zwischen den Knien, wenn er aber das Ruder losließ, um zu schießen, mußte das Boot herumgeworfen werden und mit dem Schoner zusammenstoßen. Dazu sah er die Büchse Wolf Larsens auf sich gerichtet und wußte, daß jener schießen würde, ehe er selbst auch nur das Gewehr an die Backe gebracht hätte. »Nimm es«, sagte er zu dem Puller.
Der gehorchte, indem er das Tau um die vordere Ducht wand. Es straffte sich, das Boot gierte plötzlich, und der Jäger brachte es, einige zwanzig Fuß entfernt, parallel zur ›Ghost‹.
»Jetzt das Segel 'runter, und dann kommt längsseits!« befahl Wolf Larsen.
Er behielt die Büchse in der Hand und ließ die Takel mit der andern hinab. Als Bug und Steven festgemacht waren, und die beiden Männer sich anschickten, an Bord zu kommen, nahm der Jäger seine Büchse, als ob er sie an einen sichern Platz stellen wollte.
»Fallen lassen!« rief Wolf Larsen, und der Jäger gehorchte, als ob sie glühend wäre.
Einmal an Bord, holten die beiden Gefangenen das Boot ein und trugen auf Wolf Larsens Anweisung den verwundeten Bootssteurer in die Back.
»Wenn unsere fünf Boote ebenso tüchtig sind, wie Sie und ich, werden wir eine hübsche Mannschaft zusammenbekommen«, sagte Wolf Larsen zu mir.
»Der Mann, den Sie getroffen haben – ich hoffe, er ist – –«, sagte Maud Brewster zitternd.
»Schulterschuß!« antwortete er. »Nichts Ernstes. Herr van Weyden wird ihn in drei bis vier Wochen wieder auf die Beine bringen.
Aber die da drüben wird er allem Anschein nach kaum durchbringen«, fügte er hinzu und wies auf das dritte Boot der ›Macedonia‹, auf das ich jetzt lossteuerte, und das sich beinahe in der gleichen Höhe wie wir befand. »Das ist Horners und Smokes Arbeit Ich habe ihnen gesagt, daß ich lebendige Männer brauche und keine Leichen. Aber die Freude am Treffen ist eine zu große Versuchung, wenn man erst einmal Schießen gelernt hat. Haben Sie es je versucht, Herr van Weyden?«
Ich schüttelte den Kopf und betrachtete ihr Werk. Es war in der Tat blutig gewesen, und jetzt waren sie einfach weitergefahren und hatten sich unsern anderen drei Booten bei ihrem Angriff auf die übrigen Feinde angeschlossen. Das sich selbst überlassene Boot lag in einem Wellental und rollte wie trunken über den Schaum, während das lose Sprietsegel im rechten Winkel herausstak und im Winde flatterte. Jäger und Puller lagen hilflos auf dem Boden, der Steurer jedoch lag quer über dem Schandeckel, halb über der Reling, seine Arme schleiften das Wasser, und sein Kopf rollte von einer Seite zur andern.
»Sehen Sie nicht hin, Fräulein Brewster, bitte, sehen Sie nicht hin«, flehte ich sie an und war froh, daß sie mir folgte, und daß ihr dieser Anblick erspart blieb. »Halten Sie gerade auf den Haufen los, Herr van Weyden!« befahl Wolf Larsen.
Als wir näher kamen, hatte das Feuer aufgehört, und wir sahen, daß der Kampf vorbei war. Die beiden letzten Boote waren von unsern fünf erbeutet worden, und alle sieben lagen jetzt zusammengedrängt da und warteten darauf, von uns aufgenommen zu werden.
»Sehen Sie dort!« rief ich unwillkürlich, indem ich nach Nordwest wies.
»Ja, ich hab' es gesehen«, erwiderte Wolf Larsen ruhig. Er maß die Entfernung zur Nebelbank und blieb einen Augenblick stehen, um die Stärke des Windes an seiner Backe zu fühlen. »Ich denke, wir schaffen es. Aber Sie können sich darauf verlassen, daß mein teurer Bruder uns auf die Sprünge gekommen ist und gerade auf uns losgeht. Schauen Sie nur!«
Der Rauchfleck wuchs plötzlich und war sehr schwarz. »Ich werde schon noch mit dir fertig, und wenn du zehnmal mein Bruder bist!« frohlockte er. »Du kannst froh sein, wenn deine alte Maschine nicht in tausend Stücke springt.«
Als wir beilegten, löste sich das scheinbare Wirrwarr. Die Boote verteilten sich auf beide Seiten, und die Leute kamen gleichzeitig an Bord. Sobald die Gefangenen über die Reling geklettert waren, wurden sie von unsern Jägern in die Back geschafft, während unsere Matrosen die Boote einholten, sie in wirrem Durcheinander auf Deck fallen ließen und sich nicht einmal Zeit nahmen, sie festzusurren. Wir waren schon in voller Fahrt; als das letzte Boot aus dem Wasser gehoben wurde und über die Reling schwang, waren bereits alle Segel gesetzt.
Eile tat denn auch not. Die ›Macedonia‹, deren Schlot schwärzesten Rauch ausstieß, kam aus Nordwest herangejagt. Ohne die Boote, die ihr geblieben waren, zu beachten, hatte sie ihren Kurs so gesetzt, daß sie uns überholen mußte. Sie fuhr nicht gerade auf uns los, sondern ihr Kurs bildete einen spitzen Winkel zu dem unseren, und wir mußten uns gerade am Rande der Nebelbank treffen. Dort oder nirgends konnte die ›Macedonia‹ hoffen, uns zu fangen. Die einzige Rettung der ›Ghost‹ wiederum war, diesen Punkt vor der ›Macedonia‹ zu erreichen.
Wolf Larsen steuerte. Seine Augen funkelten und blitzten, während sie von einem zum andern sprangen. Bald durchforschte er die See in Luv nach Anzeichen, ob der Wind sich legte oder auffrischte, bald blickte er nach der ›Macedonia‹ dann wieder schweiften seine Augen über die Segel, und er gab Befehl, hier eine Leine zu lockern, dort eine anzuziehen, bis er aus der ›Ghost‹ alles herausholte, was sie zu leisten vermochte. Aller Streit, aller Groll war vergessen, und ich war erstaunt über die Bereitwilligkeit, mit der die Mannschaft, die so lange seine Brutalität erduldet hatte, jetzt seine Befehle ausführte. Seltsam: ich mußte an den unglücklichen Johnson denken, und als wir uns so über die Wellen hoben und ganz auf die Seite legten, wurde ich mir eines Bedauerns bewußt, daß er jetzt nicht am Leben und mit dabei war. Er hatte die ›Ghost‹ so geliebt, und ihre Manövrierfähigkeit hatte ihn so begeistert.
»Holt lieber eure Gewehre, Jungens«, rief Wolf Larsen unsern Jägern zu, und die fünf Mann stellten sich, die Büchsen in der Hand, an die Leereling und warteten.
Die ›Macedonia‹ war jetzt nur noch eine Meile entfernt, der schwarze Rauch wälzte sich im rechten Winkel aus ihrem Schornstein, so wahnsinnig durchpflügte sie mit ihrer Fahrt von siebzehn Knoten die Wogen. – – »Heulend durchs Meer!« zitierte Wolf Larsen, während er auf sie blickte. Wir schafften nicht mehr als neun Knoten, aber die Nebelbank war jetzt ganz nahe. Ein Rauchballen löste sich vom Deck der ›Macedonia‹. Wir hörten einen schweren Knall, und in unserm Großsegel zeigte sich ein rundes Loch. Sie schossen auf uns mit einer der kleinen Kanonen, die sie dem Gerücht nach an Bord hatten. Unsere Leute, die mittschiffs in einem Haufen zusammenstanden, schwangen die Mützen und erhoben ein Hohngeschrei. Wieder ein großer Rauchballen und ein lauter Knall. Diesmal ging die Kugel nicht mehr als zwanzig Fuß achtern vorbei und tanzte zweimal in Luv von Welle zu Welle, ehe sie versank.
Mit Gewehren wurde nicht geschossen aus dem einfachen Grunde, weil alle Jäger der ›Macedonia‹ entweder in den Booten oder unsere Gefangenen waren. Als der Abstand zwischen den beiden Fahrzeugen noch eine halbe Meile betrug, riß ein dritter Schuß ein zweites Loch in unser Großsegel. Dann verschwanden wir im Nebel. Er legte sich um uns und verbarg uns mit dichten, feuchten Schleiern.
Der plötzliche Übergang wirkte erschreckend. Eben noch waren wir in dem klaren Sonnenschein, mit dem blauen Himmel über uns, gesegelt, während die Wogen weit bis zum Horizont rollten und sich brachen und ein Schiff sich, Rauch, Feuer und eiserne Geschosse speiend, wie toll auf uns losstürzte. Und auf einmal, nur den Bruchteil einer Sekunde später, war die Sonne ausgelöscht, es gab keinen Himmel mehr, selbst unsere Mastspitzen waren dem Blick entzogen, und unser Horizont war so, wie ihn tränenverschleierte Augen sehen mögen. Der graue Nebel trieb wie feiner Sprühregen an uns vorbei. Jedes Wollfäserchen an unsern Kleidern, jedes Härchen auf unserm Kopfe und in unserm Gesicht war mit kristallenen Kügelchen wie mit Juwelen besetzt. Die Wanten troffen vor Nässe; es tropfte von dem Tauwerk über uns, und an der Unterseite der Spieren nahmen die Tropfen die Form langer fließender Reihen an, die sich bei jedem Überholen des Schoners loslösten und wie ein Sturzregen auf das Deck geschleudert wurden. Ich hatte ein Gefühl des Eingesperrtseins und Erstickens. Wie das Geräusch, das das Schiff bei seinem Stampfen durch die Wogen machte, von dem Nebel zurückgeworfen wurde, so auch die Gedanken. Der Geist bebte zurück vor der Betrachtung einer Welt jenseits der Schleier, die uns umschlossen. Dies war die Welt, das Universum selbst, seine Grenzen waren so eng, daß es einem verlangte, beide Arme auszustrecken und sie zurückzustoßen. Alles andere war nur ein Traum, ja nichts als Erinnerung an einen Traum.
Es war unheimlich, geisterhaft. Ich sah Maud Brewster an und fühlte, daß es ihr ähnlich ging. Dann sah ich auf Wolf Larsen, aber auf ihn schien es keinen Eindruck zu machen. Sein ganzes Interesse galt lediglich der Gegenwart und ihren Erfordernissen. Er stand immer noch am Steuerrade, und ich fühlte, daß er die Zeit maß, den Lauf der Minuten nach jeder Bewegung, jedem Überkrengen der ›Ghost‹ nach Lee berechnete. »Gehen Sie nach vorn und halten Sie hart an den Wind, aber ohne Lärm«, sagte er leise zu mir. »Holen Sie zuerst die Toppsegel ein. Stellen Sie an alle Schoote Leute. Aber kein Rasseln von Blöcken und kein lautes Wort. Keinen Lärm, hören Sie, keinen Lärm!«
Als alles bereit war, wurde der Befehl »Hart an den Wind!« von Mann zu Mann weitergegeben, bis er mich erreichte; und die ›Ghost‹ schwang sich wirklich fast geräuschlos um die Backbord-Halsen herum. Das einzige, was man hörte – einige Seisinge, die im Winde flatterten, ein paar Böcke, die knarrten, eine Rolle, die kreischte –, wurde geisterhaft von der schweren Decke, die uns einhüllte, zurückgeworfen.
Wir waren kaum mit dem Manöver fertig, als der Nebel sich plötzlich zu verdünnen schien, wir uns wieder im Sonnenschein befanden, und das Meer bis zum Horizont ausgebreitet vor uns lag. Aber der Ozean war leer. Keine zornige ›Macedonia‹ durchbrach die Fläche oder verdunkelte den Himmel mit ihrem Rauch. Wolf Larsen braßte sofort vierkant und lief am Rande der Nebelbank entlang. Seine Absicht war einleuchtend. Er war in Luv des Dampfers in den Nebel gegangen, und während die ›Macedonia‹ um ihn zu fangen, blind hineingestoßen war, hatte er jetzt sein Versteck verlassen, um es auf der Leeseite wieder aufzusuchen. Glückte sein Plan, so wäre das alte Gleichnis von der Stecknadel im Heuschober schwach gewesen neben der Aussicht seines Bruders, ihn zu finden. Es sollte jedoch nicht lange dauern. Wir hatten Fock und Großsegel gejibbt, jetzt setzten wir die Toppsegel und fuhren wieder in den Nebel hinein. Während wir hineintauchten, hätte ich darauf schwören mögen, in Luv einen schwarzen Rumpf gesehen zu haben. Ich warf einen raschen Blick auf Wolf Larsen. Schon waren wir im Nebel begraben, aber er nickte. Auch er hatte es gesehen – die ›Macedonia‹ hatte sein Manöver erraten, und auf ein Haar hätte sie uns überrumpelt. Es war das Werk eines Augenblicks gewesen, aber kein Zweifel: wir waren ungesehen entwischt.
»Das kann er so nicht weitermachen«, sagte Wolf Larsen. »Er muß umkehren, schon seiner Boote wegen. Schicken Sie einen Mann ans Rad, Herr van Weyden, halten Sie vorläufig diesen Kurs, und dann können Sie die Wachen verteilen. Wir werden uns diese Nacht nicht viel Ruhe gönnen können.
Aber ich hätte doch fünfhundert Dollar gegeben,« fügte er hinzu, »um nur fünf Minuten an Bord der ›Macedonia‹ zu sein und meinen Bruder fluchen zu hören.«
»Und nun, Herr van Weyden,« sagte er zu mir, als er beim Rad abgelöst war, »müssen wir unsere neuen Leute bewillkommnen! Geben Sie den Jägern recht viel Whisky und sorgen Sie dafür, daß auch einige Flaschen nach vorn kommen. Ich möchte wetten, daß morgen alle bis auf den letzten Mann umgestimmt sind und ebenso gern für Wolf Larsen jagen, wie bisher für Tod Larsen.«
»Aber werden sie nicht durchbrennen, wie Wainwright?« fragte ich.
Er lachte verschmitzt. »Nicht, solange unsere alten Jäger ein Wörtchen mitzureden haben. Für jedes Fell, das die neuen Jäger schießen, gebe ich ihnen einen Dollar zur Teilung. Wenigstens die Hälfte ihres Jubels heute morgen ist auf das Konto dieses Versprechens zu schreiben. Oh, wenn es auf sie ankommt, wird niemand durchbrennen. Und nun wäre es am besten, wenn Sie nach vorn gingen und Ihren Lazarettdienst verrichteten. Eine stattliche Anzahl Patienten wartet auf Sie.«
Wolf Larsen entschloß sich, die Verteilung des Whiskys selbst vorzunehmen, und während ich in der Back mit einem frischen Trupp Verwundeter beschäftigt war, begannen die Flaschen in die Erscheinung zu treten. Ich hatte schon in meinem Leben Whisky trinken sehen, wie man ihn in den Klubs trank: etwas Whisky mit Sodawasser, aber nie, wie diese Männer ihn tranken: aus Konservendosen, aus Krügen und Flaschen in unendlichen Zügen, deren jeder an sich schon eine Ausschweifung war. Und sie begnügten sich nicht mit einem oder zweien. Sie tranken und tranken, und immer mehr Flaschen wanderten nach vorn, und immer mehr tranken sie. Alle tranken. Die Verwundeten tranken; Oofty-Oofty, der mir half, trank. Nur Louis hielt sich zurück, er befeuchtete sich die Lippen nur ganz vorsichtig, stimmte aber in den allgemeinen Lärm mit ein wie der Schlimmste von ihnen. Es war eine zügellose Schwelgerei. Mit lauter Stimme erörterten sie die Kämpfe des Tages, stritten sich über Einzelheiten oder wurden zärtlich und schlossen Freundschaft mit denen, gegen die sie gekämpft hatten, Gefangene wie Sieger sanken sich in die Arme und schworen sich schluckend mit mächtigen Flüchen gegenseitig ihre Hochachtung und Wertschätzung. Sie weinten über das Elend, das sie durchgemacht hatten, wie über das, was noch kommen mußte unter der eisernen Fuchtel Wolf Larsens. Und jeder verfluchte ihn und erzählte schreckliche Geschichten von seiner Brutalität.
Es war ein seltsamer und schrecklicher Anblick, der kleine, von Kojen eingerahmte Raum, dessen Boden und Wände hüpften und schwankten, das trübe Licht, in dem die schwingenden Schatten sich ungeheuerlich verlängerten und verkürzten, die rauchgeschwängerte Luft, der Geruch der Körper und des Jodoforms und der Anblick der erregten Menschen – oder Halbmenschen, wie ich sie lieber nennen sollte. Ich beobachtete Oofty-Oofty, der das Ende einer Bandage hielt und auf das Schauspiel blickte. Seine samtenen, strahlenden Augen glitzerten wie die eines Rehs, und doch wußte ich, daß ein barbarischer Teufel in seiner Brust schlummerte, der alle Sanftheit und die fast frauenhafte Weichheit in seinen Zügen und seiner Gestalt Lügen strafte. Und ich bemerkte das knabenhafte Gesicht Harrisons – sonst ein gutes Gesicht, jetzt aber das eines Teufels, verkrampft von Leidenschaft, als er den neuen Kameraden von dem Höllenschiff erzählte, auf dem sie sich befanden, und Flüche auf das Haupt Wolf Larsens herabregnen ließ. –
Wolf Larsen war es, immer Wolf Larsen, der seine Mitmenschen unterjochte und peinigte, eine männliche Circe er, und sie seine Schweine, leidende Tiere, die vor ihm krochen und sich nur heimlich in der Trunkenheit gegen ihn auflehnten. War ich nicht auch wie sie? Und Maud Brewster? Nein! Ich knirschte vor Wut mit den Zähnen, bis der Mann, den ich verband, unter meiner Hand zusammenzuckte und Oofty-Oofty mich neugierig anblickte. Ich fühlte mich plötzlich von mächtiger Kraft beseelt. Etwas in meiner neuentdeckten Liebe machte mich zum Riesen. Ich fürchtete nichts mehr. Ich mußte meinen Willen durchsetzen können trotz meinen fünfunddreißig, hinter Büchern verbrachten Jahren. Und so, außer mir, hochgehoben von einem starken Machtgefühl, stieg ich an Deck, wo der Nebel geisterhaft durch die Nacht trieb und die Luft süß, rein und still war.
Das Zwischendeck, wo die beiden verwundeten Jäger lagen, war eine Wiederholung der Back, nur, daß hier nicht auf Wolf Larsen geflucht wurde, und mit großer Erleichterung erschien ich wieder an Deck und ging nach achtern in die Kajüte. Das Abendbrot war bereit, und Wolf Larsen und Maud warteten auf mich.
Während Wolf Larsens Mannschaft sich so schnell und gründlich wie möglich betrank, blieb er selbst nüchtern. Nicht ein Tropfen Schnaps kam über seine Lippen. Unter den jetzigen Umständen wagte er es nicht, und er hatte niemand, auf den er sich verlassen konnte, außer Louis und mir, und Louis stand am Rade. Wir segelten weiter durch den Nebel, ohne Ausguck und ohne Lichter. Daß Wolf Larsen den Whisky auf seine Leute losgelassen hatte, wunderte mich, aber er kannte sie und das Geheimnis, in Freundschaft zusammenzukitten, was mit Blutvergießen begonnen hatte.
Sein Sieg über Tod Larsen schien eine merkwürdige Wirkung auf ihn auszuüben. Am Abend zuvor hatte er sich in einen Katzenjammer hineingeredet, und ich hatte einen seiner charakteristischen Ausbrüche erwartet. Aber nichts war geschehen, und jetzt war er in glänzender Stimmung. Vermutlich hatte sein Erfolg beim Kapern so vieler Boote und Jäger der gewöhnlichen Reaktion entgegengewirkt. Jedenfalls war der Katzenjammer vorbei, und die Teufel der Schwermut hatten sich nicht gezeigt. So dachte ich wenigstens, aber ach, wie wenig kannte ich ihn! Ich wußte nicht, daß er vielleicht gerade in diesem Augenblick über einen Ausbruch brütete, der schrecklicher sein sollte als alle, die ich bisher erlebt hatte.
Wie gesagt, er war scheinbar in glänzender Stimmung, als ich die Kajüte betrat. Er hatte wochenlang keine Kopfschmerzen gehabt, seine Augen waren so klar wie der Himmel, seine dunkle Gesichtsfarbe strahlte vor Gesundheit. Das Leben schwoll in prachtvollem Rhythmus durch seine Adern. Während sie auf mich warteten, hatte er Maud Brewster in eine angeregte Unterhaltung verwickelt. Das Problem, das sie erörterten, war die Versuchung, und aus den wenigen Worten, die ich hörte, schloß ich, daß für ihn Versuchung war, wenn ein Mensch sich verführen ließ und fiel.
»Denn sehen Sie,« sagte er gerade, »meiner Ansicht nach handelt der Mensch stets in Übereinstimmung mit seinen Wünschen. Was er auch immer tut, so tut er es, weil ihn der Wunsch dazu treibt.«
»Aber nehmen Sie an, daß er zwei Wünsche hat, die einander entgegengesetzt sind, so daß ihm das eine nicht erlaubt, das andere zu tun?« unterbrach Maud ihn.
»Das eben war es gerade, worauf ich hinauswollte«, sagte er.
»Und zwischen diesen beiden Wünschen offenbart sich die Seele des Menschen«, fuhr sie fort. »Ist es eine gute Seele, so wird sie das Gute wünschen und vollbringen, und das Gegenteil, wenn es eine schlechte Seele ist. Die Seele ist es, die entscheidet.«
»Schwindel!« rief er ungeduldig aus. »Es ist der Wunsch, der entscheidet. Ein Mensch, zum Beispiel, wünscht sich zu betrinken. Gleichzeitig aber will er sich nicht betrinken. Was tut er, und wie tut er es? Er ist eine Puppe, der Spielball seiner Wünsche, und von den beiden Wünschen gehorcht er eben dem stärkeren, das ist alles. Seine Seele hat gar nichts damit zu schaffen. Haha,« lachte er, »was halten Sie davon, Herr van Weyden?«
»Daß Sie beide Haarspalterei betreiben«, sagte ich. »Die Seele des Mannes sind seine Wünsche oder, wenn Sie wollen: Die Summe seiner Wünsche ist seine Seele. Sie haben alle beide unrecht. Sie, weil Sie den Wunsch, getrennt von der Seele, als das Wichtigste betrachten, Fräulein Brewster, weil für sie die Seele, getrennt von den Wünschen, die Hauptsache ist. In der Tat sind Seele und Wünsche ein und dasselbe.«
»Jedoch«, fuhr ich fort, »hat Fräulein Brewster recht. Die Versuchung ist der Wind, der den Wunsch anfacht, bis er so stark ist, daß er uns übermannt. Der Wind mag nicht stark genug sein, den Wunsch die Oberhand gewinnen zu lassen, wenn er aber nur überhaupt weht, so ist es eben Versuchung. Und, wie Sie sagen, man kann sowohl zum Guten wie zum Bösen versucht werden.«
Ich war ganz stolz, als wir uns zu Tische setzten. Meine Worte hatten den Ausschlag gegeben. Wenigstens hatte ich der Diskussion ein Ende gemacht.
Aber Wolf Larsen schien so unterhaltsam zu sein, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Es war, als ob er vor innerer Energie beinahe barst. Fast im selben Augenblick begann er eine Diskussion über die Liebe. Wie gewöhnlich vertrat er die rein materialistische, Maud die idealistische Seite. Ich selbst beteiligte mich außer einigen kurzen Bemerkungen und Einwänden nicht an der Unterhaltung.
Er war prachtvoll, aber Maud auch, und eine Zeitlang verlor ich den Faden der Unterhaltung, weil ich ihr Gesicht beim Sprechen studierte. Es war ein Gesicht, das sonst selten Farbe annahm, heute aber war es leicht gerötet und erregt. Ihr Geist entfaltete sich frei, und das Turnier belustigte sie ebensosehr wie Wolf Larsen, der sich mächtig wohl fühlte.
In diesem Augenblick steckte Louis den Kopf in die Kajüte und flüsterte:
»Leise! Der Nebel geht hoch, und vorn ist die Backbordlaterne eines Dampfers.«
Wolf Larsen sprang an Deck, und zwar so rasch, daß er, als wir ihm nachgekommen waren, schon die Zwischendecksluke über dem trunkenen Lärm geschlossen hatte und jetzt nach vorn eilte, um auch die Backluke zu schließen. Obwohl der Nebel sich etwas gelichtet hatte, hing er noch über uns und verdunkelte die Sterne, so daß die Nacht ganz schwarz war. Gerade voraus konnte ich ein rotes und ein weißes Licht sehen und eine Maschine arbeiten hören; zweifellos die ›Macedonia‹.
Wolf Larsen war zur Ruff zurückgekehrt, und wir standen schweigend zusammen und beobachteten die Lichter, die schnell vor unserm Bug vorbeiglitten.
»Ein Glück, daß er keine Scheinwerfer hat!« sagte Wolf Larsen.
»Wenn ich nun laut riefe?« fragte ich flüsternd.
»Dann wären wir erledigt«, antwortete er. »Aber haben Sie auch daran gedacht, was sofort geschehen würde?«
Ehe ich Zeit hatte, meinem Wunsche, es zu erfahren, Ausdruck zu verleihen, hatte er mich mit dem Griff eines Gorillas an der Kehle gepackt, und durch ein schwaches Zittern der Muskeln gab er mir einen Begriff davon, wie er mir ohne weiteres das Genick brechen würde. Im nächsten Augenblick ließ er mich los, und wir starrten wieder auf die Lichter der ›Macedonia‹.
»Und wenn ich rufen würde?« fragte Maud.
»Sie sind mir zu teuer, als daß ich Ihnen etwas tun würde,« sagte er sanft – ja, es lag eine Zärtlichkeit, fast eine Liebkosung in seiner Stimme, die mich zusammenzucken ließ –, »aber tun Sie es doch lieber nicht, denn ich würde prompt Herrn van Weyden das Genick brechen.«
»Dann darf sie meinetwegen gern rufen«, sagte ich trotzig.
»Ich glaube kaum, daß sie den großen amerikanischen Kritiker Humphrey van Weyden opfern würde!« lachte er spöttisch.
Wir schwiegen, und wir hatten uns schon so aneinander gewöhnt, daß das Schweigen uns nicht verlegen machte; und als das rote und weiße Licht verschwunden waren, gingen wir wieder in die Kajüte, um das unterbrochene Abendbrot zu beenden.
Maud sprach Dawsons Gedicht »Impenitentia Ultima«. Sie tat es wundervoll, aber ich beobachtete nicht sie, sondern Wolf Larsen. Der faszinierende Blick, den er Maud zuwarf, faszinierte mich. Er war ganz außer sich, und ich bemerkte, daß er unbewußt die Lippen bewegte und Wort für Wort so schnell formte, wie sie es aussprach. Er unterbrach sie bei folgenden Zeilen:
»Und ihre Augen sollten mein Licht sein, wenn die Sonne hinter mir erlosch,
Und die Viola in ihrer Stimme sollte der letzte Ton in meinem Ohre sein.«
»Es ist eine Viola in Ihrer Stimme«, sagte er geradezu, und in seinen Augen flammten die goldenen Lichter. Ich hätte jauchzen mögen über ihre Ruhe und ihren Gleichmut. Sie beendete die Schlußstrophen, ohne zu stocken, und lenkte die Unterhaltung in weniger gefährliche Bahnen. Und die ganze Zeit hindurch saß ich in halber Betäubung da, der Lärm aus dem Zwischendeck ertönte durch das Schott, und der Mann, den ich fürchtete, und die Frau, die ich liebte, sprachen immer weiter. Der Tisch war nicht abgeräumt. Der Mann, der die Stelle von Thomas Mugridge eingenommen hatte, befand sich offenbar bei seinen Kameraden in der Back.
Wenn Wolf Larsen je den Gipfel des Lebens erreichte, so tat er es jetzt. Immer wieder vergaß ich meine eigenen Gedanken, um ihm zu folgen, und ich folgte ihm mit Erstaunen, unmittelbar bezwungen durch seinen wunderbaren Verstand, durch den Zauber seiner Leidenschaft, denn er predigte die Leidenschaft des Aufruhrs.
Natürlich wurde dann Miltons Lucifer angeführt, und die Kühnheit, mit der Wolf Larsen diesen Charakter analysierte, war eine Offenbarung seines unterdrückten Genies. Ich wurde an Taine gemahnt, und doch wußte ich, daß der Mann nie etwas von diesem glänzenden, wenn auch gefährlichen Denker gehört hatte.
»Er vertrat eine verlorene Sache, und er fürchtete sich nicht vor Gottes Donnerkeilen«, sagte Wolf Larsen. »Wenn er auch in die Hölle gestürzt wurde, so blieb er doch unbesiegt. Ein Drittel der Engel Gottes hatte er mitgebracht, und sofort reizte er die Menschen auf, sich gegen Gott zu empören, und gewann den größten Teil aller menschlichen Generationen für sich und die Hölle. Warum er vom Himmel herabgeschleudert wurde? Weil er weniger tapfer als Gott war? Weniger stolz? Weniger ehrgeizig? Nein! Tausendmal nein! Gott war der Stärkere. Ihm verlieh der Donner größere Macht. Lucifer aber war ein freier Geist. Dienen hieß für ihn ersticken. Er zog Leiden in Freiheit aller Glückseligkeit einer bequemen Knechtschaft vor. Er machte sich nichts daraus, Gott zu dienen. Er wollte niemand dienen. Er war keine Gallionsfigur. Er stand auf eigenen Füßen. Er war eine Persönlichkeit.«
»Der erste Anarchist!« lachte Maud lebhaft, indem sie sich erhob und sich dann anschickte, ihre Kajüte aufzusuchen.
»Dann ist es gut, Anarchist zu sein!« rief er. Auch er hatte sich erhoben und blickte ihr, die in der Tür stand, ins Gesicht. Dann zitierte er weiter:
»Hier endlich
Winkt uns die Freiheit, hat der Allmächtige
Die Zelte seines Neides nicht gebaut
Und wird uns nicht vertreiben. Unsre Herrschaft
Ist sicher hier; und herrschen, wie man will,
Ist schon den Ehrgeiz wert auch in der Hölle:
Dort lieber Herrscher, als im Himmel Knecht!«
Es war der trotzige Ruf eines mächtigen Geistes. Die Kajüte hallte wider von seiner Stimme, wie er so, hin und her schwankend, das sonnenverbrannte Gesicht leuchtend und mit stolz zurückgeworfenem Kopfe dastand und die Augen golden und männlich, fest und unwiderstehlich auf Maud heftete, die in der Tür stand.
Wieder lag dies unsagbare Entsetzen in ihrem Blick, und, beinahe flüsternd, sagte sie: »Sie sind Lucifer.« Die Tür schloß sich, und sie war fort. Er starrte ihr eine Weile nach, dann kam er wieder zu sich und wandte sich zu mir.
»Ich will Louis am Rad ablösen«, sagte er kurz. »Um Mitternacht werden Sie mich ablösen. Jetzt legen Sie sich am besten nieder und schlafen ein bißchen.«
Er zog ein Paar Fausthandschuh an, setzte seine Mütze auf und stieg die Treppe hinauf, während ich seiner Aufforderung, mich niederzulegen, Folge leistete. Ohne einen mir bewußten Grund, nur einer geheimnisvollen Eingebung folgend, entkleidete ich mich nicht, sondern legte mich völlig angekleidet in die Koje. Eine Zeitlang lauschte ich auf den Lärm im Zwischendeck und stellte Betrachtungen an über die Liebe, die zu mir gekommen war, aber mein Schlaf war auf der ›Ghost‹ gesund und natürlich geworden, und bald erstarben Singen und Schreien, meine Augen schlossen sich, und mein Bewußtsein sank in den Halbtod des Schlummers.
Ich weiß nicht, was mich weckte, aber ich stand ganz wach vor meiner Koje, und meine Seele zitterte wie in Gefahr, als hätte mich Trompetenschall gerufen. Ich riß die Tür auf. Die Kajütslampe war tief herabgebrannt. Und ich sah Maud, meine Maud, die sich aus den Armen Wolf Larsens zu befreien suchte. Ich konnte ihre verzweifelten Anstrengungen sehen, sie preßte ihr Gesicht gegen seine Brust, um ihm zu entkommen. Alles dies sah ich in einem Nu, und schon sprang ich in die Kajüte.
Ich schlug ihm mit der Faust mitten ins Gesicht, aber der Schlag hatte keine Kraft. Er brüllte wie ein wildes Tier und schob mich mit der Hand weg. Er schob mich nur, fegte mich mit dem Handrücken fort, aber so ungeheuer war seine Kraft, daß ich fortgeschleudert wurde, wie von einem Katapult. Ich stieß gegen die Tür des Raumes, in dem Thomas Mugridge früher geschlafen hatte, und das Paneel zersplitterte unter der Wucht meines Körpers. Schwankend richtete ich mich wieder auf und befreite mich mit Mühe aus den Trümmern der Tür. Einen Schmerz fühlte ich nicht, ich war nur von einer grenzenlosen Wut beherrscht. Ich glaube, daß ich laut schrie, als ich zum zweitenmal mit gezücktem Messer ansprang.
Aber es mußte etwas geschehen sein. Sie taumelten auseinander. Ich war schon mit dem Messer über ihm, aber ich hielt den Stoß zurück. Ich war verwirrt. Maud lehnte sich mit ausgestreckter Hand gegen das Schott. Wolf Larsen aber schwankte, die Linke gegen die Stirn gepreßt und die Augen bedeckend, während er halb betäubt mit der Rechten nach einem Halt suchte. Er stieß gegen die Wand, sein Körper schien bei der Berührung eine physische Erleichterung zu spüren, die Muskeln erschlafften, es war, als hätte er den verlorenen Kurs wiedergefunden, als wisse er wieder, wo er sich befand, als habe er wieder einen Halt.
Dann übermannte mich wieder die Wut. Alles Unrecht, alle Demütigungen, alles, was ich und andere durch ihn erlitten, die Ungeheuerlichkeit, die allein in der Existenz dieses Mannes lag, stand in blendender Helle vor mir. Blind, wahnsinnig, sprang ich von neuem auf ihn los und stieß ihm das Messer in die Schulter. Mir war sofort klar, daß es nichts als eine Fleischwunde war – ich hatte den Stahl in seinem Schulterblatt knirschen hören – und ich hob nochmals das Messer, um ein Ende zu machen.
Aber Maud hatte meinen ersten Stoß gesehen und schrie: »Nicht! Bitte nicht!«
Ich ließ einen Augenblick den Arm sinken – nur einen Augenblick. Dann erhob ich das Messer wieder, und es wäre sicher aus gewesen mit Wolf Larsen, wäre sie nicht dazwischengetreten. Ihre Arme umschlangen mich, ihr Haar berührte mein Gesicht. Mein Puls flog, und meine Wut wuchs mit seinen Schlägen. Sie blickte mir mutig in die Augen.
»Um meinetwillen!« flehte sie.
»Um ihretwillen will ich ihn töten!« rief ich und versuchte, meinen Arm frei zu machen, ohne sie zu verletzen.
»Still!« sagte sie und legte mir die Hand sanft auf die Lippen. Ich hätte sie küssen können, wenn ich es nur gewagt hätte, denn inmitten meiner Wut wirkte ihre Berührung so süß, so unsagbar süß. »Bitte, bitte«, flehte sie, und sie entwaffnete mich mit diesen Worten, wie sie mich – das habe ich später erfahren – stets mit ihnen entwaffnen wird.
Ich trat zurück und steckte das Messer in die Scheide. Ich blickte auf Wolf Larsen. Er preßte die Linke immer noch gegen die Stirn und bedeckte seine Augen. Sein Kopf war gebeugt. Er schien plötzlich gelähmt zu sein. Sein Körper brach in den Hüften zusammen, seine mächtigen Schultern sackten nach vorn.
»Van Weyden!« rief er heiser und mit einem Klang von Angst in der Stimme. »Van Weyden, wo sind Sie?« Ich blickte Maud an. Sie sagte nichts, nickte nur.
»Hier«, antwortete ich und trat zu ihm. »Was ist mit Ihnen?«
»Helfen Sie mir auf einen Stuhl«, sagte er mit derselben furchtsamen Stimme.
»Ich bin ein kranker Mann, ein sehr kranker Mann, Hump«, sagte er, als meine stützenden Arme ihn losließen und er auf den Stuhl sank.
Sein Kopf fiel vornüber auf den Tisch und wurde in seinen Händen begraben. Ab und zu schwankte er wie vor Schmerz hin und her. Als er einmal aufblickte, sah ich den Schweiß in schweren Tropfen unter den Haarwurzeln auf seiner Stirn stehen.
»Ich bin ein kranker Mann, ein sehr kranker Mann«, wiederholte er immer wieder.
»Was ist Ihnen denn?« fragte ich, indem ich ihm meine Hand auf die Schulter legte. »Kann ich etwas für Sie tun?«
Aber er schüttelte meine Hand mit einer ungeduldigen Bewegung ab, und eine Weile stand ich schweigend neben ihm. Maud starrte ihn mit einem Ausdruck von Furcht und Schrecken an. Wir hatten keine Ahnung, was ihm geschehen war.
»Hump,« sagte er endlich, »ich muß in die Koje. Reichen Sie mir Ihre Hand. Es wird gleich vorübergehen. Ich glaube, es sind die verfluchten Kopfschmerzen. Ich hatte es schon gefürchtet. Ich hatte ein Gefühl – nein, ich weiß nicht, was ich rede. Helfen Sie mir in meine Koje!«
Als ich ihn aber in die Koje gebracht hatte, vergrub er wieder sein Gesicht in den Händen, bedeckte die Augen, und, als ich mich zum Gehen wandte, hörte ich ihn murmeln: »Ich bin ein kranker Mann, ein sehr kranker Mann.«
Als ich herauskam, sah Maud mich fragend an. Ich schüttelte den Kopf und sagte:
»Es ist ihm etwas zugestoßen. Was, weiß ich nicht. Er ist hilflos und furchtsam – sicher das erstemal in seinem Leben. Es muß geschehen sein, noch ehe er den Messerstich erhielt, denn der hat ihn nur ganz oberflächlich getroffen. Sie müssen doch gesehen haben, was es war.«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe nichts gesehen. Es ist mir genau so rätselhaft. Er ließ mich plötzlich los und taumelte. Aber was tun wir? Was soll ich tun?« »Warten Sie bitte, bis ich wiederkomme«, antwortete ich kurz.
Ich ging an Deck. Louis stand am Rade.
»Du kannst nach vorn gehen und dich hinlegen«, sagte ich und nahm selbst das Ruder.
Er gehorchte ohne Zögern, und ich befand mich allem an Deck der ›Ghost‹. So leise wie möglich geite ich die Toppsegel auf, fierte Außenklüver und Stagsegel, holte den Klüver nach Backbord und legte das Großsegel hart an den Wind. Dann ging ich zu Maud hinunter. Zum Zeichen des Schweigens legte ich den Finger auf die Lippen und trat in Wolf Larsens Raum. Er befand sich noch in demselben Zustand, wie ich ihn verlassen hatte, und bewegte den Kopf – fast schlangenartig – hin und her.
»Kann ich etwas für Sie tun?« fragte ich.
Er gab zuerst keine Antwort, als ich aber meine Frage wiederholte, sagte er: »Nein, nein, es ist gut. Lassen Sie mich allein bis morgen früh.«
Als ich mich aber zum Gehen wandte, bemerkte ich, daß sein Kopf die schaukelnde Bewegung wieder aufgenommen hatte. Maud wartete geduldig auf mich, und mit einem freudigen Gefühl bemerkte ich die königliche Haltung ihres frei erhobenen Kopfes und ihre schönen ruhigen Augen. Ruhig und zuversichtlich waren sie wie ihr Gemüt.
»Wollen Sie sich mir für eine Seereise von etwa sechshundert Meilen anvertrauen?« fragte ich.
»Sie wollen –?« sagte sie, und ich wußte, daß sie meine Absicht erraten hatte.
»Ja, eben das«, antwortete ich. »Uns bleibt keine Wahl als das offene Boot.«
»Um meinetwillen, meinen Sie?« sagte sie. »Sie selbst sind doch gewiß hier ebenso sicher wie bisher.«
»Nein, wir haben beide keine andere Möglichkeit als das offene Boot«, wiederholte ich tapfer. »Wollen Sie sich bitte so warm wie möglich ankleiden und alles, was Sie mitnehmen wollen, zusammenpacken. – Und machen Sie so schnell wie möglich'«, fügte ich hinzu, als sie sich umwandte, um ihre Kajüte aufzusuchen. Die Vorratskammer befand sich gerade unter der Kajüte, ich öffnete die Falltür, nahm ein Licht und stieg hinunter, um mich mit Proviant zu versorgen. Ich wählte hauptsächlich Konserven, und als ich fertig war, streckten sich mir von oben ein Paar Hände willig entgegen, um in Empfang zu nehmen, was ich ihnen zureichte.
Wir arbeiteten schweigend. Ich verschaffte mir auch Decken, Fausthandschuhe, Ölzeug, Mützen und ähnliches aus der Vorratskiste. Es war keine Kleinigkeit, sich in einem kleinen Boot der rauhen, stürmischen See anzuvertrauen, und es war durchaus notwendig, sich gegen Kälte und Nässe zu schützen.
Wir schafften fieberhaft, um unsern Raub an Deck zu bringen und mittschiffs zu schleppen, ja, wir strengten uns so an, daß Maud, die nicht über große Körperkräfte verfügte, erschöpft aufgab und sich auf die Stufen zur Achterhütte setzen mußte. Aber das half wenig, und so legte sie sich rücklings auf das harte Deck. Sie streckte die Arme aus und ließ alle Muskeln erschlaffen, ein Trick, den ich von meiner Schwester kannte und mit dessen Hilfe sie sich bald erholt haben mußte. Ich war mir auch bewußt, daß es nicht unwichtig für uns war, Waffen zu besitzen, und so ging ich in Wolf Larsens Kabine, um sein Gewehr und seine Büchse zu holen. Ich sprach ihn an, aber er gab keine Antwort, obgleich sein Kopf hin und her schwankte und er nicht schlief.
»Leb' wohl, Lucifer!« flüsterte ich bei mir, während ich leise die Tür schloß.
Das nächste, was ich mir verschaffen mußte, war Munition – ein leichtes, obwohl ich dazu auf die Laufbrücke mußte. Hier bewahrten die Jäger die Munitionsvorräte auf, die sie mit in die Boote nahmen, und hier, nur wenige Schritte von ihrem wüsten Gelage, nahm ich zwei Kisten.
Dann mußte ein Boot hinabgelassen werden. Dies war keine Kleinigkeit für einen einzelnen Mann. Als ich die Surringe entfernt hatte, heißte ich es zuerst am Vordertakel und dann achtern, bis es klar von der Reling kam. Dann ließ ich es immer abwechselnd an den beiden Takeln hinunter, bis es an der Schiffsseite dicht über dem Wasser hing. Ich vergewisserte mich, daß es richtig mit Riemen, Klampen und Segel versehen war. Das Wichtigste war Trinkwasser, und ich nahm daher sämtliche Fässer aus den andern Booten. Da es alles in allem neun Boote waren, hatten wir nun Wasser in Hülle und Fülle und zugleich Ballast, obwohl wir jetzt Gefahr liefen, das Boot zu überlasten, wenn wir den ganzen Proviant übernahmen.
Während Maud ihn mir reichte und ich ihn im Boot verstaute, kam ein Matrose aus der Back an Deck. Er blieb eine Weile an der Luvreling stehen (wir waren an der Leereling beschäftigt) und schlenderte dann langsam mittschiffs, wo er wieder haltmachte und, mit dem Rücken gegen uns, in die Windrichtung blickte. Ich konnte mein Herz schlagen hören, während ich mich im Boot verkroch. Maud hatte sich aufs Deck gleiten lassen und lag, wie ich wußte, regungslos im Schatten der Reling. Aber der Mann wandte sich nicht ein einziges Mal um, er reckte die Arme, gähnte, schritt wieder zur Back und verschwand.
Nach einigen Minuten waren wir mit dem Verladen fertig, und ich ließ das Boot zu Wasser. Als ich Maud über die Reling half und ihren Körper dicht an dem meinen fühlte, konnte ich nur mit Mühe den Ruf »Ich liebe Sie! Ich liebe Sie!« unterdrücken. Wirklich: Humphrey von Weyden ist verliebt, dachte ich, als ich sie ins Boot hob und ihre Finger sich um die meinen klammerten. Ich hielt mich mit der einen Hand an der Reling fest und stützte sie mit der andern, und mich durchzuckte einen Augenblick ein Gefühl von Stolz. Ich besaß Kräfte, wie ich sie noch vor wenigen Monaten nicht gehabt – an dem Tage, als ich mich von Charley Furuseth verabschiedet hatte, um mit der unglückseligen ›Martinez‹ nach San Francisco zu fahren.
Das Boot hob sich auf einer Woge, Mauds Füße berührten den Boden, und ich ließ ihre Hände los. Dann warf ich die Takel los und sprang ihr nach. Ich hatte noch nie im Leben gerudert, aber ich legte die Riemen aus und bekam mit großer Anstrengung das Boot klar von der ›Ghost‹. Dann versuchte ich, das Segel zu setzen. Ich hatte beobachtet, wie die Bootssteurer und Jäger ihre Sprietsegel setzten, aber es war doch mein erster Versuch. Ich brauchte zwanzig Minuten, um zu machen, was sie in vielleicht zweien schafften, aber schließlich war es getan, und, die Ruderpinne in der Hand, ging ich in den Wind.
»Dort liegt Japan,« bemerkte ich, »gerade vor uns.« »Humphrey van Weyden, Sie sind ein mutiger Mann!« sagte sie.
»Nein,« antwortete ich, »aber Sie sind eine mutige Frau.«
Wie auf eine gemeinsame Eingebung wandten wir den Kopf, um noch einen letzten Blick auf die ›Ghost‹ zu werfen. Ihr niedriger Rumpf hob sich und rollte auf der Woge, ihre Segel schimmerten undeutlich in der Nacht, das festgemachte Rad kreischte, dann entschwand sie unsern Blicken, und wir waren allein auf dem dunklen Meer.
Grau und frostig brach der Tag an. Das Boot lag scharf an dem frischen Winde, und der Kompaß zeigte, daß wir genau den Kurs nahmen, der uns nach Japan führte. Trotz den Fausthandschuhen waren meine Finger kalt und klamm vom Halten des Steuerruders. Meine Füße brannten vor Frost, und ich hoffte nur, daß die Sonne scheinen sollte.
Vor mir, auf dem Boden des Bootes, lag Maud. Sie wenigstens war warm, denn sie war in dicke Decken eingehüllt. Die oberste hatte ich ihr übers Gesicht gezogen, um sie vor der Nachtkälte zu beschützen, und ich konnte nichts von ihr sehen als die unbestimmten Umrisse ihrer Gestalt und ihr hellbraunes Haar, das, mit Trautropfen wie mit Juwelen besät, unter der Decke hervorlugte.
Lange blickte ich auf sie, ließ meine Augen auf dem wenigen ruhen, das von ihr sichtbar war, wie ein Mann das betrachtet, das ihm das Teuerste auf der Welt ist. So hartnäckig war mein Blick, daß sie sich schließlich unter den Decken regte, der oberste Zipfel wurde zurückgeschlagen, und sie lächelte mich mit Augen an, die noch schwer vom Schlafe waren.
»Guten Morgen, Herr van Weyden«, sagte sie. »Haben Sie schon Land gesichtet?«
»Nein«, antwortete ich, »aber wir nähern uns ihm mit einer Geschwindigkeit von sechs Meilen die Stunde.« Sie blickte mich erschrocken an.
»Aber das sind ja hundertvierundvierzig Meilen in vierundzwanzig Stunden«, fügte ich beruhigend hinzu. Ihre Züge erhellten sich. »Und wie weit ist es?«
»In dieser Richtung liegt Sibirien«, sagte ich und wies nach Westen. »Aber etwa sechshundert Meilen westwärts liegt Japan. Wenn der Wind anhält, werden wir es in fünf Tagen schaffen.«
»Und wenn Sturm kommt? Dann kann sich das Boot wohl nicht halten?«
Sie hatte eine eigene Art, einem in die Augen zu blicken und die Wahrheit zu fordern, und so blickte sie mich auch jetzt an, als sie die Frage stellte.
»Dann müßte es schon sehr stürmen«, sagte ich zögernd.
»Und wenn es sehr stürmt?«
Ich nickte. »Aber es kann auch jederzeit geschehen, daß wir von einem Robbenschoner aufgenommen werden. Dieser Teil des Ozeans wird sehr viel von ihnen befahren.«
»Gott, Sie sind ja ganz durchfroren!« rief sie aus. »Sehen Sie: Sie zittern ja. Sagen Sie nicht nein; Sie zittern. Und ich lag hier warm und sicher wie in Abrahams Schoß!«
»Ich kann nicht einsehen, was es an der Sache geändert hätte, wenn Sie auch durchfroren wären«, lachte ich.
»Ich werde es ja doch, sobald ich steuern gelernt habe, was ja hoffentlich bald der Fall sein wird.«
Sie setzte sich auf und begann, ihre einfache Toilette zu machen. Sie schüttelte ihr Haar auf, daß es ihr in einer braunen Wolke um Gesicht und Schultern fiel. Ihr herrliches braunes Haar! Ich hätte es küssen, es durch meine Finger gleiten lassen, mein Gesicht darin vergraben mögen! Wie verzaubert starrte ich sie an und vergaß das Ruder, bis das Boot in den Wind lief und das flatternde Segel mich an meine Pflicht mahnte. »Warum tragen die Frauen ihr Haar nicht immer offen?« fragte ich. »Es ist doch viel schöner.«
»Wenn es nicht so schrecklich unordentlich würde!« lachte sie. »Schauen Sie, jetzt habe ich eine von meinen kostbaren Haarnadeln verloren!«
Wieder vernachlässigte ich das Boot und ließ das Segel in den Wind brassen, so groß war mein Entzücken an jeder ihrer Bewegungen, als sie jetzt die Nadel zwischen all den Decken suchte. Ich war überrascht und froh, als ich sah, wie weiblich sie war, denn in meiner Vorstellung hatte ich fast ein göttliches, gänzlich unnahbares Wesen aus ihr gemacht. So begrüßte ich denn mit Freuden die kleinen Züge, die sie doch alles in allem als echtes Weib offenbarten, wie zum Beispiel die Kopfbewegung, mit der sie die Wolke ihres Haares zurückwarf, und das Suchen nach der Haarnadel.
Mit einem reizenden kleinen Schrei fand sie die Nadel, und ich wandte meine Aufmerksamkeit wieder dem Steuerruder zu. Ich versuchte, das Ruder mit Hilfe eines Keils festzumachen, und das Boot hielt seinen Kurs ganz gut ohne meine Hilfe. Nur gelegentlich kam es zu dicht an den Wind oder fiel etwas ab, aber jedesmal richtete es sich von selber wieder und benahm sich überhaupt recht befriedigend.
»Und nun wollen wir frühstücken«, sagte ich. »Zunächst aber müssen Sie sich etwas wärmer kleiden.« Ich suchte ein neues Hemd hervor, das aus demselben Stoff wie die Decken gemacht war. Ich kannte das Gewebe und wußte, daß es wasserdicht war und selbst bei stundenlangem Regen keine Feuchtigkeit durchließ. Als sie es übergestreift hatte, vertauschte ich ihre Knabenmütze gegen eine Männerkappe, die groß genug war, ihr Haar zu bedecken, und die, wenn die Klappen heruntergeschlagen wurden, ihr ganz über Ohren und Hals ging. Die Wirkung war bezaubernd. Nichts vermochte das köstliche Oval, die fast klassischen Linien, die wie mit dem Pinsel gezogenen Brauen, die großen braunen Augen mit ihrem klaren, ruhigen Blick zu zerstören.
Ein etwas stärkerer Stoß traf uns, als wir gerade einen Wogenkamm passierten. Das Boot legte sich soviel über, daß der Rand der Reling die Oberfläche streifte und wir etwa eine Pütze Wasser übernahmen. Ich war gerade dabei, eine Dose mit Zunge zu öffnen. Ich ließ sie fallen, sprang an die Schoot und warf sie gerade noch im rechten Augenblick hinüber. Das Segel schlug und flatterte, und das Boot kam klar. Wenige Minuten später hatte ich es wieder in den Kurs gebracht und konnte die Vorbereitungen zum Frühstück wieder aufnehmen.
»Es funktioniert, wie es scheint, sehr gut, wenn ich auch in seemännischen Fragen nicht sehr erfahren bin«, sagte sie und nickte beifällig mit dem Kopfe nach meiner Steuervorrichtung.
»Aber es geht nur, solange wir mit dem Winde segeln«, erklärte ich. »Wenn wir den Wind dwars haben oder kreuzen müssen, muß ich doch steuern.«
»Ich muß gestehen, daß mir Ihre technischen Ausdrücke fremd sind«, sagte sie. »Aber ich verstehe Ihre Schlußfolgerung und bin nicht gerade froh darüber. Sie können doch nicht ununterbrochen Tag und Nacht steuern. Sie werden mir also nach dem Frühstück meine erste Unterrichtsstunde erteilen. Und dann werden Sie sich hinlegen und schlafen. Wir werden Wachen bilden wie auf einem Schiff.«
»Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen beibringen soll«, wandte ich ein. »Ich bin ja selbst erst Schüler. Als Sie sich mir anvertrauten, haben Sie wohl kaum bedacht, daß ich keine Erfahrung habe. Es ist das erstemal, daß ich mich überhaupt in einem kleinen Boote befinde.«
»Dann müssen wir es gemeinsam lernen, Käptn. Und da Sie einen Vorsprung von einer Nacht haben, werden Sie mich lehren, was Sie unterdessen gelernt haben. Und nun das Frühstück! Die Luft macht hungrig!« »Kaffee gibt es nicht!« sagte ich bedauernd und reichte ihr mit Butter bestrichenen Zwieback und eine Scheibe Zunge. »Und es wird keinen Tee, keine Suppe und überhaupt nichts Warmes geben, bis wir irgendwo an Land gekommen sind.«
Nach einem einfachen Frühstück, das durch eine Tasse kalten Wassers gekrönt wurde, erhielt Maud ihre erste Unterrichtsstunde im Steuern. Während ich sie unterwies, lernte ich selbst ein gut Teil; ich wandte die Kenntnisse an, die ich mir durch das Segeln der ›Ghost‹ und das Beobachten der Bootssteuerer angeeignet hatte. Maud war eine gelehrige Schülerin und lernte bald, den Kurs zu halten, vor den Windstößen zu luven und im Notfall die Schoot hinüberzuwerfen.
Als sie von der Arbeit offenbar übermüdet war, überließ sie mir wieder das Ruder Ich hatte die Decken zusammengelegt, aber sie breitete sie jetzt wieder auf dem Boden aus. Als das geschehen war, sagte sie:
»So, Käptn, jetzt gehen Sie in die Koje. Und Sie werden bis zum zweiten Frühstück schlafen – bis zum Mittagessen«, verbesserte sie sich, indem sie an die Zeiteinteilung auf der ›Ghost‹ dachte.
Was sollte ich tun? Sie bestand darauf und sagte »Bitte, bitte!«, worauf ich ihr das Ruder überließ und gehorchte. Ich hatte ein wundersames Gefühl, als ich in das Bett kroch, daß sie mir mit ihren Händen bereitet hatte. Die Ruhe und Selbstbeherrschung, die einen so bedeutsamen Teil ihres Wesens ausmachten, schienen sich den Decken mitgeteilt zu haben. Ich sank in eine sanfte Schläfrigkeit und Zufriedenheit. Das feine Oval mit den braunen Augen in dem Rahmen der Fischermütze wiegte sich vor dem Hintergrund bald grauer Wolken und bald grauer Wogen – dann wußte ich, daß ich geschlafen hatte.
Ich sah auf meine Uhr. Ich hatte sieben Stunden geschlafen. Und sie hatte sieben gesteuert! Als ich das Ruder nahm, mußte ich ihr die gekrampften Finger öffnen. All ihr bißchen Kraft war erschöpft, und sie war nicht einmal imstande, sich von ihrem Platz zu bewegen. Ich mußte die Schoot fahren lassen, um ihr in das warme Nest von Decken zu helfen und ihre Hände und Arme zu reiben.
»Ich bin so müde!« sagte sie; ihr Atem ging schnell, und sie ließ ihren Kopf mit einem Seufzer sinken.
Aber im nächsten Augenblick richtete sie sich wieder auf. »Jetzt schelten Sie aber nicht, wagen Sie nicht zu schelten«, rief sie mit lustigem Trotz.
»Ich hoffe, daß ich kein böses Gesicht mache,« sagte ich ernst, »denn ich versichere Ihnen, daß ich nicht im geringsten ärgerlich bin.«
»Nein«, meinte sie nachdenklich. »Es sieht nur vorwurfsvoll aus.«
»Dann ist es ein ehrliches Gesicht und drückt nur aus, was ich fühle. Sie haben unrecht sowohl gegen sich selbst wie gegen mich gehandelt. Wie soll ich in Zukunft Vertrauen zu Ihnen haben?«
Sie sah ganz reuevoll aus. »Ich werde brav sein«, sagte sie wie ein unartiges Kind. »Ich verspreche –« »Zu gehorchen, wie ein Matrose seinem Kapitän gehorcht?«
»Ja«, sagte sie. »Es war dumm von mir, ich weiß.« »Dann müssen Sie mir etwas versprechen«, meinte ich. »Gern.«
»Sie dürfen nicht zu oft »Bitte, bitte!« sagen, denn sonst untergraben Sie meine Autorität.«
Sie lachte belustigt. Auch sie hatte die Macht ihres »Bitte, bitte!« bemerkt.
»Das Wort ist schön – –«, begann ich.
»Aber ich darf es nicht ausnutzen«, unterbrach sie mich.
Dann lachte sie müde und ließ den Kopf wieder zurücksinken. Ich überließ das Ruder sich selbst, um ihre Füße in die Decken zu wickeln und ihr einen Zipfel über das Gesicht zu ziehen. Ach, sie war nicht kräftig! Ich sah mit Besorgnis nach Südwest und dachte an die sechshundert Meilen, die mit ihrer Mühsal vor uns lagen – –, ach, wenn es nur nichts Schlimmeres als Mühsal werden sollte. Auf diesem Meere konnte jederzeit ein vernichtender Sturm aufkommen. Und doch fürchtete ich mich nicht. Ich setzte nicht viel Vertrauen auf die Zukunft, war sogar sehr zweifelhaft, und doch wurde ich nicht von Furcht übermannt. »Es muß gut gehen, es muß gut gehen!« – Das wiederholte ich mir immer wieder.
Am Nachmittag frischte der Wind wieder auf, die See wurde unruhiger und stellte mich und das Boot auf eine harte Probe. Aber der Proviant und die neun Wasserfässer waren ein guter Ballast, der das Boot in den Stand setzte, See und Wind zu trotzen, und ich hielt das Segel, solange ich es wagte. Dann holte ich es ein, beschlug es, und wir liefen weiter.
Einige Stunden später sichtete ich den Rauch eines Dampfers am Horizont in Lee. Es mußte meiner Ansicht nach entweder ein russischer Kreuzer oder, wahrscheinlicher, die ›Macedonia‹, sein, die noch auf der Suche nach der ›Ghost‹ war. Die Sonne war den ganzen Tag nicht zum Vorschein gekommen, und es war bitterkalt gewesen. Als die Nacht sich herabsenkte, wurden die Wolken dunkler, und der Wind frischte noch mehr auf, so daß Maud und ich mit Fausthandschuhen Abendbrot aßen und ich am Ruder blieb und nur hin und wieder zwischen den Windstößen einen Bissen zu mir nahm.
Inzwischen war es ganz dunkel geworden, Wind und Wogen wurden zuviel für das kleine Fahrzeug, und so holte ich das Segel ein und versuchte, einen Dregg- oder Seeanker zu machen. Ich hatte diese Kunst durch Gespräche mit den Jägern erfahren, und es war eine ganz einfache Sache. Ich legte das Segel zusammen, surrte es gehörig an Mast, Baum, Spriet und zwei Paar Reserveriemen fest und warf es über Bord. Eine Leine verband es mit dem Bug, und da es tief im Wasser lag und dem Winde keinen Widerstand bot, trieb es langsamer als das Boot. Infolgedessen hielt es den Bug in See und Wind – die sicherste Lage, um sich gegen das Kentern zu schützen, wenn Sturzseen kamen.
»Und jetzt?« fragte Maud fröhlich, als die Arbeit vollbracht war und ich mir die Fausthandschuhe wieder anzog.
»Jetzt fahren wir nicht mehr nach Japan«, sagte ich. »Wir treiben in der Richtung nach Südost oder Südsüdost mit einer Schnelligkeit von mindestens zwei Meilen die Stunde.«
»Das sind vierundzwanzig Meilen«, meinte sie, »wenn der Wind die ganze Nacht weht.«
»Und hundertundvierzig, wenn er drei Tage und Nächte anhält.«
»Aber er wird nicht anhalten!« sagte sie zuversichtlich. »Er wird sich drehen und wenden, wie wir ihn brauchen.«
»Das Meer ist der große Treulose.«
»Aber nicht der Wind!« erwiderte sie. Sie wurde ganz beredt, wenn sie auf den prächtigen Passat zu sprechen kam.
»Wenn ich nur daran gedacht hätte, Wolf Larsens Chronometer und Sextanten mitzunehmen«, sagte ich niedergeschlagen. »In einer Richtung segeln und in der andern treiben, gar nicht zu reden von der Strömung, die einen in einer dritten entführen kann – was dabei herauskommt, kann der größte Rechenkünstler nicht finden. Ehe wir es ahnen, können wir fünfhundert Meilen aus dem Kurs sein.«
Dann bat ich sie um Verzeihung und versprach, nie wieder den Mut zu verlieren. Auf ihren eindringlichen Wunsch überließ ich ihr die Wache bis Mitternacht – es war jetzt neun Uhr –, aber ich hüllte sie in Decken und Ölzeug ein, ehe ich mich niederlegte. Ich schlief nur auf einem Auge. Das Boot hüpfte und stieß, wenn es über die Wellenkämme ging; ich konnte die Seen vorbeischießen hören, und immer wieder spritzte der Schaum ins Boot. Und doch erschien mir die Nacht nicht schlimm, war sie doch nichts im Vergleich mit den Nächten, die ich auf der ›Ghost‹ erlebt hatte, und vielleicht auch nichts im Vergleich mit denen, die wir in dieser Nußschale noch zu überstehen hatten. Ihre Planken waren dreiviertel Zoll stark. Zwischen uns und der Meerestiefe war weniger als ein Zoll Holz.
Und doch – das kann ich immer wieder versichern –, doch fürchtete ich mich nicht. Den Tod, vor dem Wolf Larsen und selbst Thomas Mugridge mir Furcht gemacht hatten, fürchtete ich nicht mehr. Maud Brewster war in mein Leben getreten, und das schien mich verwandelt zu haben. Alles in allem, dachte ich, mußte es besser sein, zu lieben, als geliebt zu werden, wenn die Liebe uns etwas so teuer machen konnte, daß wir den Tod nicht mehr fürchteten. Ich konnte mein eigenes Leben über dem anderen vergessen, und ach – so paradox es auch klingen mag –, nie hatte ich so gewünscht zu leben wie gerade jetzt, da ich meinem Leben weniger Wert beimaß als je zuvor. Nie war mein Leben so begründet gewesen – das war mein letzter Gedanke, und dann, im Einschlafen, gab ich mich zufrieden mit dem Versuch, die Nacht zu durchdringen, die den Steven einhüllte, wo, wie ich wußte, Maud zusammengekauert saß und über die schäumende See hinausblickte – jeden Augenblick bereit, mich zu rufen, wenn es not tun sollte.
Es ist unnötig, alle Leiden eingehend zu schildern, welche wir während der vielen Tage zu erdulden hatten, die wir in dem winzigen Boot hierhin und dorthin über den Ozean getrieben wurden. Der schwere Nordwest wehte vierundzwanzig Stunden lang. Dann legte er sich, und nachts sprang er nach Südwest um. Das war uns gerade entgegen; aber ich holte den Seeanker ein, setzte das Segel und nahm einen Kurs, der uns nach Südsüdost führte. Es war kein großer Unterschied, ob wir diese Richtung oder die nach Nordnordwest wählten, die der Wind ebenfalls zuließ, aber die Aussicht auf wärmere Luft im Süden bestimmte meinen Entschluß.
Nach drei Stunden – es war Mitternacht, wie ich noch weiß, und so dunkel, wie ich es auf See noch nie gesehen hatte – wuchs der Südwest zum Sturm, und ich war wieder genötigt, den Seeanker zu werfen.
Der Tag brach an und fand mich erschöpft auf dem weißschäumenden Meere, während das Boot mit der Spitze fast senkrecht gegen den Himmel zeigte. Wir liefen große Gefahr, von den Sturzseen zum Kentern gebracht zu werden. Gischt und Schaum kamen derart über, daß ich unausgesetzt schöpfen mußte. Die Decken trieften vor Nässe. Außer Maud war alles naß, sie trug Ölzeug, Gummistiefel und Südwester und war trocken bis auf Gesicht und Hände und ein paar verirrte Locken. Sie löste mich hin und wieder beim Schöpfen ab, arbeitete tapfer und trotzte dem Sturm. Aber alles ist relativ. Es war nichts als ein steifer Wind, aber für uns, die wir in einem kleinen zerbrechlichen Boot ums Leben kämpften, war es ein Sturm.
Kalt und trostlos peitschte der Wind uns das Gesicht, die weißen Seen jagten heulend vorbei, und wir kämpften den ganzen Tag. Die Nacht kam, aber keiner von uns schlief. Der Tag kam, und immer noch peitschte der Wind unsre Gesichter, jagten die weißen Wogen brüllend an uns vorbei. In der zweiten Nacht schlief Maud vor Erschöpfung ein. Ich deckte sie mit Ölzeug und einer Persenning zu. Sie war verhältnismäßig trocken, aber starr vor Kälte. Ich fürchtete, daß sie die Nacht nicht überleben würde, aber wieder brach der Tag an, kalt und trostlos, mit demselben bewölkten Himmel, schneidenden Winde und brüllenden Meere.
Ich hatte achtundvierzig Stunden lang kein Auge geschlossen. Ich war bis aufs Mark durchnäßt und durchfroren und mehr tot als lebendig. Mein Körper war steif von Anstrengung und Kälte, und meine Muskeln schmerzten fürchterlich, bei jeder Bewegung litt ich die schrecklichsten Qualen, und ich mußte mich unaufhörlich bewegen. Und dabei wurden wir immer weiter nach Nordosten getrieben, immer weiter fort von Japan und nach der öden Beringsee.
Aber noch lebten wir und hatten unser Boot, obwohl der Wind andauernd mit unverminderter Stärke wehte. Am Abend des dritten Tages nahm er sogar noch etwas zu. Der Bug tauchte in einen Wogenkamm, und das Boot füllte sich zu einem Viertel mit Wasser. Ich schöpfte wie wahnsinnig. Die Gefahr, noch eine See überzubekommen, wurde außerordentlich erhöht durch den Umstand, daß das Wasser das Boot niederpreßte und seine Schwimmfähigkeit verminderte. Und noch eine solche See hieß das Ende. Als ich das Boot wieder trocken hatte, sah ich mich genötigt, Maud die Persenning wegzunehmen und sie quer über dem Bug zu befestigen. Es war ein Glück, daß ich es tat, und obgleich wir in den nächsten Stunden dreimal mit dem Bug tauchten, nahmen wir kein Wasser über.
Maud befand sich in einem kläglichen Zustand. Sie saß zusammengekauert auf dem Boden des Bootes, ihre Lippen waren blau, ihr graues Gesicht zeigte deutlich, welche Qualen sie litt. Aber ihre Augen sahen mich beständig mit ihrem tapferen Blick an, und kein Wort der Entmutigung kam über ihre Lippen.
In dieser Nacht muß der Sturm seinen Höhepunkt erreicht haben, aber ich achtete seiner nicht. Auf dem Achtersitz übermannten mich Müdigkeit und Schmerzen, und ich schlief ein.
Am Morgen des vierten Tages war der Sturm zu einem leisen Hauch gesunken, die See beruhigte sich, und die Sonne schien auf uns herab. Oh, diese gesegnete Sonne! Wie wir unsere armseligen Körper in ihrer köstlichen Wärme badeten! Wir lebten auf wie Käfer und Gewürm nach einem Sturm. Wir lächelten wieder, sagten lustige Dinge und erörterten hoffnungsvoll unsere Lage, Tatsächlich war sie schlimmer als je. Wir waren weiter von Japan entfernt als in der Nacht, da wir die ›Ghost‹ verlassen hatten. Dazu konnte ich Längen- und Breitengrade nur ganz ungefähr erraten. Wenn ich annahm, daß wir in den siebzig Stunden, die der Sturm gedauert hatte, zwei Meilen in der Stunde gemacht hatten, mußten wir mindestens hundertundfünfzig Meilen nach Nordost getrieben sein. Stimmte diese Berechnung aber? Es konnten ebensogut vier wie zwei Meilen in der Stunde gewesen sein! Dann waren wir noch hundertundfünfzig Meilen weiter in der falschen Richtung gekommen.
Wo wir uns befanden, wußte ich nicht, sehr wahrscheinlich aber in der Nähe der ›Ghost‹. Rings um uns her gab es Robben, und ich erwartete jeden Augenblick, einen Robbenschoner auftauchen zu sehen. Am Nachmittag, als der Nordwest wieder aufgekommen war, sichteten wir einen. Aber das fremde Fahrzeug verlor sich bald hinter dem Horizont, und wir waren wieder allein auf dem weiten Meere.
Es kamen Nebeltage, an denen selbst Maud den Mut verlor und keine frohen Worte mehr über ihre Lippen kamen, Tage mit Windstille, da wir auf der unermeßlichen Meeresfläche dahintrieben, bedrückt von ihrer Größe und voller Staunen über das Wunder, daß wir in unserem winzigen Boot noch lebten und um unser Leben kämpften; Tage mit Hagel, Wind und Schneegestöber, an denen nichts uns warmzuhalten vermochte; Tage mit feinem Sprühregen, an denen wir unsere Wasserfässer von dem tropfenden Segel zu füllen versuchten.
Und immer mehr lobte ich Maud. Obwohl ich mich tausendmal bezwingen mußte, um ihr nicht meine Liebe zu erklären, wußte ich doch, daß dies nicht der Zeitpunkt für eine solche Erklärung war. Wenn aus keinem anderen Grunde, so schon allein deshalb, weil die Frau, die ich liebte, sich unter meinem Schutz befand. So schwierig die ganze Lage auch war, schmeichelte ich mir doch, meine Liebe durch kein Zeichen zu verraten. Wir waren gute Kameraden und wurden es mit jedem Tage mehr.
Eines überraschte mich an ihr: ihr unerschütterlicher Mut. Das furchtbare Meer, das zerbrechliche Boot, Stürme, Leiden und Einsamkeit – alles das würde genügt haben, eine kräftigere Frau zu erschrecken, aber es schien keinen Eindruck zu machen auf sie, die das Leben nur von seiner lichtesten Seite kennengelernt hatte, und die trotz ihrer hohen Künstlerschaft, ihrem feurigen Temperament und ihrem erhabenen Geiste doch sanft und zart war. Und doch stimmte das nicht ganz. Sie fürchtete sich wohl, aber sie überwand ihre Furcht durch ihren moralischen Mut. Wohl war ihr Fleisch schwach. Aber ihr Geist, diese ätherische Lebensessenz, ruhig wie ihre Augen und sicher seiner Fortdauer im Universum, beherrschte das Fleisch.
Wieder kamen Sturmtage, Tage und Nächte des Sturmes, an denen uns der Ozean mit seinen brüllenden weißen Schaumwipfeln bedrohte und der Wind unser ringendes Boot mit Titanenfäusten packte. Und immer weiter wurden wir geschleudert, immer weiter nach Nordosten. In einem solchen Sturm, dem schlimmsten, den wir überhaupt erlebt hatten, warf ich zufällig einen Blick nach Lee. Was ich sah, konnte ich zunächst kaum glauben. Diese schreckensvollen, schlaflosen Tage und Nächte hatten mich zweifellos wirr gemacht. Ich blickte auf Maud, um mich von der Wirklichkeit von Zeit und Raum zu überzeugen. Der Anblick ihrer lieben, feuchten Wangen, ihres fliegenden Haares und ihrer tapferen braunen Augen bewies mir, daß meine Augen gesund waren. Wieder wandte ich den Blick leewärts, und wieder sah ich den vorspringenden Felsen, schwarz, hoch und nackt, die rasende Brandung, die sich an seinem Fuße brach und ihren Gischt hoch hinaufschleuderte, und die schwarze, unheilverkündende Küstenlinie, die, von einem mächtigen weißen Gürtel umgeben, nach Südwesten lief.
»Maud,« sagte ich, »Maud!«
Sie wandte den Kopf und schaute.
»Es kann doch nicht Alaska sein!« rief sie.
»Ach nein«, antwortete ich und fragte: »Können Sie schwimmen?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich auch nicht«, sagte ich. »Dann müssen wir eben an Land, ohne zu schwimmen. Es muß ja irgendwo eine Lücke zwischen den Klippen sein, durch die wir mit dem Boot hineinkönnen. Aber es gilt, schnell zu sein, sehr schnell – und aufzupassen.«
Ich sprach mit einer Zuversicht, die ich, wie sie wohl wußte, nicht besaß, denn sie blickte mich mit ihrem ruhigen Blick an und sagte:
»Ich habe Ihnen noch nicht gedankt für all das, was Sie für mich getan haben, aber ...«
Sie zögerte, als wäre sie im Zweifel, wie sie ihre Dankbarkeit am besten in Worte kleiden sollte.
»Nun?« sagte ich hart, denn es war mir nicht recht, daß sie mir danken wollte.
»Sie könnten mir gern ein wenig helfen«, lächelte sie. »Ihre Verpflichtungen anzuerkennen, ehe Sie sterben? Sicher nicht. Wir werden nicht sterben. Wir werden auf dieser Insel landen und es warm und gemütlich haben, ehe der Tag vergeht.«
Ich sprach fest, glaubte aber selbst kein Wort davon. Aber es war nicht die Furcht, die mich lügen ließ. Ich fühlte keine Furcht, obgleich ich sicher war, den Tod in der kochenden Brandung zwischen diesen Felsen zu finden, denen wir uns rasch näherten. Es war unmöglich, Segel zu setzen und von der Küste abzukommen. Der Wind hätte das Boot sofort zum Kentern gebracht, es würde vollgeschlagen sein, sobald wir in ein Wellental gesunken wären; zudem schwamm das Segel, an die Reserveriemen gesurrt, als Seeanker vor uns. Wie gesagt: Furcht, dem Tode dort, wenige hundert Schritte leewärts, zu begegnen, spürte ich nicht, aber entsetzlich war mir der Gedanke, daß Maud sterben sollte. Meine verfluchte Phantasie sah sie schon an den Felsen zerschellt und zerschmettert! Ich versuchte, mich zu dem Glauben zu zwingen, daß wir sicher landen würden, und so sprach ich denn nicht aus, was ich wirklich glaubte, sondern was ich gern geglaubt hätte. Ich schreckte zurück vor dem Gedanken an diesen furchtbaren Tod, und einen Augenblick spürte ich den Wunsch, Maud in meine Arme zu nehmen, ihr meine Liebe zu erklären, umschlungen mit ihr den letzten Kampf auszufechten und zu sterben.
Instinktiv rückten wir auf dem Boden des Bootes enger zusammen. Ich fühlte, wie sich ihre Hand nach der meinen ausstreckte. Und so erwarteten wir wortlos das Ende. Wir waren nicht weit von der Linie, die der Wind mit der westlichen Ecke des Vorgebirges bildete, und ich beobachtete sie in der Hoffnung, daß irgendeine Strömung uns packen und vorbeiführen sollte, ehe wir die Brandung erreichten.
»Wir werden schon klar kommen«, sagte ich mit einer Zuversicht, die aber weder mich noch sie täuschte.
»Bei Gott, wir kommen klar!« rief ich fünf Minuten später.
Ich hatte hinter dem Vorgebirge eine Landzunge gesichtet, und als wir weit genug waren, konnten wir deutlich die Umrisse einer Bucht sehen, die tief ins Land hineinschnitt. Gleichzeitig hörten wir ein andauerndes, ohrenbetäubendes Gebrüll. Es glich fernem Donner und kam aus Lee, übertönte das Brausen der Brandung und fuhr dem Sturm geradeswegs in die Zähne.
Als wir dann in Höhe des Vorgebirges waren, kam die ganze Bucht zum Vorschein – eine halbmondförmige, weißsandige Küste, an der sich die Brandung brach, und die mit Myriaden von Seehunden bedeckt war. Sie waren die Urheber des Gebrülls.
»Eine Robbenkolonie!« rief ich. »Jetzt sind wir wirklich gerettet. Hier muß es Menschen geben und Kreuzer, die die Robben vor den Jägern schützen. Wahrscheinlich ist hier sogar eine Station.«
Als ich aber die gegen die Küste schlagende Brandung beobachtete, sagte ich: »Schön ist das nicht gerade. Aber wenn die Götter uns freundlich sind, werden wir die Landzunge entlang treiben und an eine Stelle kommen, wo wir trockenen Fußes das Land erreichen können.«
Und die Götter waren uns freundlich. Die beiden ersten Landzungen liefen genau in der Windrichtung, als wir aber die zweite umfahren hatten – und wir kamen ihr gefährlich nahe –, erblickten wir eine dritte, die parallel zu ihnen lief. Und dazwischen lag die Bucht! Sie schnitt tief ins Land ein, und die jetzt einsetzende Flut trieb uns hinter die Landzunge. Hier war die See ruhig, außer einer schweren, aber sanften Grunddünung; ich holte den Seeanker ein und begann zu rudern. Von der Spitze aus wandte sich das Gestade in einer Kurve nach Südwesten, bis sich zuletzt eine Bucht in der Bucht zeigte, ein kleiner, vom Lande umschlossener Hafen, dessen Oberfläche wie ein Teich war und nur leicht gekräuselt wurde, wenn sich ein Hauch des Sturmes hereinverirrte und zurückprallte von den dräuenden Felswänden, die im Hintergrunde, hundert Fuß landwärts lagen.
Hier waren keine Robben. Der Bootssteven scheuerte gegen das harte Geröll. Ich sprang heraus und reichte Maud die Hand. Im nächsten Augenblick stand sie neben mir. Als meine Hand sie losließ, faßte sie hastig meinen Arm. Da wankte ich selbst und wäre fast in den Sand gestürzt. Es war die überraschende Wirkung des Umstandes, daß alle Bewegung aufgehört hatte. Wir waren so lange auf dem wogenden Meere gewesen, daß das feste Land eine Erschütterung für uns bedeutete. Wir erwarteten, die Küste auf und nieder schwanken, die Felswände sich wie Schiffsseiten hin und her schwingen zu sehen, und als wir uns automatisch anschickten, diesen erwarteten Bewegungen zu widerstehen, brachte uns ihr Nichteintreffen aus dem Gleichgewicht.
»Ich muß mich wirklich setzen«, sagte Maud mit nervösem Lachen und einer schwindligen Bewegung, und dann setzte sie sich in den Sand.
Ich machte das Boot fest und setzte mich dann neben sie. So landeten wir auf der Mühsalinsel, ›landkrank‹ durch unsern langen Aufenthalt auf dem Meere.
Narr!« rief ich laut vor Ärger.
Ich hatte das Boot ausgeladen, seinen Inhalt hoch auf den Strand geschleppt und war nun dabei, ein Feldlager aufzuschlagen. Am Strande gab es ein wenig Treibholz, und der Anblick einer Dose Kaffee, die ich aus der Speisekammer der ›Ghost‹ mitgenommen, hatte mich an Feuer denken lassen.
»Esel!« fuhr ich fort.
Aber Maud sagte mit sanftem Vorwurf »Scht, scht«, und dann fragte sie, warum ich ein Esel sei.
»Wir haben keine Streichhölzer«, stöhnte ich. »Nicht ein Streichholz habe ich mitgebracht. Und nun gibt es weder heißen Kaffee noch Suppe, Tee oder sonstwas.« »War es nicht – hm – Robinson Crusoe, der zwei Hölzer gegeneinander rieb?« meinte sie bedächtig.
»Aber ich habe Dutzende von Berichten Schiffsbrüchiger gelesen, die es vergebens versuchten«, antwortete ich. »Ich erinnere mich an Winters, einen Journalisten, der bekannt wurde durch seine Schilderungen aus Alaska und Sibirien. Ich traf ihn einmal in Bibilot, und er erzählte mir, wie er versucht hatte, mit ein paar Hölzern Feuer zu machen. Es war sehr lustig, denn er erzählte glänzend, aber der Versuch war mißglückt. Ich entsinne mich namentlich des Schlusses. Seine schwarzen Augen funkelten beim Erzählen: ›Meine Herren, die Südseeinsulaner können es vielleicht, die Malayen mögen es tun, aber Sie können mir glauben: Für einen Weißen ist es unmöglich!‹«
»Nun gut,« sagte Maud fröhlich, »wir sind so lange ohne Feuer ausgekommen, daß ich nicht einsehe, warum wir es nicht noch länger könnten.«
»Aber denken Sie an den Kaffee!« rief ich. »Und es ist sogar guter Kaffee. Ich habe ihn Wolf Larsens Privatproviant entnommen. Und sehen Sie all das schöne Holz!«
Ich gestehe, daß mir eine Tasse Kaffee sehr not tat, und später sollte ich erfahren, daß Maud auch eine kleine Schwäche für dies Getränk hatte. Außerdem hatten wir uns so lange mit kalter Küche begnügen müssen, daß wir innerlich wie äußerlich ganz erstarrt waren. Etwas Warmes wäre uns höchst willkommen gewesen. Aber Jammern half nichts, und so begann ich, aus dem Segel ein Zelt für Maud zu machen.
Ich hatte gedacht, daß es ein leichtes wäre, da ich Riemen, Mast, Baum, Bugspriet und eine Menge Leinen hatte. Da ich aber nicht die geringste Erfahrung besaß und jede Einzelheit erst ausprobieren mußte, verging ein ganzer Tag, ehe das Zelt bereit stand, sie aufzunehmen. Und in der Nacht mußte es auch noch regnen, so daß das Wasser hineinlief und Maud gezwungen war, wieder im Boot Schutz zu suchen.
Am nächsten Morgen grub ich eine Rinne um das Zelt. Eine Stunde später fuhr plötzlich ein starker Windstoß von der Felswand hinter uns herab, riß das Zelt um und fegte es dreißig Schritt weit über den Sand. Maud lachte über mein bestürztes Gesicht, und ich sagte: »Sobald sich der Wind gelegt hat, gedenke ich das Boot zu nehmen und die Insel zu erforschen. Es muß irgendwo eine Station mit Leuten geben. Und die Station muß von Schiffen besucht werden. Irgendeine Regierung muß diese Robben beschützen. Aber ehe ich aufbreche, möchte ich die Überzeugung haben, daß Sie es ein bißchen bequem haben.«
»Ich möchte Sie gern begleiten«, war alles, was sie sagte.
»Es wäre besser, wenn Sie blieben. Sie haben wahrhaftig genug durchgemacht. Es ist ein reines Wunder, daß Sie es überstanden haben. Und es wird nicht angenehm sein, bei diesem regnerischen Wetter zu rudern und zu segeln. Sie brauchen Ruhe, und ich möchte, daß Sie blieben und sich ausruhten.«
»Ich möchte Sie doch lieber begleiten«, sagte sie leise, mit bittender Stimme.
»Vielleicht könnte ich Ihnen ein –« ihre Stimme zitterte – »ein wenig helfen. Und denken Sie, wenn Ihnen etwas zustieße und ich allein hier zurückbliebe!«
»Oh, ich werde sehr vorsichtig sein«, erwiderte ich. »Und ich fahre nicht weit – nicht weiter, als daß ich zur Nacht zurück sein kann. Ja, wenn ich ganz offen sein soll, so hielte ich es für das beste, wenn Sie hier blieben und nichts täten, als sich auszuschlafen.«
Sie wandte sich zu mir und sah mir in die Augen. Ihr Blick war fest, aber doch so sanft.
»Bitte, bitte«, sagte sie weich.
Ich zwang mich, hart zu bleiben, und schüttelte den Kopf. Sie sah mich immer noch erwartungsvoll an. Ich versuchte, meine Weigerung in Worte zu kleiden, aber es war unmöglich. Ich sah ihre Augen vor Freude leuchten und wußte, daß ich verloren hatte. Jetzt war es mir unmöglich, nein zu sagen.
Am Nachmittag ließ der Wind nach, und wir trafen unsere Vorbereitungen, um am nächsten Morgen aufzubrechen. Über Land konnte man von unserer Bucht aus nicht in das Innere der Insel gelangen, denn die Felsen erhoben sich senkrecht, schlossen den ganzen Strand ein und traten zu beiden Seiten der Bucht in das tiefe Wasser.
Der Morgen brach trüb und grau, aber still an, und ich war früh auf und setzte das Boot instand.
»Narr! Esel! Schafskopf!« rief ich, als ich dachte, daß es Zeit wäre, Maud zu wecken, aber diesmal rief ich es froh und tanzte in scheinbarer Verzweiflung barhaupt auf dem Strand herum.
Ihr Kopf kam unter einem Zipfel des Segels zum Vorschein.
»Was gibt es?« rief sie verschlafen, aber doch neugierig. »Kaffee!« rief ich. »Was meinen Sie zu einer Tasse Kaffee? Heißen Kaffee? Brühheiß?«
»Du liebe Zeit,« murmelte sie, »Sie haben mir einen tüchtigen Schrecken eingejagt, und das ist recht schlecht von Ihnen. Jetzt hatte ich mich schon damit abgefunden, daß es keinen gäbe, und da regen Sie mich mit solchen Vorspiegelungen auf!«
»Passen Sie auf!« sagte ich.
In einer Kluft in den Felsen sammelte ich etwas trockenes Holz, schnitzte Späne und spaltete es zu Brennholz. Ich riß eine Seite aus meinem Notizbuch und nahm aus der Munitionskiste eine Schrotpatrone. Ich entfernte mit meinem Messer den Ladepfropfen und streute das Pulver auf ein flaches Felsstück. Dann nahm ich das Zündhütchen heraus und legte es in die Mitte des ausgestreuten Pulvers. Jetzt war alles bereit. Maud sah vom Zelt aus zu. Das Papier in der Linken haltend, schlug ich mit einem Stein, den ich in der Rechten hielt, auf das Zündhütchen. Ein Rauchwölkchen puffte hoch, eine Flamme, und der Rand des Papiers brannte.
Maud klatschte vor Freude in die Hände. »Prometheus!« rief sie.
Ich war jedoch zu beschäftigt, um ihre Freude zu beachten. Das schwache Flämmchen mußte liebevoll gehegt werden, wenn es Kräfte sammeln und leben sollte. Ich nährte es mit einem Spänchen nach dem andern, dann kamen kleine Ästchen an die Reihe, bis das Feuer schließlich knisternd die größeren Kloben erfaßte. Daß wir auf eine öde Insel verschlagen würden, hatte ich nicht mit in meine Berechnung gezogen, und nun hatten wir weder Kessel noch sonst irgendwelche Kochgeräte. Ich behalf mich mit der Konservenbüchse, die ich zum Ausschöpfen des Bootes gebraucht hatte, und als sich unser Vorrat an leeren Konservendosen später vermehrte, hatten wir eine ganz stattliche Reihe von Kochtöpfen aufzuweisen.
Ich kochte das Wasser, aber Maud bereitete den Kaffee. Und wie der schmeckte! Ich steuerte gebratenes Dosenfleisch, aufgeweichten Schiffszwieback und Wasser bei. Das Frühstück gelang glänzend, und wir blieben viel länger am Feuer sitzen, als sich für unternehmungslustige Forschungsreisende streng genommen geziemt hätte, schlürften den heißen schwarzen Kaffee und erörterten unsere Lage.
Ich war ganz sicher, daß wir in einer der Buchten eine Station finden würden, denn ich wußte, daß die Rookerys an der Beringsee in dieser Weise geschützt wurden, aber Maud stellte – ich glaube, um uns vor Enttäuschungen zu bewahren – die Theorie auf, daß wir eine ganz unbekannte Rookery entdeckt hätten. Sie war jedoch gut gelaunt und wollte nichts davon hören, daß unsere Lage Anlaß zu ernsten Besorgnissen geben könnte.
»Wenn Sie recht haben,« sagte ich, »dann müssen wir uns darauf vorbereiten, hier zu überwintern. Unsere Lebensmittel würden nicht reichen, aber wir hätten ja die Robben. Sie verschwinden im Herbst, und ich müßte bald beginnen, uns einen Vorrat an Fleisch anzulegen. Dann müßten wir Hütten bauen und Treibholz sammeln. Wir müßten auch Robbentran auslassen, um Leuchtmaterial zu haben. Überhaupt hätten wir alle Hände voll zu tun, wenn wir wirklich die Insel unbewohnt fänden. Aber das werden wir nicht, denke ich.«
Doch sie hatte recht. Wir segelten am Winde die Küste entlang, suchten sie mit unseren Gläsern ab und landeten hier und dort, ohne eine Spur menschlichen Lebens zu finden. Wir erfuhren jedoch, daß wir nicht die ersten auf der Mühsalinsel waren. Hoch auf dem Strande der zweiten Bucht, von der unseren gerechnet, entdeckten wir das zersplitterte Wrack eines Bootes – eines Robbenfängerbootes, denn die Dollen waren mit geflochtenem Stroh umwunden, an Steuerbord vorn befand sich ein Gewehrgestell, und mit weißen Buchstaben stand da – kaum noch leserlich – ›Gazelle No. 2‹. Das Boot mußte lange hier gelegen haben, denn es war halb mit Sand gefüllt, und das zersplitterte Holz war so verwittert, wie es nur wird, wenn es lange Wind und Wetter ausgesetzt ist. Am Achtersitz fand ich eine glatte Schrotflinte und ein abgebrochenes Matrosenmesser, das so verrostet war, daß man kaum noch erkennen konnte, aus welchem Material es bestand.
»Die sind jedenfalls von hier weggekommen!« sagte ich fröhlich, aber ich fühlte, wie mir das Herz sank, und ich hatte das unangenehme Gefühl, daß irgendwo auf diesem Strande gebleichte Knochen liegen mußten. Ich wollte nicht, daß Mauds Stimmung durch einen solchen Fund bedrückt würde, und so wandte ich unser Boot wieder seewärts und lief um die Nordspitze der Insel. Die Südküste wies keinen Strand auf, und früh am Nachmittage umsegelten wir das schwarze Vorgebirge und beendeten damit die Umsegelung der Insel. Ich schätzte ihren Umfang auf fünfundzwanzig Meilen, ihre Breite mochte zwischen zwei und fünf Meilen schwanken, während ich die Zahl der Robben an ihrer Küste bei vorsichtiger Schätzung auf zweihunderttausend veranschlagte. Im Südwesten war die Insel am höchsten, die Vorgebirge und das Innere fielen allmählich nach Nordosten ab, wo sie sich nur wenige Fuß über den Meeresspiegel erhob. Mit Ausnahme unserer kleinen Bucht stieg die Küste von den Schären sanft an und bildete eine Felsenwiese, wie ich es nennen möchte, die stellenweise mit Moos und Tundrengras bewachsen war. Hier tummelten sich die Robben, die alten Bullen mit ihren Harems, während die jungen Bullen unter sich blieben.
Mehr als diese kurze Beschreibung verdient die Mühsalinsel nicht. Wo es keine Felsen gab, war sie feucht und sumpfig. Stürme und Meer peitschten sie, und die Luft erdröhnte unaufhörlich von dem Brüllen der zweihunderttausend Seetiere. Es war ein trauriger, elender Aufenthalt. Maud, die mich auf die Enttäuschung vorbereitet hatte und den ganzen Tag lebhaft und munter gewesen, war am Ende ihrer Selbstbeherrschung, als wir wieder in unserer kleinen Bucht landeten. Sie bemühte sich tapfer, es mir zu verbergen, als ich aber ein neues Feuer anzündete, wußte ich, daß sie ihr Schluchzen unter den Decken in ihrem Zelt zu ersticken suchte.
Jetzt war die Reihe, den Kopf hochzuhalten, an mir, und ich spielte meine Rolle so geschickt und mit solchem Erfolg, daß ich das Lachen wieder in ihre süßen Augen und den Gesang auf ihre Lippen brachte, denn ehe sie sich niederlegte, sang sie mir etwas vor. Es war das erstemal, daß ich sie singen hörte, und ich lag am Feuer, lauschte und war hingerissen, denn sie war Künstlerin in allem, was sie tat, und ihre Stimme war zwar nicht groß, aber wunderbar süß und ausdrucksvoll.
Ich schlief immer noch im Boot, und ich lag diese Nacht lange wach, starrte zu den ersten Sternen empor, die ich seit vielen Nächten sah, und überdachte unsere Lage. Ein Verantwortungsgefühl dieser Art war mir etwas ganz Neues. Wolf Larsen hatte recht gehabt. Ich hatte auf den Füßen meines Vaters gestanden. Meine Rechtsbeistände und geschäftlichen Berater hatten meine Interessen wahrgenommen. Ich selbst hatte keinerlei Verantwortung gekannt. Erst auf der ›Ghost‹ hatte ich gelernt, die Verantwortung für mich selbst zu tragen. Und jetzt befand ich mich zum erstenmal in meinem Leben in der Lage, für einen andern Menschen verantwortlich sein zu müssen. Und es sollte die schwerste Verantwortung sein, die es für einen Menschen überhaupt gibt, denn sie war die einzige Frau auf der Welt – – das einzige kleine Mädchen, wie ich sie in Gedanken zu nennen pflegte.
Kein Wunder, daß wir unser Eiland die Mühsalinsel nannten. Zwei Wochen mühten wir uns ab, um eine Hütte zu bauen. Maud bestand darauf, mir zu helfen, und ich hätte über ihre zerrissenen, blutenden Hände weinen mögen. Aber dabei war ich stolz auf sie. Es war etwas Heroisches an dieser zarten Frau, wie sie alle Leiden ertrug und sich mit ihren geringen Kräften Aufgaben unterwarf, die sonst nur das Los einer Bauernfrau sind. Sie sammelte viele der Steine, die ich zum Bau der Mauer gebrauchte, und wollte nicht hören, wenn ich sie beschwor, sich auszuruhen. Schließlich ging sie jedoch ein Kompromiß mit mir ein und übernahm die leichten Arbeiten: das Kochen und das Sammeln von Treibholz und Moos für unsern nötigen Winterbedarf.
Die Wände der Hütte erhoben sich ohne Schwierigkeiten, und alles ging leicht von der Hand, bis ich vor der Frage stand, wie ich das Dach verfertigen sollte. Welchen Zweck hatten die vier Wände ohne Dach? Und woraus sollten wir das Dach machen? Wir hatten allerdings die überzähligen Riemen. Sie konnten als Sparren dienen. Aber womit sollte ich sie decken? Moos hatte keinen Zweck. Tundragras war nicht zu gebrauchen. Das Segel brauchten wir für das Boot, und die Persenning ließ schon Wasser durch.
»Winters hat Walroßhäute für seine Hütte benutzt«, sagte ich.
»Wir haben ja Robben«, riet sie.
So begann am nächsten Tage die Jagd. Ich konnte nicht schießen und machte mich daran, es zu lernen. Als ich aber einige dreißig Patronen auf drei Robben verschwendet hatte, sah ich ein, daß unsere Munition erschöpft sein mußte, ehe ich genügend Übung im Schießen erlangt hatte. Ich hatte acht Patronen zum Feueranmachen gebraucht, bis ich auf den Einfall kam, die glimmende Asche mit feuchtem Moos zu bedecken, denn wir hatten kaum noch hundert Patronen.
»Wir müssen die Robben mit Knüppeln erschlagen«, verkündete ich Maud, als ich mich von meiner Unmöglichkeit als Schütze überzeugt hatte. »Ich habe die Robbenjäger von dieser Art, die Tiere zu töten, reden hören.«
»Die Tiere sind so hübsch«, hielt sie mir entgegen. »Das ist nicht auszudenken. Es ist so furchtbar brutal, so ganz anders als Schießen.«
»Das Dach muß gemacht werden«, sagte ich grimmig. »Der Winter steht vor der Tür. Es handelt sich einfach darum: Wir oder sie? Es ist ein Unglück, daß wir nicht mehr Munition haben, aber ich glaube übrigens, daß sie weniger leiden, wenn sie mit dem Knüppel niedergeschlagen, als wenn sie zusammengeschossen werden. Zudem werde ich ja das Niederschlagen besorgen.«
»Das ist es ja gerade –« begann sie eifrig, um in plötzlicher Verwirrung abzubrechen.
»Natürlich,« begann ich, »wenn Sie vorziehen – –« »Aber was soll ich denn tun«, unterbrach sie mich mit dieser Sanftmut, der ich, wie ich wohl wußte, nicht widerstehen konnte.
»Holz für das Feuer sammeln und das Essen kochen«, erwiderte ich leichthin.
Sie schüttelte den Kopf. »Es würde zu gefährlich für Sie sein, die Tiere allein anzugreifen. – Ich weiß, ich weiß«, kam sie meinen Einwänden zuvor. »Ich bin nur eine schwache Frau, aber gerade meine geringe Hilfe kann unter Umständen ein Unglück verhüten.« »Aber das Töten?« warf ich ein.
»Natürlich, das werden Sie besorgen. Ich werde wahrscheinlich schreien. Ich werde fortblicken, wenn –« »Wenn die Gefahr am höchsten ist«, lachte ich.
»Ich werde selbst bestimmen, wann ich hinsehen muß und wann nicht«, sagte sie ein bißchen von oben herab. Das Ende war natürlich, daß sie mich am nächsten Morgen begleitete. Ich ruderte an die anstoßende Bucht und ganz an das Ufer, wo die brüllenden Robben zu Tausenden lagen – wir mußten förmlich schreien, um uns einander verständlich zu machen.
»Ich weiß, daß man sie mit Knüppeln erschlägt«, sagte ich mit einem Versuch, mich anzufeuern, indem ich zweifelnd auf einen großen Bullen blickte, der, keine dreißig Fuß entfernt, sich auf die Vorderflossen erhob und mich aufmerksam betrachtete. »Aber die Frage ist, wie?«
»Lassen Sie uns Tundragras sammeln und das Dach damit decken«, sagte Maud.
Sie war ebenso ängstlich wie ich bei dieser Aussicht auf den bevorstehenden Kampf, und daß wir Grund genug dazu hatten, mußten wir uns selber sagen, als wir jetzt aus der Nähe die schimmernden Zahnreihen und die hundeähnlichen Mäuler sahen.
»Ich dachte immer, daß sie sich vor dem Menschen fürchteten«, sagte ich.
»Das tun sie wohl auch«, meinte ich einen Augenblick später, als ich das Boot einige Ruderschläge näher an Land gebracht hatte. »Wenn ich kühn an Land ginge, würden sie sich vielleicht aus dem Staube machen?« Aber ich zögerte doch.
»Ich habe einmal von einem Manne gehört, der in eine Brutstätte wilder Gänse eindrang,« sagte Maud, »sie töteten ihn.«
»Die Gänse.«
»Ja, die Gänse. Mein Bruder hat mir davon erzählt.« »Aber ich weiß, daß man sie mit Knüppeln erschlägt«, sagte ich hartnäckig.
»Ich glaube, Tundragras würde ein ebenso gutes Dach abgeben«, meinte sie.
Ihre Worte verfehlten ihre Wirkung und trieben mich erst recht an. Ich konnte unmöglich vor ihren Augen feige sein.
»Los!« sagte ich, indem ich den Riemen durchs Wasser zog und den Bug auf den Strand laufen ließ.
Ich stieg aus und rückte tapfer einem langmähnigen Bullen entgegen, der dort inmitten seiner Frauen lag. Ich war mit dem gewöhnlichen Knüppel bewaffnet, mit dem die Bootspuller die angeschossenen Robben erschlagen, die dann durch die Jäger mit einem Haken an Bord gezogen werden. Der Knüppel war nur anderthalb Fuß lang, und in meiner prachtvollen Unwissenheit ließ ich mir nicht träumen, daß der Knüppel, der zum Robbenschlagen an Land gebraucht wird, vier bis fünf Fuß mißt. Die Kühe watschelten mir aus dem Wege, und die Entfernung zwischen mir und dem Bullen verringerte sich. Er erhob sich auf seine Flossen und schien sehr beleidigt zu sein. Es waren jetzt noch einige Meter zwischen uns, aber ich rückte immer weiter vor in der Erwartung, daß er kehrtmachen und davonlaufen sollte.
Als ich noch zwei Meter entfernt war, überkam mich plötzlich ein furchtbarer Schrecken. Was geschah, wenn er nicht davonlief? Nun, dann würde ich ihn eben niederschlagen, antwortete ich mir. In meiner Angst hatte ich ganz vergessen, daß ich nicht gekommen war, um den Bullen in die Flucht zu jagen, sondern um ihn zu töten. Und in diesem Augenblick schnaubte er und stürzte sich knurrend auf mich. Seine Augen flammten, sein Maul stand weit offen, die Zähne leuchteten grausam weiß. Ich gestehe ohne Scham, daß ich meinerseits kehrtmachte und das Hasenpanier ergriff. Er lief ungeschickt, aber doch schnell hinter mir her. Nur zwei Schritte trennten mich noch von ihm, als ich ins Boot taumelte. Ich wehrte ihn mit einem Riemen ab, und seine Zähne gruben sich tief ins Blatt. Das feste Holz zersplitterte wie eine Eierschale. Maud und ich waren bestürzt. Im nächsten Augenblick war er unter dem Boote, packte mit seinen Zähnen den Kiel und schüttelte uns heftig.
»Nein, nein!« rief Maud. »Lassen Sie uns umkehren.« Ich schüttelte den Kopf. »Was andere Männer können, kann ich auch, und ich weiß, daß andere Männer Robben niedergeschlagen haben. Aber ich glaube, das nächste Mal werde ich die Bullen in Ruhe lassen.«
»Tun Sie es nicht!« sagte sie.
»Sagen Sie jetzt nicht ›bitte, bitte‹«, rief ich fast zornig, wie ich glaube.
Sie antwortete nicht, und ich merkte, daß mein Ton sie verletzt haben mußte.
»Verzeihen Sie mir«, sagte oder schrie ich vielmehr, um mich in dem Gebrüll der Rookery verständlich zu machen. »Wenn Sie das sagen, wende ich um und fahre zurück, aber, offen gestanden, möchte ich lieber bleiben.«
»Sagen Sie aber nicht, Sie hätten das davon, daß Sie eine Frau mitgenommen haben«, sagte sie. Sie lächelte rätselhaft, aber hinreißend, und ich wußte, daß es keiner Verzeihung bedurfte.
Ich ruderte einige hundert Fuß den Strand entlang, um meine Nerven zu beruhigen, und ging dann wieder an Land.
»Nur vorsichtig sein!« rief sie mir nach.
Ich nickte und schritt weiter, um einen Flankenangriff auf den nächsten Harem zu machen. Es ging auch alles gut, bis ich einen Schlag auf den Kopf einer Kuh richtete und zu kurz schlug. Sie schnaufte und watschelte schwerfällig fort. Ich lief hinterher und schlug wieder, traf aber statt des Kopfes die Schulter.
»Aufgepaßt!« hörte ich Maud rufen.
In meiner Aufregung hatte ich auf nichts sonst geachtet, und als ich jetzt aufblickte, sah ich den Herrn des Harems hinter mir hersetzen. Wieder floh ich nach dem Boot, aber diesmal machte Maud nicht den Vorschlag, daß wir umkehren sollten.
»Ich denke, es wäre besser, die Harems in Ruhe zu lassen und es mit den einzelnen, harmlosen Robben zu versuchen«, sagte sie. »Ich glaube, einmal darüber gelesen zu haben. In dem Buch von Dr. Jordan, wenn ich nicht irre. Es sind die jungen Bullen, die noch nicht alt genug sind, sich einen eigenen Harem zu halten. Er nannte sie Holluschickis oder so ähnlich. Wir müssen irgendwie herausfinden, wo sie ...«
»Mir scheint, Ihre kriegerischen Instinkte sind erwacht«, lachte ich.
Sie errötete tief. »Ich gebe zu, daß ich mich ebenso ungern wie Sie als überwunden erklären möchte, andererseits bin ich auch nicht begeistert bei dem Gedanken, daß diese hübschen, harmlosen Geschöpfe getötet werden sollen.«
»Hübschen!« sagte ich verächtlich. »Ich habe nichts besonders Hübsches an den geifernden Bestien entdecken können, die mich gejagt haben.«
»Von Ihrem Standpunkt aus haben Sie vielleicht recht!« lachte sie. »Aber Ihnen fehlt die Perspektive. Ja, wenn Sie nicht so nahe an sie heranzugehen brauchten –«
»Das ist es ja«, rief ich. »Ich brauche einen längeren Knüppel. Und da ist der zerbrochene Riemen gerade recht.«
»Mir fällt ein,« sagte sie, »daß Kapitän Larsen mir erzählt hat, wie die Leute es in den Rookerys machen. Sie treiben die Robben in kleinen Herden ein wenig landeinwärts, ehe sie sie töten.«
»Ich lege keinen Wert darauf, einen ganzen Harem zu hüten«, entgegnete ich.
»Aber die Holluschickis«, meinte sie. »Die Holluschickis halten sich abseits, und Dr. Jordan sagt, daß zwischen den Harems Wege frei gelassen werden, und daß die alten Bullen den Holluschickis nichts tun, solange sie sich an diese Wege halten.«
»Da kommt gerade einer!« sagte ich und zeigte auf einen jungen Bullen im Wasser. »Wir wollen ihn beobachten und ihm folgen, wenn er an Land geht.«
Das Tier schwamm direkt an den Strand und kletterte in eine kleine Lücke zwischen zwei Harems, deren Herren Warnrufe ertönen ließen, ihn jedoch nicht angriffen. Wir sahen, wie er sich mühsam auf einem offenbar vorgezeichneten Wege zwischen den Harems hindurchwand.
»Also los jetzt!« sagte ich und trat an Land, aber ich gestehe, daß mir das Herz bis an den Hals schlug bei dem Gedanken, daß ich mitten durch diese ungeheure Herde schreiten sollte.
»Ich glaube, es wäre klug, das Boot festzumachen«, sagte Maud.
Sie war mit mir ausgestiegen, und ich betrachtete sie mit Verwunderung.
Sie nickte entschieden. »Ja, ich begleite Sie, es ist also am besten, Sie sichern das Boot und bewaffnen mich auch mit einem Knüppel.«
»Lassen Sie uns umkehren«, sagte ich mutlos. »Ich denke, Tundragras wird es auch tun.«
»Sie wissen gut, daß es nicht geht«, lautete ihre Antwort. »Soll ich vorausgehen?«
Achselzuckend, aber auch mit wärmster Bewunderung für diese Frau, gab ich ihr den zerbrochenen Riemen und nahm selbst einen anderen. Die ersten Schritte unserer Wanderung machten wir mit großer Angst. Einmal schrie Maud laut, als eine Kuh neugierig ihren Schuh beschnüffelte, und ich beschleunigte meine Schritte aus demselben Grunde. Aber außer einigen warnenden Kläfflauten von beiden Seiten wiesen sich keine Zeichen von Feindseligkeit. Es war eine Rookery, die noch nie einen Jäger gesehen hatte, und die Robben waren daher friedlich und furchtlos zugleich.
Mitten in der Herde war der Lärm entsetzlich, fast schwindelerregend. Ich blieb stehen und lächelte Maud ermutigend zu, denn ich hatte mein Gleichgewicht rascher als sie wiedergefunden. Ich konnte sehen, daß sie sich sehr fürchtete. Sie trat ganz nahe an mich heran und rief:
»Ich fürchte mich schrecklich.«
Aber ich hatte meine Furcht überwunden. Das friedliche Benehmen der Robben hatte mich ermutigt. Maud dagegen zitterte vor Angst.
»Es geht ja alles gut«, versuchte ich sie zu beruhigen und legte unwillkürlich meinen Arm schützend um sie. Nie werde ich vergessen, wie ich mir in diesem Augenblick meiner Männlichkeit bewußt wurde. Die primitiven Tiefen meines Wesens regten sich. Ich fühlte mich als Mann, als Schützer der Schwachen, als kämpfendes Männchen. Und das beste war: Ich fühlte mich als Beschützer meiner Geliebten. Sie lehnte sich an mich, so leicht und fein wie eine Lilie, und als ihr Zittern nachließ, war mir, als besäße ich eine erstaunliche Kraft. Ich hatte das Gefühl, es mit dem wildesten Bullen der Herde aufnehmen zu können, und ich weiß: Hätte mich ein solcher Bulle angegriffen, ich wäre nicht gewichen, sondern hätte seinen Angriff kaltblütig abgewehrt, und sicher, ich hätte ihn getötet.
»Jetzt ist mir wieder gut«, sagte sie und blickte mich dankbar an. »Lassen Sie uns weitergehen.«
Eine Viertelstunde landeinwärts stießen wir auf die Holluschickis, gewandte junge Bullen, die sich hier in der Einsamkeit ihres Junggesellendaseins austobten und Kraft sammelten für die Tage, da sie sich die Würde von Ehemännern erkämpfen sollten.
Jetzt ging alles glatt. Ich wußte genau, was ich zu tun hatte. Ich schrie, machte drohende Bewegungen mit dem Knüppel und stieß die Faulsten sogar mit dem Riemen, und auf diese Weise schnitt ich schnell einige zwanzig der jungen Burschen von ihren Kameraden ab. Sobald einer von ihnen den Versuch machte, zum Wasser durchzubrechen, stellte ich mich ihm in den Weg. Maud beteiligte sich eifrig am Treiben, und ihr Schreien und Schwingen mit dem abgebrochenen Riemen bedeutete eine große Hilfe für mich. Ich bemerkte aber, daß sie hin und wieder ein Tier durchschlüpfen ließ, wenn es besonders matt und mitgenommen aussah. Versuchte jedoch eines, sich kriegerisch zu widersetzen, dann sah ich, wie ihre Augen leuchteten und sie keck mit dem Knüppel zuschlug.
»Himmel, wie aufregend das ist!« rief sie, als sie aus reiner Ermattung schließlich innehalten mußte. »Ich glaube, ich muß mich setzen.«
Ich trieb die kleine Herde – es war jetzt noch ein Dutzend, den übrigen hatte sie die Flucht erlaubt – einige hundert Schritte weiter landeinwärts, und als sie mich einholte, hatte ich bereits das Abschlachten beendet und war dabei, die Tiere abzuhäuten. Eine Stunde später machten wir uns stolz auf den Rückweg, den Pfad zwischen den Harems entlang. Zweimal machten wir noch den Weg und kehrten mit Häuten beladen zurück, dann glaubte ich, genug für unser Dach zu haben. Ich setzte das Segel, machte einen Schlag aus der Bucht heraus und fuhr mit dem nächsten Schlage in unseren kleinen Schlupfhafen hinein.
»Es ist gerade wie eine Heimkehr«, sagte Maud, als ich das Boot auf den Strand laufen ließ.
Ihre Worte weckten ein zitterndes Echo in meiner Seele, alles war mir so lieb und vertraut, und ich sagte: »Mir ist, als hätte ich stets dieses Leben gelebt. Die Welt der Bücher und Buchgelehrten ist so unwirklich, eher Traum als Tatsache. Es ist sicher, daß ich all meine Tage gejagt und gekämpft habe. Und Sie scheinen auch ein Teil davon zu sein. Sie sind – –« ich war nahe daran, »mein Weib, meine Gefährtin« zu sagen, besann mich aber noch und sagte schnell: »Sie haben die Prüfung gut bestanden.«
Aber ihr Ohr hatte mein Stocken bemerkt, und sie warf mir einen raschen Blick zu.
»Das wollten Sie nicht sagen.«
»Nein, sondern daß die große Dichterin Maud Brewster jetzt das Leben einer Wilden führt und sich glänzend damit abfindet«, sagte ich leichthin.
»Oh!« war alles, was sie antwortete. Aber ich hätte schwören mögen, einen Klang von Enttäuschung in ihrer Stimme zu hören.
Doch ›mein Weib, meine Gefährtin‹ hallte in mir den Rest des Tages und noch manchen andern Tag nach, nie aber lauter als an diesem Abend, als sie das Moos von den glimmenden Scheiten nahm, das Feuer anfachte und das Abendbrot kochte. Geheime Wildheit mußte in mir wachgerüttelt sein, denn die alten Worte, die so eng mit den Wurzeln der Urrasse verbunden waren, packten und durchschauerten mich. Und ich hörte sie, bis ich, sie vor mich hinmurmelnd einschlief.
»Es wird riechen«, sagte ich, »aber es wird uns jedenfalls vor Regen und Schnee schützen.« Wir musterten das fertige Dach aus Robbenfellen.
»Es ist ziemlich plump, aber es erfüllt seinen Zweck, und das ist die Hauptsache«, fuhr ich fort in der Hoffnung, ein Lob aus ihrem Munde zu hören.
Und sie klatschte in die Hände und erklärte, daß sie außerordentlich zufrieden sei.
»Aber es ist dunkel hier drinnen«, sagte sie einen Augenblick später, und ihre Schultern zuckten in einem unwillkürlichen Schauder.
»Sie hätten mich daran erinnern sollen, ein Fenster zu machen, als wir die Wände bauten«, sagte ich. »Das war Ihre Sache, und Sie hätten die Notwendigkeit eines Fensters einsehen müssen.«
»Ich sehe nie, was am nächsten liegt«, erwiderte sie lachend. »Außerdem brachen Sie ja aber nur ein Loch in die Wand zu hauen.«
»Das stimmt schon. Daran hatte ich auch schon gedacht«, antwortete ich, das weise Haupt wiegend. »Aber haben Sie Fensterglas bestellt? Rufen Sie beim Glaser an – 4451 ist, glaube ich, die Nummer, und geben Sie ihm Größe und Art der Scheibe an.«
»Das heißt–« begann sie.
»Kein Fenster.«
Die Hütte war natürlich finster und häßlich und wäre in einem zivilisierten Lande kaum gut genug als Schweinekoben gewesen, uns aber, die wir alle Leiden in einem offenen Boote erlebt hatten, erschien sie als ein gemütliches, kleines Haus. Wir sorgten für Licht und Wärme mit Hilfe von Robbentran und einem aus Baumwolle gedrehten Docht, dann begann die Jagd, um uns Fleisch für den Winter zu verschaffen, sowie der Bau einer zweiten Hütte. Jetzt war es eine Kleinigkeit, morgens auszuziehen und gegen Mittag mit einer ganzen Bootsladung Robben heimzukehren. Und während ich an der zweiten Hütte baute, briet Maud den Speck zu Tran aus und unterhielt ein langsames Feuer unter dem Fleisch. Ich hatte gehört, wie man auf der Prärie Büffelfleisch in Streifen schneidet und an der Luft trocknet, und nun schnitten wir unser Robbenfleisch in Streifen, hängten es in den Rauch, und es wurde prachtvoll geräuchert.
Der Bau der zweiten Hütte ging leichter vonstatten, denn ich ließ sie direkt an die erste stoßen, so daß sie nur drei Wände brauchte. Aber das alles bedeutete doch Arbeit. Maud und ich schafften vom frühen Morgen bis zum Einbruch der Dunkelheit, wir arbeiteten bis an die Grenze unsrer Kraft, so daß wir, wenn die Nacht kam, steif vor Müdigkeit ins Bett krochen und den Schlaf der Erschöpfung wie die Tiere schliefen. Und doch erklärte Maud, daß sie sich in ihrem ganzen Leben nie besser und gesünder gefühlt hätte. Bei mir war dasselbe der Fall, aber sie war so zart, daß ich fürchtete, sie würde zusammenbrechen. Immer wieder sah ich, wie sie sich, nach Erschöpfung ihrer letzten Kräfte, lang auf den Boden legte – ihre Art, sich auszuruhen und wieder zu Kräften zukommen. Und dann stand sie auf und arbeitete wie nur je. Woher sie die Kraft dazu nahm, war mir ein Rätsel.
»Denken Sie an die lange Winterruhe«, erwiderte sie auf meine Ermahnungen. »Dann werden wir noch nach Arbeit schreien!«
An dem Abend, als das Dach meiner Hütte fertig war, hielten wir eine Art Einzugsschmaus. Es war am Ende eines dreitägigen heftigen Sturmes, der von Südost ganz nach Nordost herumgeschwungen war und nun direkt in der Richtung auf unsere Insel wehte. In der Außenbucht donnerte die Brandung gegen die Küste, und selbst in unserm, ganz von Land umschlossenen Innenhafen befand sich das Wasser in starker Bewegung. Die Bergseite der Insel schützte uns nicht vor dem Winde, und er pfiff und heulte um die Hütte, daß ich zeitweise fürchtete, die Mauern würden nicht standhalten. Das Dach, das ich wie ein Trommelfell gespannt und für ganz dicht gehalten hatte, bauschte sich bei jedem Windstoß und ließ Wasserspritzer durch, und in den Mauern zeigten sich unzählige Lücken, trotz aller Mühe, die Maud sich gegeben hatte, um sie mit Moos abzudichten. Aber der Tran brannte hell, und wir fühlten uns trotz alledem warm und behaglich.
Es war in der Tat ein angenehmer Abend, und wir kamen zu dem Ergebnis, daß es noch Geselligkeit auf der Mühsalinsel gab. Wir fühlten uns wohl und sicher. Wir hatten uns nicht allein mit dem Gedanken vertrautgemacht, hier überwintern zu müssen, wir hatten auch bereits unsere Vorbereitungen getroffen. Jetzt konnten uns die Robben gern verlassen, um ihre rätselhafte Reise nach dem Süden anzutreten: wir hatten vorgesorgt. Und auch der Sturm hatte seine Schrecken für uns verloren. Wir waren nicht nur warm und trocken und vorm Winde geschützt, wir hatten auch die weichsten, kostbarsten Betten, die aus Moos gemacht werden konnten. Es war Mauds Idee gewesen, und sie hatte eifersüchtig darüber gewacht, daß nur sie allein das Moos sammelte. Dies sollte die erste Nacht auf der Moosmatratze sein, und ich wußte, daß ich um so süßer schlafen würde, weil sie sie gemacht hatte.
Als sie sich erhob, um zu gehen, wandte sie sich mit einem rätselhaften Ausdruck zu mir und sagte:
»Es wird etwas geschehen, etwas, das uns betrifft. Ich fühle es. Es kommt etwas, kommt zu uns. Jetzt. Ich weiß nicht, was es ist, aber es kommt.«
»Etwas Gutes oder Schlechtes?« fragte ich.
Sie schüttelte den Kopf. »Das weiß ich nicht, aber es ist irgendwo dort.«
Sie wies in die Richtung von See und Wind.
»Wir sind an einer geschützten Küste,« lachte ich, »und ich muß sagen, daß es besser ist, hier zu sein, als an einem solchen Abend anzukommen.«
»Sie fürchten sich doch nicht?« fragte ich, während ich zur Tür schritt, um sie ihr zu öffnen.
Ihre Augen blickten tapfer in die meinen.
»Und Sie fühlen sich wohl? Völlig wohl?«
»Ich habe mich nie besser gefühlt«, lautete ihre Antwort.
Wir sprachen noch ein Weilchen miteinander, bis sie ging.
»Gute Nacht, Maud«, sagte ich.
»Gute Nacht, Humphrey«, sagte sie.
Ohne daß wir darüber gesprochen hätten, nannten wir uns, wie etwas ganz Selbstverständliches, beim Vornamen. Ich hätte sie in diesem Augenblick in meine Arme reißen und an mich pressen können. Draußen in der Welt, der wir angehörten, würden wir es sicher getan haben. Hier aber hemmte mich die merkwürdige Situation, in der wir uns befanden. Als ich dann aber allein in meiner kleinen Hütte war, durchglühte mich ein schönes Gefühl von Zufriedenheit Und ich wußte, daß es ein Band zwischen uns gab, ein schweigendes Etwas, das früher nicht gewesen war.
Ich erwachte mit einem drückenden, geheimnisvollen Gefühl. Etwas in meiner Umgebung schien mir zu fehlen. Aber das Geheimnisvolle und Drückende verschwand, als ich einige Augenblicke wach gelegen hatte und mir darüber klar geworden war, was mir fehlte: Es war der Wind. Ich war in einem Zustand der Nervenanspannung eingeschlafen, wie man ihn beim Vernehmen andauernder Geräusche oder Bewegungen bekommt, und erwacht war ich noch gespannt und vorbereitet auf einen Druck, der nun nicht mehr auf mir lastete.
Es war seit Monaten die erste Nacht, die ich unter Dach verbracht hatte, und einige Minuten lang genoß ich das herrliche Gefühl, mollig unter meinen Decken zu liegen, ohne Nebel und Spritzern ausgesetzt zu sein. Als ich mich angekleidet hatte und die Tür öffnete, hörte ich noch die Wellen gegen den Strand schlagen und vom Sturm der vergangenen Nacht schwatzen. Es war ein klarer Tag, und die Sonne schien. Ich hatte lange geschlafen und trat nun mit plötzlich erwachter Energie aus meiner Hütte, entschlossen, die verlorene Zeit einzuholen, wie es sich für einen Bewohner der Mühsalinsel ziemte.
Draußen aber blieb ich plötzlich stehen. Ich mußte wohl meinen Augen trauen, und doch war ich einen Augenblick betäubt von dem, was sich mir offenbarte. Dort, am Strande, keine fünfzig Fuß entfernt, lag ein entmastetes Schiff. Masten und Spieren, Wanten, Schoote, Leinen und zerfetzte Segel hingen in einem Gewirr über Bord. Ich rieb mir die Augen. Es war die Kombüse, die wir gezimmert hatten, es waren die mir so vertraute Achterhütte und die niedrige Kajüte, die sich kaum über die Reling erhob. Es war die ›Ghost‹.
Welche Laune des Schicksals hatte sie hierhergeführt – gerade hierher? Welcher Zufall oder welche Zufälle? Ich blickte auf die finstere, unübersteigbare Wand hinter mir und fühlte tiefe Verzweiflung. Entrinnen war hoffnungslos, ganz unmöglich. Ich dachte an Maud, die in der Hütte schlief, welche wir erbaut hatten. Ich erinnerte mich ihres »Gute Nacht, Humphrey«, »mein Weib, meine Gefährtin«, tönte es durch mein Hirn, aber ach, jetzt klang es wie Grabgeläute. Dann wurde mir schwarz vor Augen.
Wahrscheinlich war es nur der Bruchteil einer Sekunde, aber mir erschien es wie eine Ewigkeit, bis ich wieder zu mir kam. Dort lag die ›Ghost‹, den Bug gegen die Küste. Ihr zersplitterter Bugspriet ragte über den Strand, das Gewirr ihrer Spieren schlug gegen die dunkle Schiffsseite, wenn die Wellen sie hoben.
Plötzlich fiel mir der seltsame Umstand auf, daß sich nichts an Bord regte. Müde vom nächtlichen Kampf mit der See mochten alle noch schlafen. Mein nächster Gedanke war, daß Maud und ich doch noch entkommen könnten. Wenn wir das Boot erreichten und um die Landzunge fuhren, ehe jemand erwachte? Ich wollte sie rufen und sofort mit ihr aufbrechen, als ich mich entsann, wie klein die Insel war. Wir konnten uns nicht auf ihr verstecken. Uns blieb nichts als das unermeßliche, mitleidlose Meer. Ich dachte an unsere gemütlichen kleinen Hütten, an unsere Vorräte an Fleisch, Tran, Moos und Holz, und mir war klar, daß wir die winterliche See und die großen Stürme, die kommen mußten, nie überstehen konnten.
So stand ich zögernd vor ihrer Tür. Es war unmöglich, unmöglich! Ein wilder Gedanke fuhr mir durch den Kopf: sie töten, während sie schlief. Aber dann faßte ich, wie in einer Erleichterung, einen besseren Entschluß.
Alle schliefen. Warum nicht jetzt an Bord der ›Ghost‹ kriechen – ich kannte ja den Weg zu Wolf Larsens Koje – und ihn töten, ehe er erwachte? Dann – nun, dann würden wir ja sehen. War er erst tot, dann war Zeit, an alles andere zu denken. Und außerdem: Wie die Lage sich auch gestalten mochte – schlechter, als sie jetzt war, konnte sie kaum werden.
Mein Messer hing mir an der Hüfte. Ich ging wieder in die Hütte, um die Büchse zu holen, vergewisserte mich, daß sie geladen war, und schritt zur ›Ghost‹ hinab. Mit einiger Schwierigkeit und nicht, ohne mich bis auf die Haut zu durchnässen, kletterte ich an Bord. Die Backluke stand offen. Ich blieb stehen, um den Atemzügen der Mannschaften zu lauschen, aber nichts regte sich. Ich mußte keuchen bei dem Gedanken, der mir plötzlich durch den Kopf fuhr: Wenn die ›Ghost‹ verlassen war! Wieder lauschte ich. Nichts. Vorsichtig stieg ich die Schiffstreppe hinab. Der Raum strömte den muffigen, kalten Geruch aus, der einer leerstehenden Wohnung anhaftet. Rings über den Fußboden verstreut lagen abgelegte Kleidungsstücke, alte Seestiefel, zerlöchertes Ölzeug – all die wertlosen Dinge, die sich während einer langen Fahrt in der Back ansammeln.
»In größter Hast verlassen!« war meine Schlußfolgerung, als ich wieder an Deck stieg. Die Hoffnung wurde wieder lebendig in meiner Brust, und ich sah mich mit größter Kaltblütigkeit um. Ich bemerkte, daß die Boote fehlten. Das Zwischendeck erzählte dieselbe Geschichte wie die Back. Auch die Jäger hatten eiligst ihre Habseligkeiten zusammengepackt. Die ›Ghost‹ war verlassen. Sie gehörte Maud und mir. Ich dachte an die Vorräte und an die Apotheke unter der Kajüte, und mir kam der Einfall. Maud mit etwas Gutem zum Frühstück zu überraschen.
Die Reaktion und das Bewußtsein, daß ich die schreckliche Tat, deretwegen ich gekommen war, nicht auszuführen brauchte, beseelten mich mit kindlichem Eifer. Ich ging auf die Laufbrücke, indem ich zwei Stufen auf einmal nahm und dachte an nichts Bestimmtes, fühlte nichts außer der Freude und der Hoffnung, daß Maud schlafen würde, bis meine Frühstücksüberraschung fertig war. Als ich um die Kombüse bog, dachte ich mit neuer Freude und Befriedigung an die prächtigen Kochgeräte drinnen. Ich sprang auf den Rand der Achterhütte und sah – – Wolf Larsen. So überwältigt, so betäubt war ich vor Überraschung, daß ich noch drei oder vier Schritte weiterging, ohne anhalten zu können. Er stand auf der Laufbrücke – nur Kopf und Schultern sichtbar – und starrte mir gerade ins Gesicht. Seine Arme ruhten auf der halbgeöffneten Schiebeluke. Er machte keine Bewegung – er stand nur da und starrte mich an.
Ich begann zu zittern. Das alte Gefühl von Übelkeit überkam mich. Ich legte die Hand auf den Rand der Hütte, um mich zu stützen. Meine Lippen schienen plötzlich ausgetrocknet zu sein, und ich befeuchtete sie für den Fall, daß ich sprechen sollte. Meine Augen wichen nicht eine Sekunde von ihm. Keiner von uns beiden sprach. In seinem Schweigen, seiner Unbeweglichkeit lag etwas Unheilverkündendes. All meine alte Furcht kehrte zurück, und dazu kam eine neue, die hundertmal größer war. Und so standen wir da und starrten uns an.
Ich wurde mir der Notwendigkeit bewußt, zu handeln. Aber meine alte Hilflosigkeit hatte mich wieder gepackt, und so wartete ich, daß er die Initiative ergreifen sollte. Die Augenblicke schwanden, und ich sah plötzlich, daß meine Lage dieselbe war wie damals, als ich mich dem großen Robbenbullen genähert hatte: Die Absicht, ihn zu töten, wurde verdrängt von dem Wunsche, ihn fortlaufen zu sehen. Aber endlich dachte ich doch daran, daß ich gekommen war, um selbst zu handeln, nicht, um Wolf Larsen das Heft in die Hand zu geben.
Ich spannte beide Hähne der Büchse und richtete den Lauf auf ihn. Hätte er sich bewegt oder versucht, sich von der Laufbrücke auf mich zu stürzen, ich würde ihn niedergeschossen haben. Aber er blieb unbeweglich stehen und starrte mich weiter an. Und wie ich ihm, die erhobene Büchse in den Händen, ins Gesicht blickte, hatte ich Zeit zu sehen, wie verstört und abgezehrt es aussah. Es war, als hätte eine furchtbare Gemütsbewegung es verwüstet. Die Wangen waren eingesunken, die Stirn war gerunzelt und sorgenvoll. Seltsam erschienen mir seine Augen, und zwar nicht nur im Ausdruck, sondern in ihrer physischen Beschaffenheit, als ob Sehnerven und Bewegungsmuskeln irgendwie beschädigt wären und die Augäpfel sich verrückt hätten.
Alles dies sah ich, denn da mein Hirn jetzt mit ungeheurer Schnelligkeit arbeitete, fuhren mir tausend Gedanken durch den Kopf, und doch konnte ich nicht abdrücken. Ich senkte die Büchse und trat an die Ecke der Kajüte, hauptsächlich um meine Nerven zu beruhigen und dann wieder zu zielen, aber auch, um näher an ihn heranzukommen. Wieder hob ich die Waffe. Ich war jetzt kaum mehr als Armeslänge von ihm entfernt. Es gab keine Hoffnung mehr für ihr. Ich hatte meinen Entschluß gefaßt. Es war unmöglich, ihn zu fehlen, ein so schlechter Schütze ich auch sein mochte. Und doch kämpfte ich mit mir und konnte nicht abdrücken.
»Nun?« fragte er ungeduldig.
Ich versuchte vergebens, meinen Finger zu krümmen, und ebenso vergebens versuchte ich, ein Wort herauszubringen.
»Warum schießen Sie nicht?« fragte er.
Ich räusperte mich, konnte aber nicht sprechen.
»Hump«, sagte er langsam. »Sie können es nicht. Sie sind ohnmächtig. Ihre konventionelle Moral ist stärker als Sie. Sie sind ein Sklave Ihrer alten Anschauungen, der Gesetze, die Ihrem Schädel eingehämmert worden sind, seit Sie die ersten Worte stammelten, und all Ihrer Philosophie und meinen Lehren zum Trotz können Sie einen unbewaffneten, widerstandslosen Menschen nicht töten.«
»Das weiß ich«, sagte ich heiser.
»Und Sie wissen auch, daß ich einen Unbewaffneten ebenso leicht töten würde, wie ich eine Zigarre rauche«, fuhr er fort. »Sie kennen mich und schätzen mich von Ihrem Standpunkt aus ein. Schlange, Tiger, Hai, Ungeheuer und Kaliban haben Sie mich genannt. Und doch können Sie mich nicht töten, Sie Waschlappen, wie Sie eine Schlange oder einen Hai töten würden, weil ich Hände, Füße und einen Körper habe, der dem Ihren ähnlich geformt ist. Ich hätte mehr von Ihnen erwartet, Hump!«
Er überschritt die Laufbrücke und trat zu mir.
»Nehmen Sie das Gewehr herunter. Ich möchte einige Fragen an Sie richten. Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, mich umzuschauen. Was für ein Ort ist dies? Wo liegt die ›Ghost‹? Wieso sind Sie so naß? Wo ist Maud, – Verzeihung, Fräulein Brewster – oder muß ich Frau van Weyden sagen?«
Ich war zurückgetreten und hätte weinen mögen, daß ich unfähig war, ihn niederzuschießen, aber ich war doch nicht so töricht, die Büchse abzusetzen. In meiner Verzweiflung hoffte ich, daß er eine Feindseligkeit begehen, den Versuch machen würde, mich zu schlagen oder zu würgen, denn ich wußte: nur dann war ich imstande, zu schießen.
»Dies ist die Mühsalinsel«, sagte ich.
»Nie den Namen gehört«, unterbrach er mich.
»So nennen wir sie wenigstens«, berichtete ich.
»Wir?« fragte er. »Wer ist ›wir‹?«
»Fräulein Brewster und ich. Und die ›Ghost‹ liegt, wie Sie selbst sehen können, mit dem Bug gegen den Strand.«
»Es sind Robben hier«, sagte er. »Sie haben mich mit ihrem Gebell geweckt, sonst würde ich noch schlafen. Ich hörte sie schon, als ich gestern abend hier hereintrieb. Sie zeigten mir an, daß eine Küste in Lee war. Es ist eine Rookery, so etwas, wie ich es seit Jahren gesucht habe. Dank meinem Bruder Tod bin ich hier auf ein Vermögen gestoßen. Es ist eine Goldgrube. Wie ist die Lage der Insel?«
»Keine Ahnung«, sagte ich. »Aber Sie müssen es doch wissen. Was haben Ihre letzten Beobachtungen ergeben?«
Er lächelte unergründlich, antwortete aber nicht.
»Und wo sind all Ihre Leute?« fragte ich. »Wie kommt es, daß Sie allein sind?«
Ich war darauf vorbereitet, daß er auch diese Frage unbeachtet lassen würde, und seine willige Antwort überraschte mich.
»Ehe achtundvierzig Stunden vergangen waren, hatte mein Bruder mich gekriegt, aber es war, weiß Gott, nicht meine Schuld. Er enterte mein Schiff nachts, als nur ein Wachtposten an Deck war. Die Jäger ließen mich im Stich. Er bot ihnen mehr. Ich hörte es mit an. Er tat es vor meinen Augen. Die Mannschaft ging natürlich auch. Das konnte ich nicht anders erwarten. Alle Mann verließen mich, und da stand ich – ausgesetzt auf meinem eigenen Schiff. Diesmal hatte mein Bruder Tod gesiegt.«
»Aber wie haben Sie denn die Masten verloren?« fragte ich.
»Gehen Sie hin und sehen Sie sich die Taljenreeps an«, sagte er und wies nach der Stelle, wo die Besantakelung sich hätte befinden müssen.
»Mit dem Messer durchgeschnitten!« rief ich aus.
»Nicht ganz«, lachte er. »Viel feinere Arbeit. Sehen Sie sich's noch einmal an.«
Ich sah: Die Taljenreeps waren so weit durchgeschnitten, daß sie die Wanten gerade noch halten konnten, bis eine besondere Anforderung an sie gestellt wurde. »Das ist Köchleins Werk«, lachte er wieder. »Ich weiß es, obgleich ich ihn nicht dabei erwischt habe. So ein bißchen Abrechnung.«
»Das hat Mugridge nicht schlecht gemacht!« rief ich.
»Ja, das dachte ich auch, als die ganze Geschichte über Bord ging.«
»Aber was haben Sie denn getan, als dies alles geschah?« fragte ich.
»Was ich tun konnte. Aber es war unter diesen Umständen nicht viel, das können Sie mir glauben.«
Ich wandte mich um, um Mugridges Werk noch einmal zu betrachten.
»Ich glaube, ich will mich ein bißchen in die Sonne setzen«, hörte ich Wolf Larsen sagen.
Es war ein Anflug, ein ganz leiser Anflug von körperlicher Schwäche in seiner Stimme, und das wirkte so eigentümlich, daß ich einen raschen Blick auf ihn warf. Er fuhr sich mit der Hand nervös über das Gesicht, als ob er ein Spinngewebe fortwischte Ich war bestürzt. Das alles war so unähnlich dem Wolf Larsen, den ich kannte.
»Wie steht es mit Ihren Kopfschmerzen?« fragte ich. »Die plagen mich immer noch«, lautete die Antwort. »Ich glaube, es geht jetzt gerade wieder los.«
Er ließ sich ganz zu Boden gleiten. Dann rollte er sich auf die Seite, stützte den Kopf auf den Unterarm; während er mit dem Oberarm seine Augen vor der Sonne schützte. Ich blickte ihn verwundert an.
»Jetzt ist Ihre Gelegenheit gekommen, Hump«, sagte er.
»Ich verstehe Sie nicht«, log ich, denn ich verstand ihn gut.
»Ach, nichts«, setzte er gleichsam schläfrig hinzu.
»Sie haben mich jetzt da, wo Sie mich haben wollten.« »Nein, das stimmt nicht,« erwiderte ich, »ich wünschte Sie tausend Meilen fort von hier.«
Er lachte, sagte aber nichts weiter. Als ich an ihm vorbeischritt, um in die Kajüte hinunterzusteigen, bewegte er sich nicht. Ich hob die Falltür im Fußboden und blickte eine Weile unschlüssig in die Apotheke hinunter. Ich zögerte. Wie, wenn er sich nur verstellte? Das wäre in der Tat hübsch, dann saß ich hier wie die Ratte in der Falle! Ich schlich mich leise auf die Laufbrücke und blickte verstohlen auf ihn hinab. Er lag noch da, wie ich ihn verlassen hatte. Wieder stieg ich hinunter; ehe ich mich jedoch in die Apotheke gleiten ließ, beobachtete ich die Vorsicht, die Klappe herunterzulassen. So konnte die Falle jedenfalls nicht zuschnappen. Aber meine Vorsicht erwies sich als überflüssig. Ich kam in die Kajüte mit einem Vorrat von allerlei Eingemachtem, Schiffszwieback, Büchsenfleisch und ähnlichem – so viel ich zu tragen vermochte – und schloß die Falltür wieder.
Ein Blick auf Wolf Larsen zeigte mir, daß er sich nicht geregt hatte. Ein neuer Gedanke kam mir. Ich stahl mich in seine Kabine und eignete mir seine Revolver an. Andere Waffen fand ich nicht, obwohl ich die drei andern Kabinen gründlich untersuchte. Um ganz sicher zu sein, ging ich noch einmal durch Zwischendeck und Back und nahm alle Messer an mich. Dann fiel mir das große Klappmesser ein, das er stets in der Tasche trug. Ich trat zu ihm und sprach ihn zuerst leise, dann lauter an. Er regte sich nicht. Ich beugte mich über ihn und zog ihm das Messer aus der Tasche, jetzt atmete ich freier. Er hatte keine Waffe mehr, um mich von weitem anzugreifen, während ich – jetzt bewaffnet – imstande war, ihm zuvorzukommen, wenn er den Versuch machen sollte, mich mit seinen furchtbaren Gorillaarmen zu packen.
Ich füllte eine Kaffeekanne und eine Bratpfanne mit einem Teil meiner Beute, nahm etwas Geschirr aus der Anrichte in der Kajüte, überließ Wolf Larsen sich selbst und ging an Land.
Maud schlief noch. Ich fachte die glimmende Asche an und machte mich in fieberhafter Hast daran, das Frühstück zu bereiten. Als ich beinahe fertig war, hörte ich ihre Schritte aus der andern Hütte. Ich hatte gerade den Kaffee eingegossen, da öffnete sich die Tür, und sie trat ein.
»Das ist nicht recht von Ihnen!« Mit diesen Worten begrüßte sie mich. »Sie haben meine Vorrechte verletzt. Sie wissen doch, daß das Kochen meine Sache ist und –«
»Nur dies eine Mal«, bat ich.
»Wenn Sie versprechen, es nicht wieder zu tun«, lächelte sie. »Es sei denn, daß Sie meiner geringen Leistungen müde geworden wären.«
Zu meiner großen Freude hielt sie nicht ein einziges Mal Ausschau nach dem Strande, und ich konnte den Erfolg verzeichnen, daß sie, ohne etwas zu merken, ihren Kaffee aus der Porzellantasse trank und sich Marmelade auf einen Zwieback strich. Aber das dauerte natürlich nicht lange. Ich sah ihre Überraschung. Sie hatte gemerkt, daß sie von einem Porzellanteller aß. Ihre Augen fielen auf das Frühstück, und nun sah sie eines nach dem andern. Dann blickte sie mich an und wandte das Gesicht langsam nach dem Strande. »Humphrey!« rief sie.
Der alte, unsagbare Schrecken stieg in ihre Augen. »Ist – – er – –?« fragte sie zitternd. Ich nickte.
Wir warteten den ganzen Tag, daß Wolf Larsen an Land käme. Wir befanden uns in unerträglicher Spannung. Bald sah der eine, bald der andere angstvoll nach der ›Ghost‹. Aber er kam nicht. Er zeigte sich nicht einmal an Deck.
»Vielleicht hat er seine Kopfschmerzen«, sagte ich. »Als ich ihn verließ, lag er auf der Achterhütte. Dort mag er die ganze Nacht gelegen haben. Ich glaube, ich werde einmal hinübergehen und nachsehen.«
Maud sah mich flehend an.
»Es ist ganz gefahrlos«, versicherte ich ihr. »Ich nehme die Revolver mit. Sie wissen, daß ich alle Waffen genommen habe, die es an Bord gab.«
»Aber seine Arme, seine Hände, seine entsetzlichen Hände!« erwiderte sie. Und dann rief sie laut: »Ach Humphrey, ich fürchte mich so vor ihm! Gehen Sie nicht – bitte gehen Sie nicht!«
Sie legte ihre Hand bittend auf die meine, und mein Puls flog. In diesem Augenblick verrieten meine Augen sicher, was ich fühlte. Das liebe, entzückende Mädchen! Ich wollte meinen Arm um sie legen, wie damals in der Robbenherde, aber ich bedachte mich und hielt mich zurück.
»Es ist nicht gefährlich für mich«, sagte ich. »Ich werde nur über den Bug lugen.«
Sie drückte mir innig die Hand und ließ mich gehen. Aber die Stelle an Deck, wo ich ihn hatte liegenlassen, war leer. Er war offenbar nach unten gegangen. Diese Nacht wachten wir abwechselnd, denn niemand konnte wissen, was Wolf Larsen einfallen konnte. Er war zu allem fähig.
Wir warteten sowohl den nächsten Tag wie den darauffolgenden, ohne daß er ein Lebenszeichen gegeben hätte.
»Es sind wohl wieder die Kopfschmerzen«, sagte Maud am Nachmittag des vierten Tages, »vielleicht ist er krank, sehr krank, oder gar tot.«
»Oder er liegt im Sterben«, fügte sie hinzu, nachdem sie einen Augenblick auf meine Antwort gewartet hatte.
»Um so besser!« erwiderte ich.
»Aber denken Sie, Humphrey, ein Mitmensch in seiner letzten einsamen Stunde!«
»Vielleicht«, meinte ich.
»Ja, vielleicht«, räumte sie ein. »Wir wissen es nicht. Aber wenn, dann wäre es schrecklich. Ich würde es mir nie verzeihen. Wir müssen etwas tun.«
»Vielleicht«, meinte ich wieder.
Ich wartete, innerlich über das Weib in ihr lächelnd, daß sie sich um Wolf Larsen sorgen ließ, gerade um ihn! Wo ist jetzt ihre Sorge um mich, dachte ich, den sie vorhin kaum über die Reling hatte blicken lassen wollen.
Sie war zu feinfühlig, um nicht zu erraten, was hinter meinem Schweigen lag. Und ihre Offenheit gab ihrer Feinfühligkeit nichts nach.
»Sie müssen an Bord gehen und einmal nachsehen, Humphrey«, sagte sie. »Und wenn Sie mich auslachen wollen, so haben Sie meine Einwilligung und meine Verzeihung dazu.«
Ich erhob mich gehorsam und schritt zum Strande hinab.
»Aber seien Sie vorsichtig!« rief sie mir nach.
Ich winkte ihr von der Back aus und ließ mich auf das Deck gleiten. Dann ging ich nach achtern auf die Laufbrücke und rief Wolf Larsen. Er antwortete und schickte sich an, die Treppe heraufzusteigen, und ich spannte meinen Revolver. Ich tat es ganz offen, aber er nahm keine Notiz davon. Er machte körperlich denselben Eindruck wie das letztemal, als ich ihn gesehen hatte, aber er war finster und schweigsam. Die wenigen Worte, die wir wechselten, konnten kaum eine Unterhaltung genannt werden. Ich fragte ihn nicht, warum er nicht an Land, und er mich nicht, warum ich nicht an Bord gekommen war. Seine Kopfschmerzen waren, wie er sagte, besser, und so verließ ich ihn ohne weiteres Parlamentieren.
Maud hörte meinen Bericht mit sichtlicher Erleichterung, und der Anblick des Rauches, der sich etwas später aus der Kombüse erhob, versetzte sie in bessere Stimmung. Am nächsten und übernächsten Tage sahen wir wieder den Rauch aufsteigen, und hin und wieder ließ Wolf Larsen sich auf der Achterhütte sehen. Aber das war auch alles. Er machte keinen Versuch, an Land zu kommen. Das wußten wir, denn wir hielten weiter unsere Nachtwachen. Seine Untätigkeit ängstigte und beunruhigte uns.
Auf diese Weise verging eine ganze Woche. Wir hatten keinen andern Gedanken als Wolf Larsen, und der Druck, den seine Anwesenheit auf uns ausübte, hinderte uns, uns irgendwie mit den Dingen, die wir geplant hatten, zu befassen.
Aber am Ende der Woche hörte der Rauch auf, aus dem Kombüsenschornstein zu steigen, und Wolf Larsen zeigte sich nicht mehr auf der Achterhütte. Ich konnte sehen, wie Mauds Besorgnis wieder wuchs, wenn sie sich auch scheute oder vielleicht zu stolz war, ihre Bitte zu wiederholen. Konnte man ihr einen Vorwurf daraus machen? Mir war selbst nicht wohl zumute bei dem Gedanken, daß dieser Mann, den ich zu töten versucht hatte, so nahe seinen Mitmenschen allein sterben sollte. Er hatte recht: Die Tatsache, daß er Hände, Füße und Körper hatte wie ich, bedeutete eine Forderung, die ich nicht außer acht lassen konnte. Das zweitemal wartete ich daher nicht, bis Maud mich schickte. Ich stellte fest, daß wir kondensierte Milch und Marmelade brauchten, und eröffnete ihr, daß ich an Bord gehen wollte. Ich konnte sehen, daß sie schwankte. Sie ging sogar soweit, zu murmeln, daß die Sachen nicht so wichtig wären, und daß mein Ausflug ergebnislos verlaufen könnte. Und wie sie früher aus meinem Schweigen meine Gedanken erraten hatte, so hörte sie jetzt aus meinen Worten heraus, daß ich nicht um der kondensierten Milch und der Marmelade willen an Bord ging, sondern wegen ihrer Besorgnis, die sie nicht hatte verbergen können.
Als ich bei der Back war, zog ich mir die Schuhe aus und ging auf Strümpfen geräuschlos nach achtern. Diesmal rief ich auch nicht von der Laufbrücke. Ich stieg vorsichtig hinunter und fand die Kajüte leer. Die Tür zu seiner Kabine war verschlossen. Ich dachte zuerst daran, anzuklopfen, erinnerte mich dann aber meiner vorgeschobenen Absicht und entschloß mich, sie auszuführen. Sorgfältig jedes Geräusch vermeidend, hob ich die Falltür im Boden und legte sie um. In der Apotheke wurden sowohl Kleidungsstücke wie Lebensmittel aufbewahrt, und ich nahm die Gelegenheit wahr, mich mit Unterwäsche zu versehen.
Als ich wieder heraufkam, hörte ich ein Geräusch aus Wolf Larsens Kabine. Ich duckte mich und lauschte. Der Türgriff knarrte. Instinktiv schlich ich mich hinter den Tisch zurück und spannte meinen Revolver. Die Tür öffnete sich, und er erschien. Nie hatte ich eine so tiefe Verzweiflung gesehen wie die, welche sich auf seinem Gesicht – dem Gesicht Wolf Larsens, des Kämpfers, des starken Mannes, des Unbezwinglichen – ausprägte. Wie ein Weib, das die Hände ringt, hob er die geballten Fäuste und stöhnte. Dann ließ er die eine Hand sinken und fuhr sich mit der Handfläche langsam über die Augen, als wischte er Spinnweben beiseite.
»Gott, Gott!« stöhnte er, und wieder hob er die Fäuste in der unendlichen Verzweiflung, die in seiner Kehle zitterte.
Es war gräßlich. Ich zitterte am ganzen Körper und konnte fühlen, wie mir der Schauder den Rücken entlang rann und der Schweiß auf die Stirn trat. Es gibt sicher wenige Dinge in der Welt, die furchtbarer sein können als der Anblick eines Starken in dem Augenblick seiner äußersten Schwäche, seines völligen Zusammenbruches.
Aber durch die Anspannung seines unbezwinglichen Willens gewann Wolf Larsen seine Selbstbeherrschung wieder. Es war eine mächtige Anspannung. Seine ganze Gestalt wurde von dem Kampfe geschüttelt. Es sah aus, als sollte er im nächsten Augenblick bewußtlos niederstürzen. Sein Gesicht zuckte und verzerrte sich vor Schmerz, bis er wieder zusammenbrach. Und wieder hob er die Fäuste und stöhnte. Ein –, zweimal schöpfte er tief Atem und seufzte. Dann gelang es. Ich hätte fast glauben können, daß es der alte Wolf Larsen war, und doch lag in seinen Bewegungen eine Andeutung von Schwäche und Unentschlossenheit.
Ich war beunruhigt, begann mich zu fürchten. Er mußte auf seinem Wege auf die offene Falltür stoßen, und das hieß, daß er mich entdeckte. Ich war wütend auf mich selbst bei dem Gedanken, in dieser feigen Stellung, auf dem Boden kriechend, gefaßt zu werden. Noch war Zeit. Ich sprang auf und nahm ganz unbewußt eine trotzige Haltung ein. Aber er beachtete mich gar nicht. Auch die offene Falltür schien er nicht zu beachten. Ehe ich noch die Situation richtig verstanden hatte, war er in die Öffnung getreten. Der eine Fuß glitt hinein, während der andere gerade im Begriff war, sich zu heben. Als er aber den festen Boden unter sich vermißte und die Leere spürte, war er im selben Augenblick wieder der alte Wolf Larsen mit seinen Tigermuskeln. Im Fallen schleuderte er seinen Oberkörper hinüber, so daß er mit ausgestreckten Armen auf Brust und Bauch drüben landete. Im nächsten Augenblick hatte er die Beine hochgezogen und war aus dem Loch heraus. Aber er rollte in meine Marmelade und mein Unterzeug.
Sein Gesichtsausdruck zeigte, daß er wußte, was hier vorging. Bevor ich jedoch seine Gedanken erraten konnte, hatte er schon die Falltür über der Apotheke geschlossen. Da verstand ich. Er dachte, er hätte mich gefangen. Er war blind, stockblind. Mit zurückgehaltenem Atem, um mich nicht zu verraten, beobachtete ich ihn. Er trat schnell in seine Kabine. Ich sah, wie seine Hand den Türgriff verfehlte, tastete, ihn aber nicht fand. Das war eine günstige Gelegenheit. Ich lief auf Zehenspitzen durch die Kajüte und die Treppe hinauf. Er kam zurück und schleppte eine schwere Seekiste hinter sich her, die er auf die Falltür stellte. Dann nahm er die Marmelade und das Unterzeug und legte alles auf den Tisch. Als er dann nach oben ging, zog ich mich schnell zurück und kletterte geräuschlos auf die Hütte.
Er schob die Schiebetür ein wenig beiseite und stützte die Arme darauf, blieb aber auf der Laufbrücke stehen. Es hatte den Anschein, als blicke oder starre er vielmehr das Deck des Schoners entlang, denn seine Augen waren ganz starr und blinzelten nicht. Ich stand nur fünf Fuß entfernt von ihm – gerade vor seinen Augen. Es war unheimlich. Ich kam mir wie ein unsichtbarer Geist vor. Ich winkte mit der Hand, natürlich ohne jede Wirkung. Als aber der flackernde Schatten einmal sein Gesicht traf, sah ich sofort, daß er etwas gemerkt hatte. Sein Gesicht drückte höchste Erwartung und Spannung aus, als versuche er, sich über den erhaltenen Eindruck klar zu werden. Er wußte, daß er auf irgend etwas, das draußen geschah, reagierte, daß irgend etwas in seiner Umgebung vorging, aber was es war, darüber konnte er sich nicht klar werden. Ich hörte auf, die Hand zu schwenken, so daß auch der Schatten sich nicht mehr bewegte. Er wandte langsam den Kopf von einer Seite zur andern, hin und zurück, jetzt in die Sonne, dann wieder in den Schatten, indem er sich durch das Gefühl zu orientieren versuchte.
Ich bemühte mich ebenso eifrig wie er, die Ursache zu entdecken, daß man etwas so Unfühlbares wie einen Schatten fühlen konnte. Wenn nur die Augäpfel beschädigt und die Sehnerven nicht ganz zerstört waren, war die Erklärung einfach. Sonst konnte ich mir nur denken, daß die empfindliche Haut den Temperaturunterschied zwischen Schatten und Sonnenschein spürte. Oder vielleicht – wer könnte es sagen? – war es der so viel umstrittene sechste Sinn, der ihm ein Gefühl des Wechsels von Licht und Schatten übermittelte. Er gab jedoch bald den Versuch auf, sich über dieses Phänomen klar zu werden, und schritt mit einer Schnelligkeit und Sicherheit, die mich überraschten, über das Deck. Und doch lag in seinem Gang diese Andeutung von Schwäche, wie sie Blinden eigen ist. Jetzt kannte ich ihre Ursache.
Zu meinem Ärger – aber ich mußte doch darüber lachen – entdeckte er meine Schuhe auf der Back und nahm sie mit in die Kombüse. Ich beobachtete ihn, wie er Feuer machte und daran ging, sich sein Essen zu kochen. Dann stahl ich mich in die Kajüte, um Marmelade und Unterzeug zu holen, schlüpfte an der Kombüse vorbei und kletterte auf den Strand, um barfuß Bericht zu erstatten.
»Schade, daß die ›Ghost‹ ihre Masten verloren hat, sonst könnten wir jetzt so schön auf ihr fortsegeln. Meinen Sie nicht auch, Humphrey?« Ich sprang erregt auf.
»Ja, wirklich, wirklich!« rief ich und schritt auf und ab.
Mauds Augen, die mir folgten, leuchteten hoffnungsfroh. Sie glaubte so fest an mich! Und dies Bewußtsein verdoppelte meine Kraft. Mir fiel ein, was Michelet sagt: »Die Frau ist dem Manne, was die Erde ihrem sagenhaften Sohne ist; er braucht nur niederzufallen und ihre Brust zu küssen, um wieder stark zu sein.« Zum ersten Male erkannte ich die wunderbare Wahrheit dieser Worte: erlebte ich sie doch an mir selbst! Das war Maud für mich: eine unversiegbare Quelle der Kraft und des Mutes. Ich brauchte sie nur anzusehen, nur an sie zu denken, und ich fühlte mich wieder stark.
»Es ist möglich, es ist möglich«, dachte ich und wiederholte es laut. »Was andere Männer vollbracht haben, kann ich auch vollbringen, und wenn niemand es je getan hat, so werde ich es tun.«
»Was, um Gottes willen?« fragte Maud. »Seien Sie barmherzig. Was werden Sie tun?«
»Wir werden es tun«, verbesserte ich mich. »Nun, nichts anderes, als die Masten der ›Ghost‹ wieder einsetzen und fortsegeln.«
»Humphrey!« rief sie.
Und ich fühlte mich so stolz über meine Absicht, als wäre sie schon ausgeführt gewesen.
»Aber wie sollten wir das machen?« fragte sie.
»Das weiß ich nicht«, lautete meine Antwort. »Das einzige, was ich weiß, ist, daß ich in diesen Tagen imstande bin zu tun, was es auch sei.«
Stolz lächelte ich ihr zu – zu stolz, denn sie senkte die Augen und schwieg einen Augenblick.
»Aber Kapitän Larsen«, wandte sie ein.
»Blind und hilflos«, antwortete ich schnell, indem ich ihren Einwand wie ein Staubkörnchen wegfegte.
»Aber seine furchtbaren Hände! Sie wissen, wie er sich über die Apothekenluke hinüberwarf.«
»Und Sie wissen auch, wie ich ihm kriechend entkam«, entgegnete ich gut gelaunt.
»Und Sie haben dabei Ihre Schuhe verloren.«
»Sie können doch nicht gut verlangen, daß die Wolf Larsen entwischten, wenn meine Füße nicht in ihnen staken.«
Wir lachten beide. Dann gingen wir ernstlich daran, einen Plan zu entwerfen, wie wir die Masten wieder in die ›Ghost‹ einsetzen und in die Welt zurückkehren sollten. Ich erinnerte mich dunkel des Physikunterrichts in meiner Schulzeit; dazu hatten mir die letzten Monate praktische Unterweisung in mancherlei technischen Handgriffen erteilt. Ich muß jedoch gestehen, daß ich, als wir zur ›Ghost‹ hinuntergingen, um eine Besichtigung vorzunehmen, beim Anblick der großen, im Wasser liegenden Masten fast den Mut verlor. Wo sollten wir beginnen? Hätte nur ein Mast gestanden, daß wir Blöcke und Taue hätten befestigen können, um ihn als Kran zu benutzen! Aber es gab nichts. Ich mußte an das Problem denken, sich selbst an den Haaren hochzuziehen. Ich verstand genügend von der Mechanik des Hebels; wo aber fand ich einen Stützpunkt?
Da war der Großmast, der an seinem jetzigen Ende einen Durchmesser von 15 Zoll hatte, noch 65 Fuß lang war und, wie ich überschläglich berechnete, wenigstens 3000 Pfund wog. Dann der Fockmast, dessen Durchmesser noch größer war und der sicherlich 3500 Pfund wog. Wo beginnen? Maud stand schweigend neben mir, während ich überlegte, wie ich die sogenannte ›Schere‹ der Seeleute herstellen sollte. Was jedem Matrosen bekannt war, mußte ich auf der Mühsalinsel erst erfinden. Ich mußte die Enden zweier Spieren kreuzweise zusammenbinden und sie wie ein umgekehrtes V an Deck aufstellen. Hieran konnte ich dann eine Talje und, wenn nötig, noch eine zweite befestigen. Und außerdem hatte ich ja das Ankerspill. Maud sah, daß ich zu einem Ergebnis gekommen war, und ihre Augen leuchteten verständnisvoll.
»Was haben Sie vor?« fragte sie.
»Das Gerümpel klarzubringen!« antwortete ich und wies auf das wirr durcheinander liegende Wrackgut im Wasser.
Ach, welch eine Entschlossenheit lag allein in diesen Worten! »Das Gerümpel klarzubringen!« Ein so echter seemännischer Ausdruck von den Lippen Humphrey van Weydens – wer hätte das vor wenigen Monaten für möglich gehalten!
In meiner Haltung und Stimme mußte etwas Theatralisches gelegen haben, denn Maud lächelte.
»Das habe ich sicher irgendwo schon mal gelesen«, meinte sie lustig.
Ich stieg sogleich in Selbsterkenntnis von meinem Thron herunter, um gedemütigt und verwirrt zu gestehen, daß ich etwas sehr Törichtes gesagt hätte.
Sofort schlug sie um.
»Es tut mir wirklich leid«, sagte sie.
»Es braucht Ihnen nicht leid zu tun«, würgte ich hinunter. »Mir geschieht es ganz recht. Ich bin noch der reine Schuljunge. Aber Schwamm drüber! Jetzt heißt es, das Gerümpel klarzubringen. Wenn Sie mit ins Boot kommen wollen, können wir uns an die Arbeit machen.«
Und wir machten uns an die Arbeit.
Ihre Aufgabe war es, auf das Boot zu achten, während ich daranging, den Wirrwarr zu ordnen. Und welch einen Wirrwarr! Falle, Schoote, Leinen, Stags – alles war von den Wellen hin und her geworfen, verwickelt und verfilzt. Ich gebrauchte das Messer nicht mehr, als durchaus notwendig war, und bald war ich bis auf die Haut durchnäßt vom Durchziehen der langen Taue unter Spieren und Masten, dem Ausscheren der Leinen und dem Aufwickeln im Boote.
Die Segel mußten an verschiedenen Stellen durchgeschnitten werden, und die vom Wasser schwere Leinwand stellte hohe Anforderungen an meine Kraft; aber bei Einbruch der Nacht war es mir doch gelungen, alles auf den Strand zu schaffen und dort zum Trocknen auszubreiten. Als wir aufhörten, um Abendbrot zu essen, waren wir beide sehr müde, aber wir hatten ein tüchtiges Stück Arbeit verrichtet, wenn es auch nicht nach viel aussah.
Am nächsten Morgen stieg ich mit Maud, deren Hilfe sich als ausgezeichnet erwiesen hatte, in den Raum der ›Ghost‹ hinab, um die alten Maststümpfe zu entfernen. Wir hatten kaum mit der Arbeit begonnen, als das Klopfen und Hämmern auch schon Wolf Larsen herbeirief.
»He, da unten!« rief er durch die offene Luke herunter.
Bei dem Klang seiner Stimme preßte Maud sich schutzsuchend an mich, und bei der jetzt folgenden Unterhaltung lag ihre Hand auf meinen Arm.
»He, da oben«, erwiderte ich. »Guten Morgen!«
»Was machen Sie da,« fragte er. »Versuchen Sie, mein Schiff in den Grund zu bohren?«
»Im Gegenteil, ich setze es wieder instand«, lautete meine Antwort.
»Aber was setzen Sie denn instand, zum Donnerwetter?« Seine Stimme klang verwundert.
»Ich will die Masten wieder einsetzen«, entgegnete ich leichthin, als wäre es die einfachste Sache von der Welt.
»Mir scheint, Sie haben endlich gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen, Hump«, hörten wir ihn sagen, und dann schwieg er eine Weile.
»Aber ich sage es Ihnen, Hump,« rief er wieder, »Sie bringen es nicht fertig.«
»O doch, ich bringe es fertig«, gab ich zurück. »Ich bin schon dabei.«
»Aber dies ist mein Schiff, mein Eigentum. Wenn ich es Ihnen nun verbiete?«
»Sie vergessen,« erwiderte ich, »daß Sie nicht mehr das stärkste Teilchen Ferment sind. Sie waren es einmal; damals hätten Sie mich fressen können, wie Sie sich auszudrücken beliebten. Jetzt aber ist es anders geworden, und jetzt könnte ich Sie fressen. Die Hefe ist ausgegoren.«
Er lachte kurz und unbehaglich auf. »Ich sehe, Sie geben mir meine Philosophie in ihrem vollen Werte wieder. Aber machen Sie nicht den Fehler, mich zu unterschätzen. Ich warne Sie zu Ihrem eigenen Besten.«
»Seit wann sind Sie denn Philanthrop geworden?« fragte ich. »Sie müssen gestehen, daß Sie äußerst inkonsequent sind, wenn Sie mich jetzt zu meinem Besten warnen.«
Er beachtete den Spott in meinen Worten nicht und sagte: »Gesetzt, ich schlösse jetzt die Luke über Ihnen. Hier können Sie mich nicht zum Besten halten wie in der Apotheke.«
»Wolf Larsen,« sagte ich streng und redete ihn zum ersten Male bei dem Namen an, unter dem er bekannt war, »ich bin nicht imstande, einen Wehrlosen, der keinen Widerstand leistet, niederzuschießen. Das haben Sie zu meiner eigenen wie zu Ihrer Befriedigung festgestellt. Aber jetzt warne ich Sie, nicht so sehr um Ihret- wie um meinetwillen: In dem Augenblick, in dem Sie die geringste Feindseligkeit gegen mich begehen, knalle ich Sie nieder. Ich kann es bequem von hier aus; wenn Ihnen danach der Sinn steht, so versuchen Sie, die Luke zu schließen.«
»Nichtsdestoweniger verbiete ich Ihnen, verbiete es Ihnen ausdrücklich, an meinem Schiff herumzupfuschen.«
»Aber Mann,« sagte ich vorwurfsvoll, »Sie stellen die Tatsache, daß dies Ihr Schiff ist, fest, als sei das ein moralisches Recht. Haben Sie denn jemals bei Ihrer Handlungsweise andern gegenüber moralische Rechte gelten lassen? Sie können doch nicht im Ernst glauben, daß ich solche Rücksichten nehme!«
Ich war unter die offene Luke getreten, so daß ich ihn sehen konnte. Die völlige Ausdruckslosigkeit seines Gesichtes, das ich jetzt ungesehen beobachtete, war im Verein mit den starren Augen kein angenehmer Anblick.
»Und daß irgend jemand – und sei es selbst Hump – so armselig wäre, ihm Achtung zu zollen«, höhnte er. Der Hohn kam ausschließlich durch seine Stimme zum Ausdruck. Sein Gesicht blieb so ausdruckslos wie zuvor. »Wie geht es Ihnen, Miß Brewster?« fragte er plötzlich nach einer Pause.
Ich erschrak. Sie hatte nicht das leiseste Geräusch gemacht, hatte sich nicht einmal bewegt. War es möglich, daß er noch einen Schimmer des Augenlichtes behalten hatte? Oder daß ihm die Sehkraft wiederkehrte?
»Was machen Sie, Kapitän Larsen?« fragte sie ihrerseits. »Wieso wissen Sie denn, daß ich hier bin?«
»Ich habe Sie natürlich atmen gehört. Mir scheint, Hump macht Fortschritte, finden Sie nicht?«
»Ich weiß nicht«, antwortete sie und lächelte mir zu. »Ich kenne ihn nicht anders.«
»Dann hätten Sie ihn früher sehen sollen.«
»Wolf Larsen in bittern Pillen,« murmelte ich, »vor und nach dem Einnehmen.«
»Ich sage Ihnen nochmals, Hump,« drohte er, »lassen Sie lieber die Finger davon.«
»Aber liegt Ihnen denn nicht genau soviel wie uns daran, von hier wegzukommen?« fragte ich verwundert.
»Nein«, lautete seine Antwort. »Ich gedenke hier zu sterben.«
»Wir aber nicht«, beendete ich das Gespräch trotzig und nahm mein Klopfen und Hämmern wieder auf.
Am nächsten Tage – wir hatten alles soweit, um die Masten einsetzen zu können – machten wir uns daran, die beiden Marsstengen an Bord zu nehmen. Die Großmarsstenge war über dreißig Fuß lang, die andere etwas kürzer, und aus beiden gedachte ich die ›Schere‹ zu machen. Es war ein schweres Stück Arbeit. Ich befestigte das eine Ende der schweren Talje am Ankerspill, das andere am unteren Ende der Vormarsstenge und begann zu winden. Maud hielt den Törn auf dem Spill und ließ die Leine auslaufen.
Wir waren ganz erstaunt, wie leicht die Spiere sich heben ließ. Es war ein verbessertes Krüppelspill und besaß eine ungeheure Hubkraft. Die Talje zog schwer über die Reling, ihr Zug verstärkte sich, je mehr die Spiere sich aus dem Wasser hob, und der Druck auf das Spill wurde gewaltig.
Als jedoch das untere Ende der Marsstenge in Höhe der Reling war, saßen wir fest.
»Ich hätte es voraussehen können«, sagte ich ungeduldig. »Nun müssen wir wieder von vorn anfangen.«
»Warum machen wir nicht die Talje mehr nach der Mitte der Stenge hin fest?« schlug Maud vor.
»Das hätte ich eben tun müssen«, erwiderte ich, äußerst unzufrieden mit mir.
Ich ließ einen Törn nach, daß der Baum wieder ins Wasser zurückfiel, und machte die Talje etwa zehn Fuß oberhalb des Endes fest. Nach einer Stunde mühsamster, nur durch kurze Pausen unterbrochener Arbeit hatte ich ihn so hoch, wie es ging. Acht Fuß des Baumes hingen über der Reling, aber es war weniger als je daran zu denken, daß ich ihn an Deck bekam. Ich setzte mich hin und dachte über das Problem nach. Aber es dauerte nicht lange, dann sprang ich jubelnd auf.
»Jetzt hab' ich's!« rief ich. »Ich muß die Talje am Schwerpunkt festmachen. Und die Lehre, die wir hieraus ziehen, wird uns für alle künftige Arbeit zugute kommen.«
Wieder war die Arbeit umsonst getan, und ich mußte die Spiere zu Wasser lassen. Und dann rechnete ich den Schwerpunkt nicht richtig aus, so daß, als ich zu winden begann, die Spitze statt des Endes vom Baum heraufkam. Maud sah aus wie die Verzweiflung selber, aber ich lachte und sagte, es würde schon noch werden.
Ich zeigte ihr, wie sie den Törn halten und bereit sein sollte, die Leine auf mein Kommando auslaufen zu lassen, dann packte ich den Baum mit den Händen und versuchte, ihn über die Reling zu ziehen. Als ich ihn weit genug zu haben glaubte, rief ich: »Los!«, aber die Spiere stellte sich trotz meinen Anstrengungen aufrecht und fiel ins Wasser zurück. Wieder heißte ich sie hoch, und jetzt hatte ich einen neuen Einfall. Ich dachte an die Taschentalje – ein kleines Gerät mit einem doppelten und einem einfachen Block –, und die holte ich nun.
Als ich gerade damit beschäftigt war, sie zwischen der Spitze der Spiere und der Reling anzubringen, erschien Wolf Larsen auf dem Schauplatz. Wir wechselten nur einen Gutenmorgengruß, und dann setzte er sich, obgleich er nichts sehen konnte, ein Stückchen weiterhin auf die Reling und versuchte, aus dem Geräusch zu entnehmen, was wir taten.
Wieder gab ich Maud Anweisung, auf mein Kommando Leine auslaufen zu lassen, und dann begann ich mit Hilfe der Taschentalje zu hieven. Langsam schwang sich der Baum herüber, bis er über der Reling balancierte; da bemerkte ich zu meinem Erstaunen, daß Maud keine Leine auszulassen brauchte. Gerade das Gegenteil war der Fall. Ich machte die Taschentalje fest, drehte das Spill und brachte den Baum Zoll für Zoll herein, bis seine Spitze sich herabneigte und er schließlich in seiner ganzen Länge auf dem Deck lag. Ich sah auf die Uhr. Es war zwölf. Mein Rücken schmerzte heftig, und ich war äußerst müde und hungrig. Und hier auf dem Deck lag ein einziges Stück Holz, das Ergebnis der Arbeit eines ganzen Vormittags. Zum ersten Mal wurde mir die Größe der Aufgabe klar, die wir zu erfüllen hatten. Aber ich hatte schon viel gelernt. Am Nachmittage mußte es besser gehen. Und so geschah es! Um ein Uhr kehrten wir zurück, ausgeruht und durch ein herzhaftes Mittagessen gestärkt.
In weniger als einer Stunde hatte ich die Großmarsstenge an Deck und begann jetzt, die ›Schere‹ zu bauen. Ich surrte die beiden Bäume zusammen, wobei ich darauf achtete, daß die Schenkel des Geräts gleich lang wurden, und dann befestigte ich am Schnittpunkt den doppelten Block des Haupt-Klaufalls. Dies ergab in Verbindung mit dem einzelnen Block und dem Klaufall selbst ein Heißtakelwerk. Um die Enden der Bäume am Gleiten zu verhindern, nagelte ich einige Klampen an Deck fest. Als alles fertig war, machte ich am Schnittpunkt der ›Schere‹ eine Leine fest, die ich direkt zum Spill laufen ließ. Mein Vertrauen zu dem Spill wuchs immer mehr, denn es gab Kräfte her, die alles Erwarten überstiegen. Wie gewöhnlich hielt Maud den Törn, während ich wand. Die ›Schere‹ erhob sich.
Da entdeckte ich, daß ich die Bardunen vergessen hatte. Die Folge war, daß ich zweimal auf die ›Schere‹ hinaufklettern mußte, um die Bardunen an beiden Seiten anzubringen. Ehe ich hiermit fertig war, war es Abend geworden. Wolf Larsen, der den ganzen Nachmittag dagesessen und gelauscht hatte, ohne auch nur ein einziges Mal den Mund zu öffnen, war in die Kombüse gegangen, um sich sein Abendbrot zu bereiten. Mir war das Kreuz so steif, daß ich mich nur mit Mühe und Schmerzen aufrichten konnte. Aber ich blickte mit Stolz auf meine Arbeit. Sie konnte sich sehen lassen. Wie ein Kind, das ein neues Spielzeug bekommen hat, sehnte ich mich danach, die ›Schere‹ in Gebrauch zu nehmen.
»Schade, daß es schon so spät ist«, sagte ich. »Ich hätte sie so gern schon arbeiten gesehen.«
»Seien Sie kein Vielfraß, Humphrey,« schalt Maud, »denken Sie daran, daß morgen auch noch ein Tag ist. Sie sind so müde, daß Sie kaum noch auf den Beinen stehen können.«
»Und Sie?« fragte ich mit plötzlicher Besorgnis. »Sie müssen doch schrecklich müde sein. Sie haben tüchtig und tapfer zugepackt. Ich bin stolz auf Sie, Maud.« »Nicht halb so stolz, wie ich es auf Sie bin, und mit nicht halb so viel Grund«, antwortete sie und sah mir sekundenlang in die Augen, während die ihren mit einem flackernden Licht leuchteten, das ich noch nie in ihnen gesehen hatte, und das mir – ich wußte nicht, warum – eine Welle heißen Entzückens durch die Adern jagte. Dann senkte sie den Blick, um ihn gleich darauf wieder lachend zu heben.
»Wenn unsere Freunde uns jetzt sehen könnten!« sagte sie. »Sehen Sie uns an. Haben Sie sich nie einen Augenblick Zeit gegönnt, um uns zu betrachten?«
»Doch, ich habe Sie oft betrachtet«, erwiderte ich, verwirrt über das, was ich in ihren Augen gesehen hatte, und verwundert, daß sie so plötzlich den Gegenstand wechselte.
»Du lieber Gott!« rief sie. »Und wie sehe ich aus, wenn ich fragen darf?«
»Wie eine Vogelscheuche – wir brauchen uns nichts vorzumachen«, erwiderte ich. »Sehen Sie nur Ihren schmutzigen Rock und die vielen Risse. Und die Bluse! Hier bedürfte es keines Sherlock Holmes, um zu beweisen, daß Sie über einem Lagerfeuer abgekocht haben, ganz zu schweigen von unserem Robbentran. Und um allem die Krone aufzusetzen: die Mütze! Ist das wirklich die Frau, die den ›Erduldeten Kuß‹ geschrieben hat?«
Sie machte mir einen eleganten kleinen Knicks und sagte: »Und was Sie betrifft, mein Herr – –«
Wir scherzten einige Minuten in dieser Weise, und doch hatten unsere Scherze einen Unterton von Ernst, den ich ganz unwillkürlich mit dem seltsamen Ausdruck in ihren Augen in Verbindung brachte. Was war das? War es möglich, daß unsere Augen ausplauderten, was unser Mund verschwieg?
»Es ist eine Schande, daß wir nach dem schweren Tagewerk nicht einmal unsere Nachtruhe ungestört haben sollen!« klagte ich nach dem Abendbrot.
»Was für eine Gefahr könnte uns drohen? Von einem Blinden?« fragte sie.
»Ich traue ihm nicht,« beharrte ich, »und jetzt, da er blind ist, weniger als je. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird seine teilweise Hilflosigkeit ihn nur noch boshafter machen. Das weiß ich: Das erste, was ich morgen früh tun werde, ist, den Schoner ein kleines Stück vom Strande abzulegen und zu verankern. Dann bleibt Wolf Larsen jeden Abend, wenn wir an Land rudern, als Gefangener an Bord zurück. Dies wird daher die letzte Nacht sein, die wir Wache zu halten brauchen, und darum wird es leichter gehen.« Wir waren zeitig auf und hatten gerade unser Frühstück eingenommen, als es hell wurde.
»Ach, Humphrey!« hörte ich plötzlich Maud bestürzt rufen.
Ich sah sie an. Sie starrte auf die ›Ghost‹. Ich folgte ihrem Blick, konnte jedoch nichts Ungewöhnliches bemerken.
»Die Schere«, sagte sie mit bebender Stimme.
Ich hatte unser Werk ganz vergessen. Jetzt schaute ich wieder hin und sah die ›Schere‹ nicht.
»Wenn er –« knirschte ich.
Sie legte beruhigend ihre Hand auf die meine und sagte: »Dann müssen wir wieder von vorne anfangen.«
»Oh, glauben Sie mir, mein Zorn hat nichts zu bedeuten, ich könnte keiner Fliege etwas zuleide tun«, lächelte ich bitter. »Und das Schlimmste ist, daß er das weiß. Sie haben recht: Wenn er die ›Schere‹ zerstört hat, bleibt mir nichts anderes übrig, als wieder von vorne anzufangen.«
»Aber in Zukunft werde ich nachts an Bord bleiben«, machte ich mir einen Augenblick später Luft. »Und wenn er mir wieder in den Weg tritt – –«
»Aber ich wage es nicht, nachts allein an Land zu bleiben«, sagte Maud, als ich mich wieder beruhigt hatte. »Es wäre doch zehnmal schöner, wenn er sich freundschaftlich zu uns stellte und uns hülfe. Dann könnten wir alle so gut an Bord wohnen.«
»Das werden wir auch«, sagte ich, immer noch erregt, denn die Zerstörung meiner lieben ›Schere‹ hatte mich schwer getroffen. »Das heißt: wir beide werden an Bord wohnen, mit oder ohne Wolf Larsens Freundschaft.«
»Es ist kindisch,« lachte ich kurz darauf, »kindisch von ihm, etwas Derartiges zu tun, und von mir, sich darüber aufzuregen.«
Aber ich konnte mich doch nur mühsam beherrschen, als ich an Bord kletterte und die Verwüstung sah, die Wolf Larsen angerichtet hatte. Die ›Schere‹ war verschwunden. Die Bardunen waren rechts und links durchgeschnitten. Mit allem Tauwerk hatte er es ebenso gemacht. Und er wußte, daß ich nicht spleißen konnte. Ein Gedanke schoß mir durch den Kopf. Ich eilte zum Spill. Es arbeitete nicht. Er hatte es zerbrochen. Bestürzt sahen wir uns an. Dann lief ich an die Reling. Alle Masten, Spieren und Gaffeln, die ich klargemacht hatte, waren fort. Er hatte die Leinen gefunden, durch die sie gehalten worden waren, hatte sie gekappt und alles Wind und Wellen preisgegeben. Maud hatte Tränen in den Augen, und ich glaube, sie galten mir. Ich selbst hätte weinen mögen. Was wurde jetzt aus unserm Plan, die ›Ghost‹ wieder seetüchtig zu machen. Wolf Larsen hatte ganze Arbeit getan. Ich setzte mich auf den Lukenrahmen und ließ in tiefster Verzweiflung den Kopf in die Hände sinken.
»Er verdient den Tod!« rief ich, »und Gott verzeihe mir, daß ich nicht Manns genug bin, den Henker zu spielen.«
Aber Maud saß neben mir, ließ ihre Hand besänftigend durch mein Haar gleiten, als ob ich ein Kind wäre, und sagte: »Still, still, es wird schon alles gut werden. Wir haben das Recht auf unserer Seite, und der liebe Gott wird uns nicht im Stich lassen.«
Ich lehnte meinen Kopf an ihre Schulter und fühlte meine Kraft zurückkehren. Das gesegnete Mädchen war für mich eine unversiegbare Quelle der Kraft. Was tat es? Es war nur eine Verspätung, ein Aufschub! Die Ebbe konnte die Masten nicht weit in See getrieben haben, und es war die ganze Zeit windstill gewesen. Es bedeutete nur etwas mehr Arbeit, sie zu finden und zurückzuholen. Und zudem war es eine gute Lehre für uns. Jetzt wußten wir, was wir zu erwarten hatten. Wenn er sein Zerstörungswerk erst später getan hätte, wäre es bedeutend schlimmer für uns gewesen. »Er kommt«, flüsterte sie.
Ich sah auf. Er kam lässig an Backbord über die Ruff. »Nehmen Sie gar keine Notiz von ihm«, flüsterte ich. »Er will nur sehen, wie wir es aufnehmen. Lassen Sie ihn nicht merken, daß wir das wissen. Die Befriedigung brauchen wir ihm jedenfalls nicht zu gönnen. Ziehen Sie die Schuhe aus – so ist es recht – und tragen Sie sie in der Hand.«
Und dann spielten wir Blindekuh mit dem Blinden. Kam er nach Backbord, so schlüpften wir nach Steuerbord, und von der Achterhütte aus sahen wir, wie er kehrtmachte und unsere Spuren nach achtern verfolgte.
Irgendwie mußte er doch ahnen, daß wir an Bord waren, denn er sagte ganz dreist »Guten Morgen« und wartete, daß wir den Gruß erwiderten. Dann begab er sich wieder nach achtern, und wir schlüpften nach vorn.
»Ach, ich weiß gut, daß Sie an Bord sind«, rief er, und ich konnte sehen, wie er nach diesen Worten intensiv lauschte.
Ich mußte an die große Schrei-Eule denken, die, wenn sie geschrien hat, lauscht, um die Bewegungen ihrer aufgeschreckten Beute zu hören. Wir regten uns jedoch nicht. Wir bewegten uns nur, wenn er sich bewegte. Und auf diese Weise huschten wir auf Deck hin und her, Hand in Hand wie ein paar Kinder, die von einem scheußlichen Kobold gehetzt werden, bis Wolf Larsen der Geschichte überdrüssig wurde und sich, offenbar ganz verwirrt, in die Kajüte begab. Mit vor Vergnügen leuchtenden Augen und unterdrücktem Lachen zogen wir uns die Schuhe wieder an und kletterten in unser Boot. Und als ich in Mauds klare, braune Augen blickte, vergaß ich alles Böse, das er uns angetan hatte, und wußte nur, daß ich sie liebte, und daß ich aus dieser Liebe die Kräfte schöpfen würde, den Weg zurückzufinden.
Zwei Tage lang durchstreiften Maud und ich See und Küste auf der Suche nach den verlorenen Masten. Aber erst am dritten fanden wir sie, auch die ›Schere‹, zwischen den gefährlichen Riffen, mitten in der tosenden Brandung am südwestlichen Vorgebirge. Wie wir arbeiteten! Am ersten Tage kehrten wir bei Einbruch der Dunkelheit mit dem Großmast im Schlepp vollkommen erschöpft in unsern kleinen Schlupfhafen zurück. Es war völlige Windstille, und wir mußten uns Zoll für Zoll mit den Riemen vorwärtsarbeiten. Nach einem zweiten Tage mühseligster Arbeit hatten wir die beiden Marsstengen geborgen. Am dritten Tage machte ich eine verzweifelte Anstrengung. Ich band Fockmast, Vorder- und Hauptspiere und Vorder- und Hauptgaffel zu einem Floß zusammen. Der Wind war günstig, und ich hoffte, sie unter Segel zurückbugsieren zu können; aber nach einigen Böen legte sich der Wind, und wir mußten wieder rudern. Es ging im Schneckentempo, und mein Mut sank. Seine ganze Kraft einzulegen, sich mit der Wucht des ganzen Körpers in die Riemen zu werfen und doch zu fühlen, wie das Boot durch das schwere Gewicht, das daran hing, zurückgehalten wurde, das war nicht gerade sehr erheiternd.
Die Nacht brach herein, und um die Situation noch zu verschlimmern, erhob sich ein Gegenwind. Jetzt kamen wir nicht nur nicht weiter, wir wurden auf das offene Meer zurückgetrieben. Ich kämpfte mit den Riemen, bis ich nicht mehr konnte. Die arme Maud, der ich die harte Arbeit nicht hatte ersparen können, lehnte sich erschöpft gegen den Achtersteven. Meine geschwollenen Hände vermochten sich nicht mehr um die Riemen zu schließen. Handgelenke und Arme schmerzten mich unerträglich, und obgleich ich um zwölf Uhr tüchtig gegessen hatte, war ich nach der harten Arbeit schwach vor Hunger.
Ich zog die Riemen ein und beugte mich hinüber zu der Leine, die das Floß hielt. Aber Mauds Hände streckten sich abwehrend nach den meinen aus.
»Was wollen Sie tun?« fragte sie mit erhobener Stimme.
»Es loswerfen«, antwortete ich, indem ich einen Törn von der Leine ausließ.
Aber ihre Finger umschlossen die meinen.
»Bitte, tun Sie es nicht«, bat sie.
»Es hat keinen Zweck«, erwiderte ich. »Es ist schon Nacht, und der Wind treibt uns vom Lande ab ins Meer hinaus.«
»Aber denken Sie daran, Humphrey, wenn wir nicht auf der ›Ghost‹ fortsegeln, können wir jahrelang auf der Insel bleiben – vielleicht das ganze Leben. Ist sie bis heute nicht entdeckt worden, so wird sie es vielleicht nie.«
»Sie vergessen das Boot, das wir auf dem Strande fanden«, erinnerte ich sie.
»Das war ein Robbenfängerboot,« entgegnete sie, »und Sie wissen gut, daß die Männer, wenn sie entkommen wären, zurückgekehrt sein würden, um auf der Rookery ihr Glück zu machen. Sie wissen, daß sie nicht entkommen sind.«
»Lieber Jahre auf der Insel, als heute nacht oder morgen oder einen der nächsten Tage in dem offenen Boot umzukommen. Wir sind nicht in der Lage, dem Meere standzuhalten. Wir haben weder Nahrung, noch Wasser, noch Decken – gar nichts. Sie werden die Nacht nicht ohne Decke überleben. Ich kenne Ihre Kräfte. Sie zittern jetzt schon.«
»Nur aus Nervosität. Ich fürchte, daß Sie die Masten trotz meiner Bitte loswerfen. – Ach bitte, bitte, Humphrey, tun Sie es nicht!« rief sie.
Und so endete es mit den Worten, die, wie sie wußte, eine solche Macht über mich besaßen, daß ich nicht widerstehen konnte. Wir litten furchtbar die ganze Nacht. Hin und wieder schlief ich ein, aber immer wieder weckte mich die schmerzhafte Kälte. Wie Maud es aushielt, ist mir unbegreiflich. Ich war zu müde, um die Arme zusammenzuschlagen und mich selbst warm zu halten, aber ich fand hin und wieder die Kraft, ihre Hände und Füße zu reiben, um ihr Blut wieder kreisen zu lassen. Und trotzdem bat sie mich immer noch, nicht die Masten im Stich zu lassen. Gegen drei Uhr morgens wurde sie von einem Krampf befallen, und als ich sie durch Reiben wieder zu sich gebracht hatte, lag sie eine Zeitlang ganz still da. Ich war tief erschrocken. Ich legte die Riemen aus und ließ sie rudern, obgleich sie so schwach war, daß ich bei jedem Schlage befürchten mußte, sie in Ohnmacht fallen zu sehen.
Der Morgen brach an, und in dem wachsenden Licht hielten wir lange Ausschau nach unserer Insel. Schließlich zeigte sich ein kleiner schwarzer Punkt, volle fünfzehn Meilen entfernt, am Horizont. Ich sah mit dem Glase über das Meer. Ganz in der Ferne, in Südwest, konnte ich einen dunklen Strich auf dem Wasser sehen, der sich immer mehr vergrößerte.
»Günstiger Wind!« rief ich, aber so heiser, daß ich meine eigene Stimme kaum erkannte.
Maud versuchte zu antworten, konnte jedoch keinen Ton hervorbringen. Ihre Lippen waren blau vor Kälte – aber ach, wie tapfer blickten ihre braunen Augen mich an!
Wieder begann ich, ihr Hände und Füße zu reiben und die Arme auf und nieder zu schwingen, bis sie es selbst vermochte.
Dann kam der Wind, ein frischer, günstiger Wind, und bald arbeitete sich das Boot durch eine schwere See der Insel zu. Um halb vier Uhr nachmittags passierten wir das südwestliche Vorgebirge. Wir waren jetzt nicht nur hungrig, sondern litten auch Durst. Unsere Lippen waren ausgetrocknet und aufgesprungen, und wir konnten sie nicht mehr mit der Zunge befeuchten. Da legte sich der Wind. Gegen Abend herrschte völlige Windstille, und ich arbeitete wieder mit den Riemen – aber schwach, sehr schwach. Um zwei Uhr morgens stieß der Bug unseres Bootes gegen den Strand der inneren Bucht, und ich wankte an Land, um die Fangleine festzumachen. Maud konnte nicht mehr auf den Füßen stehen, und ich hatte nicht die Kraft, sie zu tragen. Ich fiel mit ihr in den Sand, und als ich wieder hochkam, begnügte ich mich, sie unter die Schulter zu fassen und den Strand hinauf nach der Hütte zu ziehen.
Am nächsten Tage arbeiteten wir nicht. Wir schliefen bis drei Uhr nachmittags, oder wenigstens ich tat es, denn als ich erwachte, war Maud schon dabei, das Mittagessen zu bereiten. Es war wunderbar, wie schnell sie sich erholte. Ihrem zarten Körper wohnte eine Kraft inne, die man ihr nicht zugetraut hätte.
»Sie wissen doch, daß ich meiner Gesundheit wegen nach Japan reiste«, sagte sie, als wir nach dem Essen am Feuer lagerten und uns dem süßen Nichtstun hingaben. »Ich war nicht sehr kräftig, bin es nie gewesen. Die Ärzte rieten mir eine Seereise, und ich habe mir die allerlängste ausgesucht.«
»Sie ahnten nicht, was Sie sich aussuchten«, lachte ich. »Aber ich bin eine ganz andere geworden, und kräftiger auch,« erwiderte sie, »und ich hoffe, auch besser. Wenigstens werde ich jetzt ein ganz Teil mehr vom Leben verstehen.«
Als dann der kurze Tag verschwand, kamen wir auf Wolf Larsens Blindheit zu sprechen. Sie war uns unerklärlich. Daß es Ernst war, darauf ließ seine Erklärung schließen, daß er auf der Mühsalinsel bleiben und sterben wollte. Wenn dieser starke Mann, der das Leben so liebte, an sein nahes Ende glaubte, so war es klar, daß seine Blindheit nicht alles war, was ihn plagte. Er litt an seinen furchtbaren Kopfschmerzen, und wir wurden uns einig, daß es sich um ein Versagen seines Gehirns handeln mußte, und daß er in seinen Anfällen größere Qualen zu erdulden hatte, als wir uns vorstellen konnten.
Während wir über seinen Zustand sprachen, beobachtete ich, wie Mauds Mitleid mit ihm immer mehr wuchs; ich konnte nicht anders, ich mußte sie um so mehr lieben deshalb, so echt weiblich war es! Auch lag in ihrem Gefühl nicht die geringste Sentimentalität. Sie stimmte mir bei, daß wir mit der größten Härte vorgehen mußten, wenn wir von hier fortkommen wollten, obgleich sie vor dem Gedanken zurückschauderte, daß ich, um uns zu retten, vielleicht gezwungen war, ihn zu töten.
Am nächsten Morgen frühstückten wir, und als der Tag anbrach, waren wir schon an der Arbeit. Vorn im Raum fand ich unter allerlei Gerümpel einen leichten Wurfanker, und mit einiger Mühe schaffte ich ihn an Deck und ins Boot. Ich befestigte ihn im Stern, ruderte ein gutes Stück in unsere Bucht hinaus und ließ den Anker hinab. Kein Lüftchen regte sich, die Flut war hoch und der Schoner schwamm frei. Mit großer Anstrengung – das Spill war ja zerbrochen – brachte ich die ›Ghost‹ dann durch Handkraft an den Anker heran, der zu klein gewesen wäre, um sie auch nur bei einer leichten Brise zu halten. Dann ließ ich den großen Steuerbordanker hinab; und am Nachmittag arbeitete ich am Spill.
Drei Tage hatte ich damit zu tun. Es gab wohl nichts, wozu ich mich weniger geeignet hätte als zum Mechaniker – ein einfacher Maschinist hätte das, wozu ich diese drei Tage brauchte, in ebensoviel Stunden geschafft. Ich mußte erst mit dem Werkzeug umgehen und die einfachsten Grundregeln der Mechanik kennen lernen, die für den Fachmann eine Selbstverständlichkeit waren. Aber am Ende der drei Tage hatte ich ein Ankerspill, das, wenn auch schwerfällig, arbeitete. Es funktionierte nie so gut wie das alte, aber es ging jedenfalls und ermöglichte mir die Arbeit.
Im Laufe eines halben Tages bekam ich die beiden Marsstengen an Bord, hatte die ›Schere‹ aufgetakelt und wie zuvor mit Bardunen versehen. Und diese Nacht schlief ich an Bord neben meinem Werke. Maud, die sich geweigert hatte, an Land zu bleiben, schlief in der Back. Während ich am Spill arbeitete, hatte Wolf Larsen daneben gesessen, gelauscht und sich mit Maud und mir über unwichtige Dinge unterhalten. Von keiner Seite wurden Andeutungen über die Zerstörung der ›Schere‹ gemacht; ebensowenig sagte er wieder etwas davon, daß ich sein Schiff in Ruhe lassen sollte. Aber immer wieder fürchtete ich ihn, der, blind und hilflos, lauschte, immer lauschte, und ich hütete mich, während der Arbeit in die Reichweite seiner starken Arme zu kommen.
Als ich nachts unter meiner geliebten ›Schere‹ schlief, wurde ich durch seine Schritte an Deck geweckt. Es war eine sternenklare Nacht, und ich konnte ihn undeutlich umhertappen sehen. Ich wickelte mich aus meinen Decken und schlich geräuschlos auf Strümpfen hinter ihm her. Er hatte sich mit einer Ziehklinge aus dem Werkzeugkasten versehen und wollte sich nun daranmachen, die Falle, die ich wieder an der ›Schere‹ befestigt hatte, zu durchschneiden. Er betastete die Falle und merkte, daß sie nicht straff gezogen waren. Hier nutzte die Ziehklinge nichts. Er zog die Leinen daher an und machte sie fest. Dann schickte er sich an, zu schneiden.
»An Ihrer Stelle würde ich es nicht tun«, sagte ich ruhig.
Er hörte das Klicken meiner Pistole und lachte.
»Hallo, Hump!« sagte er. »Ich wußte gut, daß Sie da waren. Sie können meine Ohren nicht täuschen.«
»Das ist nicht wahr, Wolf Larsen«, erwiderte ich ebenso ruhig wie zuvor. »Ich warte aber auf eine Gelegenheit, Sie zu töten. Also schneiden Sie nur weiter.«
»Die Gelegenheit haben Sie immer«, sagte er.
»Los, schneiden Sie!« drohte ich bedeutungsvoll.
»Das Vergnügen gönne ich Ihnen doch nicht«, lachte er, wandte sich um und ging nach achtern.
»Es muß etwas geschehen, Humphrey«, sagte Maud am nächsten Morgen, als ich ihr den nächtlichen Zwischenfall erzählt hatte. »Solange er seine Freiheit hat, ist er zu allem fähig. Er kann das Schiff in den Grund bohren oder in Brand stecken. Man kann gar nicht wissen, worauf er verfällt. Wir müssen ihn festnehmen.«
»Aber wie?« fragte ich und zuckte hilflos die Achsel. »Ich wage mich nicht in die Reichweite seiner Arme, und er weiß gut, daß ich ihn nicht erschießen kann, solange er sich auf passiven Widerstand beschränkt.« »Es muß eine Möglichkeit geben«. beharrte sie. »Lassen Sie mich nachdenken.«
»Es gibt eine Möglichkeit«, sagte ich grimmig.
Sie sah mich erwartungsvoll an.
Ich hob einen Robbenknüppel.
»Töten werde ich ihn nicht«, sagte ich. »Und ehe er sich erholt hat, habe ich ihn gut und sicher gebunden.« Sie schüttelte schaudernd den Kopf. »Nein, so nicht. Es muß ein weniger brutales Mittel geben. Lassen Sie uns noch warten.«
Aber wir sollten nicht lange warten, bis die Frage von selbst gelöst wurde. Am Morgen fand ich nach verschiedenen Versuchen den Schwerpunkt des Fockmastes und machte meine Talje einige Fuß darüber fest. Maud hielt den Törn am Spill und ließ auslaufen, während ich hievte. Wäre das Spill in Ordnung gewesen, so hätte die Arbeit jetzt nicht solche Schwierigkeiten gemacht; wie es nun stand, mußte ich bei jedem Zoll mein ganzes Gewicht und meine ganze Kraft aufbieten. Ich mußte oft Ruhepausen machen, ja, um die Wahrheit zu gestehen, waren die Pausen länger als die Arbeit. Wenn meine Kräfte nicht ausreichten, um das Spill in Gang zu bringen, versuchte Maud, mir zu helfen, indem sie mit der einen Hand den Törn hielt und die andere mit aller Wucht ihres zarten Körpers dagegenstemmte.
Nach einer Stunde waren der einzelne und der doppelte Block an der Spitze der ›Schere‹ zusammengestoßen. Ich konnte nicht weiterheißen. Und doch war der Mast noch nicht ganz herübergeschwungen. Das Ende befand sich eben in Höhe der Reling, während die Spitze ganz hinten tief über dem Meere hing. Meine ›Schere‹ war zu kurz. Alle Arbeit war umsonst getan. Aber ich verzweifelte nicht mehr wie früher. Mein Selbstvertrauen wuchs, und ich lernte allmählich, mit Spill, ›Schere‹ und Taljen umzugehen. Es mußte eine Möglichkeit geben, es zu machen, und diese Möglichkeit mußte ich herausfinden.
Während ich noch über der Lösung dieses Problems brütete, kam Wolf Larsen an Deck. Wir bemerkten sofort etwas Seltsames an ihm. Sein Gang war noch unsicherer als sonst. Als er die Kajüte an Backbord passierte, schwankte er geradezu. Bei der Ruff taumelte er, hob die Hand, um die gewohnte Bewegung des Wegwischens zu machen, und fiel die Treppe hinunter auf das Hauptdeck. Er kam auf die Füße, stolperte aber und schlug mit den Armen um sich, um das Gleichgewicht zu bewahren. Auf der Laufbrücke blieb er eine Weile benommen stehen, dann krümmte er sich plötzlich und brach zusammen. Die Füße glitten ihm fort, und er stürzte aufs Deck.
»Einer seiner Anfälle«, flüsterte Maud.
Sie nickte, und ich konnte warmes Mitleid in ihren Augen lesen.
Wir traten zu ihm, aber er schien das Bewußtsein verloren zu haben und atmete nur keuchend. Sie hockte neben ihm nieder, hob ihm den Kopf, um den Blutandrang zu vermindern, und schickte mich in die Kajüte, um ein Kissen zu holen. Ich brachte auch Decken, und wir betteten ihn. Ich fühlte ihm den Puls. Der schlug regelmäßig und kräftig und war ganz normal. Das war merkwürdig, und ich wurde mißtrauisch.
»Wie, wenn er sich nur verstellt?« sagte ich, noch sein Handgelenk haltend.
Maud schüttelte den Kopf mit einem vorwurfsvollen Ausdruck. Aber im selben Augenblick entriß er mir sein Handgelenk und umklammerte das meine wie ein Tellereisen. In Todesangst stieß ich einen wilden unartikulierten Schrei aus. Ein Blick zeigte mir sein boshaftes, triumphierendes Gesicht, dann legte sich sein anderer Arm um meinen Leib und zog mich in einer furchtbaren Umarmung nieder.
Er ließ mein Handgelenk los, sein anderer Arm legte sich um meinen Rücken, umschloß meine beiden Arme, so daß ich mich nicht rühren konnte. Seine freie Hand tastete nach meiner Kehle, und dank meiner eigenen Dummheit hatte ich in diesem Augenblick den bitteren Vorgeschmack des Todes. Warum hatte ich mich in Reichweite dieser furchtbaren Arme gewagt? Ich fühlte andere Hände an meiner Kehle. Es war Maud, die sich vergebens bemühte, die Hand, die mich würgte, loszureißen. Sie gab den Versuch auf, und jetzt hörte ich sie herzzerreißend schreien – wie ein Weib in Angst und tiefster Verzweiflung schreit. Ich kannte dies Schreien vom Untergang der ›Martinez‹.
Mein Gesicht war gegen seine Brust gepreßt, und ich konnte nichts sehen, aber ich hörte Maud schnell über das Deck laufen. Alles geschah in einem Nu. Ich war noch bei vollem Bewußtsein, und es kam mir wie eine Ewigkeit vor, bis ich sie wiederkehren hörte. Aber gerade in diesem Augenblick spürte ich, wie der Mann unter mir zusammensank. Er keuchte unter meinem Gewicht, und die Brust wurde von einem Krampf geschüttelt. Ob es nur die ausgestoßene Luft oder das Bewußtsein seiner zunehmenden Ohnmacht war, weiß ich nicht, aber seine Kehle zitterte von einem tiefen Stöhnen. Die Hand an meiner Kehle löste sich. Ich atmete wieder. Noch einmal wurde sein Griff wieder fester. Aber selbst sein ungeheurer Wille konnte die Schwäche nicht überwinden und versagte. Dann verlor Wolf Larsen das Bewußtsein.
Mauds Schritte waren sehr nahe gewesen, als seine Hand zum letzten Male zitterte und meine Kehle losließ. Ich wälzte mich fort und lag, nach Luft schnappend und im Sonnenschein blinzelnd, auf dem Rücken. Maud – meine Augen hatten sofort ihr Antlitz gesucht – Maud war blaß, aber beherrscht, und sie blickte mich erregt und erleichtert an. Ich sah einen mächtigen Robbenknüppel in ihrer Hand, und im selben Augenblick bemerkte sie die Richtung meiner Augen. Sie ließ den Knüppel fallen, als ob sie sich die Finger verbrannt hätte, und gleichzeitig begann mir das Herz vor Freude zu klopfen. Wahrlich, sie war mein Weib, meine Genossin, sie kämpfte mit mir und für mich, wie das Weib eines Höhlenbewohners mit ihm gekämpft haben mochte. Alles Primitive erwachte in ihr trotz der Kultur und der verweichlichenden Zivilisation, die sie ihr ganzes Leben allein gekannt hatte. »Du liebes Weib!« rief ich und kam mühsam wieder auf die Beine.
Im nächsten Augenblick lag sie in meinen Armen und weinte krampfhaft an meiner Schulter, während ich sie fest umschlang. Ich sah hinab auf den braunen Heiligenschein ihres Haares, das für mich ein im Sonnenschein glitzernder Juwelenschmuck war, wertvoller, als sie je in der Schatzkammer eines Königs aufgehäuft gewesen. Und ich neigte mein Haupt und küßte leise ihr Haar, so leise, daß sie es nicht merkte. Dann aber überkamen mich wieder nüchterne Gedanken. Alles in allem war sie ja nur ein Weib, das jetzt, da sie nach überstandener Gefahr in den Armen ihres Beschützers ruhte, vor Freude weinte. Wäre ich ihr Vater oder Bruder gewesen, nichts hätte anders ausgesehen. Zudem waren Zeit und Ort nicht dazu angetan, mir ein Recht zu geben, meine Liebe zu gestehen. So küßte ich denn noch einmal leise ihr Haar und fühlte dann, wie sie sich aus meiner Umarmung löste. »Diesmal war es ein wirklicher Anfall,« sagte ich, »ein ebensolcher wie der, der ihn erblinden ließ. Zuerst verstellte er sich nur, aber seine Verstellung führte dann den echten Anfall herbei.«
Maud richtete ihm schon wieder das Kissen.
»Nein,« sagte ich, »noch nicht! Jetzt, da er hilflos ist, soll er es auch bleiben. Von heute an wohnen wir in der Kajüte, und Wolf Larsen wird mit dem Zwischendeck vorliebnehmen.«
Ich faßte ihn unter der Schulter und schleppte ihn nach der Laufbrücke. Auf meine Anweisung holte Maud einen Strick. Ich zog ihn ihm unter den Armen hindurch, brachte ihn über die Schwelle und ließ ihn über die Stufen auf den Boden hinab. Ich konnte ihn nicht in eine Koje heben, aber mit Mauds Hilfe hob ich zuerst Kopf und Schultern über den Rand, schob dann den Körper nach und hatte ihn nun in einer Unterkoje.
Aber das genügte mir noch nicht. Ich erinnerte mich, daß er in seiner Kajüte Handeisen hatte, die er zuweilen bei seinen Matrosen benutzt hatte. Und als wir ihn dann verließen, lag er an Händen und Füßen gefesselt da. Zum erstenmal seit vielen Tagen atmete ich auf. Als ich an Deck kam, fühlte ich mich so erleichtert, als wäre eine schwere Last von meinen Schultern genommen.
Wir zogen sofort an Bord der ›Ghost‹, nahmen unsere alte Kajüte in Besitz und kochten in der Kombüse. Die Gefangennahme Wolf Larsens war zu einem äußerst günstigen Zeitpunkt erfolgt, denn der Nachsommer war vorbei, und es hatte regnerisches und stürmisches Wetter eingesetzt. Wir fühlten uns sehr behaglich auf dem Schoner, dem die ungleiche ›Schere‹ und der an ihm hängende Fockmast ein gewisses geschäftiges Aussehen verliehen, das baldige Abreise zu verkünden schien.
Wir hatten Wolf Larsen in Eisen, aber wie unnötig war es jetzt! Wie dem ersten, so war auch dem zweiten Anfall eine ernste Lähmung gefolgt. Maud machte diese Entdeckung, als sie am Nachmittag versuchte, ihm etwas zu essen zu geben. Er schien noch bewußtlos zu sein, und als wir ihn ansprachen, antwortete er nicht. Er lag diesmal auf der linken Seite und litt offenbar starke Schmerzen. In ewiger Unruhe warf er den Kopf hin und her. Dabei hob er das Ohr von dem Kissen, gegen das es gepreßt gewesen war, und sofort hörte er, was sie sagte, und antwortete.
Maud wandte sich zu mir. Ich preßte ihm wieder das Kissen gegen das linke Ohr und fragte ihn, ob er mich hörte, aber er regte sich nicht. Dann nahm ich das Kissen fort, wiederholte die Frage, und sofort erwiderte er, daß er mich verstände.
»Wissen Sie, daß Sie auf dem rechten Ohr taub sind?« fragte ich.
»Ja,« antwortete er mit leiser, aber fester Stimme, »und schlimmer als das: Meine ganze rechte Seite ist wie gelähmt. Ich kann weder Arm noch Bein bewegen.«
»Verstellen Sie sich nun wieder,« fragte ich ärgerlich. Er schüttelte den Kopf, und sein trotziger Mund verzog sich zu einem seltsamen, verzerrten Lächeln, wirklich, verzerrt, denn nur die Muskeln der linken Gesichtshälfte bewegten sich, während die rechte Seite starr blieb.
»Das war das letzte Spiel des Wolfes«, sagte er. »Ich bin gelähmt, ich werde nie wieder gehen. Oh, nur die andere Seite«, fügte er hinzu, als erriete er den mißtrauischen Blick, den ich auf sein linkes Bein warf, dessen Knie sich soeben unter der Decke gekrümmt hatte.
»Es ist auch wirklich Pech«, fuhr er fort. »Ich würde mich gefreut haben, wenn ich Ihnen wenigstens den Garaus gemacht hätte. Dazu, dachte ich, würden meine Kräfte noch reichen.«
»Aber warum denn?« fragte ich entsetzt, aber doch neugierig.
Wieder verzog sich sein trotziger Mund zu dem verzerrten Lächeln, und er sagte:
»Ach nur, um lebendig zu sein, zu leben und zu handeln, um das größere Stück Gärstoff zu sein, um Sie zu fressen. Aber auf diese Weise zu sterben ...«
Er zuckte die Achseln oder versuchte es vielmehr, denn nur die linke Schulter bewegte sich. Sein Achselzucken war ebenso verzerrt wie sein Lächeln.
»Aber haben Sie eine Erklärung für Ihre Krankheit?« fragte ich. »Wo sitzt sie?«
»Im Gehirn«, erwiderte er sofort. »Die verfluchten Kopfschmerzen sind die Ursache.«
»Symptome«, meinte ich.
Er nickte. »Es gibt keine Erklärung. Ich bin nie in meinem Leben krank gewesen. Irgend etwas ist mit meinem Gehirn los. Ein Geschwür, ein Tumor oder etwas derartiges – etwas, das frißt und zerstört. Es greift mein Nervenzentrum an, frißt es Stück auf Stück, Zelle auf Zelle – vor Schmerz.«
»Auch die Bewegungszentren«, warf ich ein.
»Es scheint so, und das Verfluchte dabei ist, daß ich bei vollem Bewußtsein, vollkommen klar und geistig ungeschwächt hier liegen muß und weiß, daß die Kurve Zoll für Zoll abwärts geht, und daß ich immer mehr von der Außenwelt abgeschnitten werde. Ich kann nicht mehr sehen, Gehör und Gefühl verlassen mich, und bald werde ich auch nicht mehr sprechen können. Und doch werde ich hier sein, lebendig und ohnmächtig.«
»Und wie denken Sie nun über die Unsterblichkeit der Seele?« fragte ich ihn.
»Quatsch!« lautete die Antwort. »Die Sache ist einfach die, daß meine höheren physischen Zentren unberührt sind. Ich besitze noch mein Gedächtnis, ich kann denken und Schlüsse ziehen. Wenn das vorbei ist, bin ich fertig. Bin nicht mehr. Die Seele –?«
Er lachte höhnisch. Dann drehte er sein linkes Ohr wieder gegen das Kissen, zum Zeichen, daß er die Unterhaltung nicht fortzusetzen wünschte.
Maud und ich machten uns an unsere Arbeit, bedrückt durch den Gedanken an das furchtbare Geschick, das ihn betroffen hatte – wie furchtbar es war, sollten wir erst später ganz erfahren. Es lag etwas von dem Schrecken der Vergeltung darin. Unsere Gedanken waren ernst und feierlich, und wir sprachen anfangs nur flüsternd miteinander.
»Sie könnten mir gern die Handeisen abnehmen«, sagte er abends, als wir neben ihm standen und über seinen Zustand sprachen. »Ganz sicher, ich bin Paralytiker. Ich habe mich schon auf das Wundliegen gefaßt gemacht.«
Er lächelte sein verzerrtes Lächeln. Mauds Augen waren starr vor Entsetzen, und sie mußte sich abwenden.
»Wissen Sie, daß Ihr Mund ganz schief ist, wenn Sie lächeln?« fragte ich ihn, denn ich wußte, daß sie ihn pflegen mußte, und wollte ihr so viel wie möglich ersparen.
»Dann werde ich nicht mehr lächeln«, sagte er ruhig. »Ich dachte mir schon, daß irgend etwas nicht stimmte. Ich hatte den ganzen Tag ein taubes Gefühl in der rechten Backe. Und seit drei Tagen spüre ich schon etwas, abwechselnd schienen immer Arm und Hand, Bein und Fuß eingeschlafen.«
»Also mein Mund ist schief, wenn ich lächle?« fragte er kurz darauf. »Nun, von jetzt an denken Sie sich, daß ich innerlich lächle, mit meiner Seele, wenn Sie wollen, mit meiner Seele. Denken Sie sich, daß ich jetzt lächle.«
Und einige Minuten lag er still da und hing seinen seltsamen Vorstellungen nach.
Innerlich war er ganz unverändert. Er war immer noch der alte, unbezwingliche, furchtbare Wolf Larsen, nur jetzt gefangen in diesem Fleische, das einst so unbesiegbar und prachtvoll gewesen. Jetzt band es ihn mit unfühlbaren Fesseln, hüllte seine Seele in Finsternis und Schweigen und schloß ihn aus von der Welt, die für ihn der Inbegriff aufrührerischer Tatkraft gewesen war.
Wir nahmen ihm die Handeisen ab, konnten uns aber doch nicht mit seinem Zustand vertraut machen. Unser Gefühl lehnte sich dagegen auf. Was hatten wir noch von ihm zu erwarten? Wir wußten es nicht; aber vielleicht Furchtbares! Sein Geist konnte sich gegen das Fleisch erheben, konnte ausbrechen, wer wußte es? Unsere Erfahrung machte uns unsicher, und nur mit einem Gefühl von Angst gingen wir wieder an unsere Arbeit.
Mit der ›Schere‹ hievte ich den Großbaum an Bord. Seine vierzig Fuß mußten genügen, um den Mast hereinzubringen. Mit einer an der ›Schere‹ festgemachten Leine schwang ich den Baum hoch, daß er im Gleichgewicht pendelte, dann ließ ich das Ende auf das Deck herab, wo ich, um ihn vor dem Rutschen zu bewahren, große Klampen befestigt hatte. Den Einzelblock meiner ›Schere‹ hatte ich am Ende des Baumes festgemacht. Mit dem Spill konnte ich nun die Spitze des Baumes nach Belieben heben und senken, während das Ende seinen festen Halt behielt. Dazu konnte ich ihn mit Hilfe von Fallen seitwärts schwingen. An der Spitze befestigte ich einen Flaschenzug, und als die ganze Einrichtung fertig war, hatte ich meine helle Freude an der Kraft und Leichtigkeit, mit der sie arbeitete.
Natürlich nahm mich dieser Teil der Arbeit zwei volle Tage in Anspruch, und erst am Morgen des dritten waren wir fertig. Ich hatte mich besonders ungeschickt dabei angestellt. Ich hatte gesägt, gehackt und gestemmt, bis das verwitterte Holz aussah, als wäre es von Mäusen angeknabbert. Aber jetzt ging es auch.
Ein neuer Schlag hatte Wolf Larsen getroffen. Er hatte die Stimme verloren oder war jedenfalls daran, sie zu verlieren. Nur hin und wieder konnte er noch Gebrauch von ihr machen. Aber plötzlich konnte die Stimme mitten im Satze versagen, und dann mußten wir zuweilen stundenlang warten, bis die Verbindung wieder hergestellt war. Er klagte über starke Kopfschmerzen. In dieser Periode dachte er sich ein System aus, um sich mit uns verständigen zu können, wenn er überhaupt nicht mehr sprechen konnte: ein einfacher Händedruck bedeutete ja, ein doppelter nein. Es war gut, daß wir diese Vereinbarung trafen, denn schon am Abend versagte die Sprache ganz. Jetzt beantwortete er unsere Fragen durch Händedrücken, und wenn er zu sprechen wünschte, kritzelte er seine Gedanken mit der Linken, kaum lesbar, auf ein Blatt Papier.
Der strenge Winter war im Anmarsch. Ein Sturm folgte dem andern mit Schnee, Hagel und Regen. Die Robben hatten ihre große Wanderung nach dem Süden angetreten, und die Roockery war so gut wie verlassen. Ich arbeitete fieberhaft. Trotz Wind und Wetter war ich vom frühen Morgen bis zum späten Abend an Deck und machte tüchtige Fortschritte.
Meine Erfahrungen beim Einrichten der ›Schere‹ und des Fockmastes kamen mir jetzt zugute. Ich brachte Takelung, Stags und Falle an. Wie gewöhnlich, hatte ich die Arbeit unterschätzt: ich brauchte zwei Tage dazu. Und dabei war noch so vieles zu tun, wie zum Beispiel das Einrichten der Segel, die gänzlich umgearbeitet werden mußten.
Während ich am Fockmast arbeitete, nähte Maud an den Segeln, immer bereit, ihre Arbeit aus der Hand zu legen, wenn es galt, mir zu helfen, wo meine beiden Hände nicht ausreichten. Das Segelleinen war hart und schwer, und sie nähte nach Matrosenart mit der ganzen Handfläche und einer dreikantigen Segelnadel. Ihre armen Hände waren bald von Blasen bedeckt, aber sie kämpfte tapfer weiter, und dazu kochte und pflegte sie den Kranken.
»Nun, was sagen Sie dazu?« sagte ich am Freitagmorgen. »Heut kommt der Großmast an die Reihe!« Alles war bereit. Mit Hilfe des Ankerspills holte ich den Mast beinahe klar über die Reling. Kurz darauf pendelte er frei über Deck.
Maud klatschte in die Hände, als sie einen Augenblick nicht den Törn zu halten brauchte. Dann aber wurde ihr Gesicht plötzlich traurig.
»Er ist nicht über dem Loche«, sagte sie. »Müssen Sie nun wieder ganz von vorn anfangen?«
Ich lächelte überlegen, dann ließ ich eine Talje nach, zog die andere an, und der Mast schwang sich mitten über das Deck.
Gerade zu der viereckigen Öffnung der Staffel senkte sich das Ende herab, aber da drehte sich der Mast, so daß das eine Viereck nicht in das andere paßte. Doch ich war mir nicht eine Sekunde lang unklar, was ich zu tun hatte. Ich rief Maud zu, sie solle nicht weiter herunterlassen, ging dann an Deck und machte die Taschentalje mit einem Rollstich am Mast fest. Dann ging ich wieder nach unten, während Maud ziehen mußte. Beim Schein der Lampe sah ich, wie sich das Mastende langsam drehte, bis seine Ränder parallel zu denen der Staffel standen. Maud kehrte wieder zum Ankerspill zurück. Langsam senkte sich der Mast Zoll für Zoll, drehte sich aber wieder leicht dabei. Wieder richtete Maud die Lage mit der Taschentalje, und wieder ließ sie den Mast herab, bis Viereck in Viereck paßte. Der Mast war eingesetzt.
Ich rief, und sie kam schnell herunter, um zu sehen. Im gelben Schein der Laterne betrachteten wir unser Werk. Dann sahen wir uns an und klatschten in die Hände. Ich glaube, wir hatten beide feuchte Augen vor Freude über unsern Erfolg.
»Schließlich ging es doch ganz leicht«, meinte ich.
»Und doch ist es das reine Wunder, daß es vollbracht ist«, sagte Maud. »Ich vermag es kaum zu glauben daß der große Mast wirklich steht; daß Sie ihn aus dem Wasser gehoben, durch die Luft geschwungen und an seinen Platz gebracht haben. Es war eine Titanenarbeit.«
»Wir sind wahre Erfinder«, rief ich fröhlich, hielt aber inne und zog die Luft ein.
Ich warf einen hastigen Blick auf die Laterne. Sie rauchte nicht. Wieder zog ich die Luft ein.
»Es brennt!« sagte Maud plötzlich in überzeugten Ton. Wir sprangen zur Treppe, aber ich kam ihr zuvor und war zuerst an Deck. Aus dem Zwischendeck stieg eine dichte Rauchwolke empor.
»Der Wolf ist noch nicht tot«, murmelte ich, als ich durch den Rauch hindurchsprang.
Der Rauch war so dicht in dem engen Raum, daß ich mich vorwärts tasten mußte; und solche Macht hatte die Persönlichkeit Wolf Larsens über meine Einbildungskraft, daß ich darauf vorbereitet war, den würgenden Griff des hilflosen Riesen um meinen Hals zu fühlen. Ich zauderte; da dachte ich an Maud. Ich sah sie plötzlich vor mir, wie sie, die braunen Augen feucht vor Freude, im Schein der Laterne im Raum vor mir gestanden, und ich wußte, daß ich nicht umkehren konnte.
Keuchend und fast erstickend erreichte ich Wolf Larsens Koje. Ich streckte die Hand aus und tastete nach der seinen. Er lag regungslos da, bewegte sich aber leicht bei meiner Berührung. Ich fühlte über und unter seine Decken. Hier war keine Wärme, kein Anzeichen von Feuer zu spüren. Aber der Rauch, der mich blendete, husten und nach Luft schnappen ließ, mußte doch eine Ursache haben! Ich verlor einen Augenblick den Kopf und rannte verwirrt im Zwischendeck herum. Ein heftiger Zusammenstoß mit dem Tische brachte mich wieder zu mir. Ich überlegte mir, daß ein hilfloser Mann das Feuer nur dort, wo er lag, hatte anzünden können.
So lief ich denn wieder zu Wolf Larsens Koje. Dort stieß ich auf Maud. Wie lange sie sich schon in dieser erstickenden Luft befand, wußte ich nicht.
»Schnell an Deck!« befahl ich entschieden.
»Aber Humphrey –«, begann sie mit seltsam heiserer Stimme. »Bitte gehen Sie!« herrschte ich sie an.
Gehorsam zog sie sich zurück. Da fiel mir ein: »Wie, wenn sie die Treppe verfehlt!« Ich eilte ihr nach und blieb am Fuße der Treppe stehen. War sie schon oben? Als ich noch zögernd dort stand, hörte ich sie leise rufen:
»Ach, Humphrey, ich kann nicht herausfinden.«
Ich stieß auf sie, wie sie sich am Paneel vorwärts tastete, und trug sie halb zur Treppe. Die reine Luft wirkte wie Nektar. Maud war nur schwach und benommen, und ich ließ sie an Deck liegen, während ich zum zweiten Male nach unten ging.
Die Rauchwolke mußte ganz dicht bei Wolf Larsen sein – diesen Gedanken hielt ich fest, als ich gerade auf seine Koje zuging. Während ich unter seinen Decken herumtastete, fiel mir etwas Heißes auf den Handrücken. Es brannte, und ich zog die Hand schnell zurück. Jetzt begriff ich: Durch die Öffnung hindurch hatte er die Matratze der Oberkoje in Brand gesteckt. Seine Linke war noch imstande gewesen, es zu tun. Bei dem Mangel an Luftzug hatte das feuchte Stroh der Matratze nur schwelen können.
Als ich sie aus der Koje riß, schlugen sofort die hellen Flammen heraus. Ich löschte die brennenden Strohreste und stürzte dann an Deck, um Luft zu schöpfen. Einige Eimer Wasser genügten, um den Brand zu löschen. Zehn Minuten später hatte sich der Rauch genügend verzogen, daß ich Maud erlauben konnte, herunterzukommen. Wolf Larsen war bewußtlos, aber die frische Luft brachte ihn bald wieder zu sich. Während wir noch mit ihm beschäftigt waren, machte er uns durch Zeichen verständlich, daß er Papier und Bleistift wünschte.
»Bitte, stören Sie mich nicht,« schrieb er, »ich lächle.« »Sie sehen, daß ich immer noch ein Stückchen Hefe bin«, schrieb er kurz darauf.
»Aber nur ein sehr kleines Stückchen, Gott sei Dank!« sagte ich.
»Danke«, schrieb er. »Und doch bin ich noch voll und ganz hier, Hump. Ich vermag schärfer zu denken als je zuvor in meinem Leben. Nichts stört mich mehr. Die Konzentration ist vollkommen. Ich bin voll und ganz hier, ja mehr als das!«
Es war wie eine Botschaft aus der Nacht des Grabes, denn der Körper dieses Mannes war sein Mausoleum geworden. Und hier, in diesem seltsamen Grabe, flatterte sein Geist und lebte. Er sollte flattern und leben, bis die letzte Verbindung abgebrochen war, und dann – wer wußte, wieviel länger sie noch flattern und leben konnte?
»Ich glaube, meine linke Seite wird auch lahm«, schrieb Wolf Larsen am Morgen nach seinem Versuch, das Schiff in Brand zu stecken. »Die Gefühllosigkeit nimmt zu. Ich kann kaum die Hand bewegen. Sie müssen lauter sprechen. Die letzten Leinen sind bald gekappt.«
»Haben Sie Schmerzen?« fragte ich.
Ich mußte meine Frage laut wiederholen, ehe er antwortete: »Nicht immer.«
Seine Linke tastete langsam und mühevoll über das Papier, und mit größter Schwierigkeit entzifferten wir das Gekritzel. Es war wie eine Geisterschrift.
»Aber ich bin noch hier, voll und ganz hier«, kritzelte die Hand langsamer und mühseliger als je.
Der Bleistift entfiel ihr, und wir mußten ihn wieder zwischen seine Finger stecken.
»Wenn ich keine Schmerzen spüre, habe ich ganz Ruhe und Frieden. Ich habe nie so klar gedacht. Ich kann über das Leben nachdenken wie ein weiser Hindu.«
»Und die Unsterblichkeit?« rief ihm Maud ins Ohr.
Dreimal versuchte die Hand zu schreiben, tappte verzweifelt. Der Bleistift fiel. Vergebens wollten wir ihn ihm wieder reichen. Die Finger vermochten sich nicht mehr zu schließen. Da umschloß Maud seine Hand mit der ihren und drückte sie zusammen, und er schrieb mit großen Buchstaben und so langsam, daß zwischen jedem einzelnen Minuten vergingen:
»Q–u–a–t–s–c–h.«
Dies war Wolf Larsens letztes Wort: Quatsch – skeptisch und unbezwinglich bis zuletzt. Arm und Hand sanken nieder. Ein leichtes Zucken durchfuhr seinen Körper. Dann regte er sich nicht mehr. Maud ließ seine Hände los. Die Finger öffneten sich durch ihr eigenes Gewicht, und der Bleistift fiel zu Boden.
»Können Sie noch hören?« rief ich, indem ich seine Hand faßte und auf den einmaligen Druck wartete, der ›ja‹ bedeutete. Es erfolgte keine Antwort. Die Hand war tot.
»Ich habe bemerkt, daß dir Lippen sich leicht bewegten«, sagte Maud.
Ich wiederholte die Frage. Die Lippen bewegten sich wirklich. Maud legte die Fingerspitzen darauf. Nochmals wiederholte ich die Frage. »Ja«, verkündete Maud. Wir blickten uns erwartungsvoll an.
»Was nun?« fragte ich. »Was sollen wir ihn fragen?«
»Ach, fragen Sie ihn – –«
Sie zögerte.
»Fragen Sie ihn etwas, das ein Nein als Antwort erfordert«, schlug ich vor. »Dann werden wir Gewißheit haben.«
»Sind Sie hungrig?« rief sie.
Seine Lippen bewegten sich unter ihrem Finger, und sie meldete: »Ja.«
»Wollen Sie etwas Fleisch haben?« lautete die nächste Frage.
»Nein«, verkündete sie.
»Brühe?«
»Ja, er möchte etwas Brühe haben,« sagte sie und blickte zu mir auf. »Bis sein Gehör völlig versagt, werden wir uns mit ihm verständigen können. Dann –« Sie sah mich mit einem seltsamen Blick an. Ich sah, wie ihre Lippen zitterten und ihr die Tränen in die Augen stiegen. Sie wankte, und ich fing sie in meinen Armen auf.
»Ach, Humphrey,« schluchzte sie, »wann wird dies alles ein Ende haben? Ich bin so müde, so müde.«
Sie barg ihren Kopf an meiner Schulter, ihre zarte Gestalt wurde von heftigem Weinen geschüttelt. Wie eine Feder lag sie mir im Arm, so leicht und ätherisch. »Jetzt ist sie doch zusammengebrochen!« dachte ich. »Was kann ich ohne ihre Hilfe tun?«
Aber ich beruhigte und tröstete sie, bis sie sich zusammenriß und ihr Gleichgewicht ebenso schnell wiedergewann, wie sie sich körperlich zu erholen pflegte.
Als der Fockmast stand, machte die Arbeit sichtliche Fortschritte. Fast ehe ich es wußte, und ohne daß ich mich besonders angestrengt hätte, war der Großmast eingesetzt. Dann wurde die Piek am Fockmast angebracht, und einige Tage später befanden sich alle Stags und Wanten an ihren Plätzen. Toppsegel wären für eine nur aus zwei Köpfen bestehende Mannschaft nur gefährlich gewesen, und so heißte ich die Marsstengen an Deck und machte sie fest.
Noch einige Tage brauchten wir, um die Segel fertigzustellen und festzumachen. Wir hatten nur drei: Klüver-, Fock- und Großsegel, und geflickt, verkleinert und formlos, wie sie waren, paßten sie nur schlecht zu einem so schöngebauten Fahrzeug wie die ›Ghost‹.
Von meinen vielen neuen Berufen eignete ich mich sicher am wenigsten zu dem eines Segelmachers. Ich wußte besser mit den Segeln umzugehen, als sie zu verfertigen, und ich zweifelte nicht, daß es mir gelingen sollte, den Schoner in irgendeinen japanischen Hafen zu bringen. Ich hatte wirklich ein gut Teil Navigation aus den an Bord befindlichen Büchern gelernt, und zudem hatte ich Wolf Larsens Sternenskala, nach der ein Kind sich hätte orientieren können.
Was ihren Erfinder betraf, so hatte sich sein Befinden wenig geändert, außer der Tatsache, daß seine Taubheit zunahm und die Bewegungen seiner Lippen immer schwächer wurden. An dem Tage aber, als wir mit den Segeln fertig wurden, vernahm ich das letzte Wort, und die letzte Bewegung seiner Lippen hörte auf – aber nicht, ehe er auf meine Frage: »Sind Sie voll und ganz da?« noch einmal »Ja« geantwortet hatte. Die letzte Leine war gekappt. Irgendwo in der Grabkammer des Fleisches weilte noch die Seele des Mannes. Umschlossen vom lebendigen Lehm, brannte diese starke Intelligenz, die wir gekannt hatten, aber sie brannte in Schweigen und Finsternis. Und sie war körperlos geworden. Sie wußte nichts mehr von ihrem Körper. Sie kannte keinen Körper. Sie kannte nur sich selbst und die Weite und Tiefe von Ruhe und Dunkelheit.
Der Tag unserer Abreise kam. Es gab nichts mehr, das uns auf der Mühsalinsel zurückgehalten hätte. Die verkürzten Masten der ›Ghost‹ waren an ihrem Platze, die Segel festgemacht. Alles, was ich geschaffen, war stark, nichts davon war schön, aber ich wußte, daß es leisten würde, was es sollte, und wenn ich es anblickte, fühlte ich mich stark.
»Das habe ich gemacht! Mit meinen eigenen Händen!« Das hätte ich am liebsten hinausgeschrien.
Aber Maud und ich hatten die wundersame Fähigkeit, einer die Gedanken des andern auszusprechen, und als wir nun darangingen, das Großsegel zu setzen, sagte sie:
»Und daß Sie das allein mit Ihren eigenen Händen gemacht haben, Humphrey!«
»Aber es waren noch zwei Hände da,« antwortete ich, »zwei kleine Hände.«
Sie hielt mir lachend die Hände entgegen.
»Ich werde sie nie wieder sauber bekommen,« klagte sie, »und sonnenverbrannt werden sie wohl mein ganzes Leben bleiben.«
»Dann werden der Schmutz und die sonnenverbrannte Haut Ihr Ehrenzeichen sein,« sagte ich und nahm ihre Hände in die meinen, und trotz allen selbst guten Vorsätzen würde ich die beiden teuren Hände geküßt haben, hätte sie sie nicht schnell zurückgezogen.
Unsere Kameradschaft stand auf schwachen Füßen. Ich hatte meine Liebe lange und gut beherrscht, aber jetzt drohte sie mich zu überwältigen. Gegen meinen Willen hatte sie eigenmächtig meine Augen zum Sprechen gebracht, und nun überwand sie auch meine Zunge – und meine Lippen dazu, denn sie sehnten sich in diesem Augenblick wie wahnsinnig danach, die beiden Händchen zu küssen, die so treu und schwer gearbeitet hatten. Ich war in diesem Augenblick wie von Sinnen. In meinem Innern tönte es, als riefen mich Jagdhörner zu ihr. Und mich wehte ein Wind an, dem ich nicht widerstehen konnte, der meinen ganzen Körper ins Schwanken brachte, bis ich mich, ganz unbewußt, zu ihr beugte. Und sie wußte es. Sie mußte es wissen, als sie schnell ihre Hände fortzog und es doch nicht lassen konnte, mir einen hastig forschenden Blick zu senden, ehe sie die Augen senkte. –
Mit Hilfe der Deckstaljen hatte ich die Falle nach vorn zum Spill geschafft, und jetzt setzte ich gleichzeitig Großsegel und Piek. Es war nicht leicht, aber es ging, und bald war die Fock oben und flatterte im Winde. »Wir bekommen den Anker hier nie herauf, es ist zu eng,« sagte ich, »wir müssen erst aus den Schären heraus sein.«
»Was machen wir da?« fragte sie.
»Wir kappen ihn,« lautete meine Antwort, »und während ich es tue, müssen Sie Ihre erste Arbeit am Spill verrichten. Ich muß sofort ans Rad, und gleichzeitig müssen Sie den Klüver setzen.«
Dies Manöver hatte ich mindestens zwanzigmal durchdacht, und ich wußte, daß Maud imstande war, das unentbehrliche Segel zu setzen. Ein frischer Wind wehte gerade in die Bucht herein, und wenn auch das Wasser ruhig war, so mußten wir doch mit äußerster Schnelligkeit arbeiten, um sicher hinauszukommen.
Sobald ich den Schäkelbolzen hinausgeschlagen hatte, rasselte die Kette durch das Klüsgat ins Meer. Ich stürzte nach achtern und legte das Ruder um. Die ›Ghost‹ schien lebendig zu werden, als ihre Segel sich zum erstenmal blähten. Der Klüver ging hoch. Als er in den Wind kam, schwang sich der Bug der ›Ghost‹ herum, und ich mußte das Rad einige Spaken zurückdrehen, um das Schiff wieder in den Kurs zu bringen. Ich hatte mir eine automatische Klüverschoot erdacht, die den Klüver von selbst herüberbrachte, so daß Maud ihn nicht zu bedienen brauchte; sie hatte aber kaum den Klüver hoch, als ich das Ruder hart umlegte. Es war ein gefährlicher Augenblick, denn die ›Ghost‹ lief bis auf Steinwurfweite geradeswegs auf den Strand zu. Aber gehorsam drehte sie sich in den Wind. Die Segel schlugen heftig – ein Geräusch, das meine Ohren mit Entzücken hörten –, und dann standen sie wieder prall auf der andern Seite.
Maud hatte ihre Aufgabe vollbracht und kam nach achtern, wo sie neben mir stehenblieb, eine kleine Mütze auf dem vom Winde zerzausten Haar, die Wangen von der Anstrengung gerötet, die Augen weit und hell vor Erregung, die Nasenflügel zitternd in der frischen salzigen Luft. Ihre braunen Augen glichen denen eines aufgescheuchten Rehs. Ihr Blick war wach und unruhig, wie ich ihn nie gesehen, ihre Lippen öffneten sich, und ihr Atem stockte, als die ›Ghost‹ gegen das Felsenriff an der Ausfahrt der inneren Bucht anstürmte, dann in den Wind ging und unter vollen Segeln in das sichere Fahrwasser hinausfuhr.
Meine Dienstzeit als Steuermann in den Robbengründen kam mir jetzt ausgezeichnet zustatten. Ich brachte das Schiff gut aus der inneren Bucht heraus und ging in einem weiten Bogen in die äußere hinein. Noch ein Schlag, und die ›Ghost‹ hatte die offene See erreicht. Nun hatte sie den Hauch des Ozeans gespürt und atmete selbst im gleichen Rhythmus, indem sie die breitrückigen Wogen sanft hinauf- und hinabglitt. Es war trübe und wolkig gewesen, jetzt aber brach die Sonne hindurch – ein willkommenes Vorzeichen – und schien über die geschweifte Küste, wo wir den Herrn des Harems herausgefordert und die Holluschickis erschlagen hatten. Die ganze Mühsalinsel erstrahlte im Sonnenschein. Selbst das unheimliche südwestliche Vorgebirge sah weniger unheimlich aus, und hie und da, wo der Gischt hoch emporsprang, glänzte und funkelte es in der blendenden Sonne.
»Ich werde stets mit Stolz daran denken«, sagte ich zu Maud.
Sie warf mit einer königlichen Gebärde den Kopf zurück und sagte: »Du liebe Mühsalinsel! Ich werde dich immer lieben.«
»Und ich auch«, sagte ich rasch.
Unsere Blicke wollten sich treffen, und doch zwangen wir sie aneinander vorbei.
Einen Augenblick schwiegen wir fast unbeholfen, dann aber sagte ich:
»Sehen Sie die schwarzen Wolken in Luv. Sie werden sich erinnern, daß ich Ihnen gestern abend sagte, das Barometer fiele.«
»Und die Sonne ist verschwunden«, sagte sie, den Blick immer noch auf unsere Insel gerichtet.
»Die Fahrt geht nach Japan«, rief ich heiter. »Ein günstiger Wind und volle Segel, was wollen wir mehr?« Ich verließ das Rad und lief nach vorn, warf Fock- und Großschoot los und machte alles zum Empfang des Windes bereit. Es war Sturm, ein tüchtiger Sturm, aber ich entschloß mich, so lange wie möglich die Segel oben zu behalten. Leider war es unter diesen Umständen nicht möglich, das Ruder festzumachen, und so mußte ich darauf gefaßt sein, die ganze Nacht am Rade zu stehen. Maud bestand darauf, mich abzulösen, es zeigte sich aber doch, daß sie nicht Kraft genug hatte, in schwerer See zu steuern. Sie war ganz niedergeschlagen, fand aber bald genug zu tun: Falle und Leinen mußten gestrafft, das Essen in der Kombüse gekocht, Betten gemacht und Wolf Larsen gepflegt werden, und sie beendete ihr Tagewerk, indem sie in der Kajüte und im Zwischendeck gründlich aufräumte.
Ich steuerte die ganze Nacht ohne Ablösung, der Wind wuchs langsam und beständig, und die See mit ihm. Um fünf Uhr morgens brachte Maud mir heißen Kaffee und Kuchen, den sie gebacken hatte, und um sieben flößte mir ein tüchtiges, kochend heißes Frühstück neues Leben ein.
Den ganzen Tag wuchs der Wind. Und immer noch schäumte die ›Ghost‹ dahin, raste Meile auf Meile mit einer Geschwindigkeit, die ich auf mindestens elf Knoten die Stunde schätzte. Ich mußte die Gelegenheit wahrnehmen, aber bei Einbruch der Nacht war ich völlig erschöpft. Obgleich ich in glänzender körperlicher Verfassung war, hatte ich jetzt doch die Grenze meiner Kraft erreicht. Dazu flehte Maud mich an, beizudrehen, und ich wußte, daß das, wenn Wind und See weiter so wuchsen, bald nicht mehr möglich war. So traf ich denn bei Dunkelwerden meine Vorbereitungen.
Aber ich hatte nicht mit den ungeheuren Schwierigkeiten gerechnet, die das Reffen dreier Segel für einen einzigen Mann bedeutete. Immer wieder machte der Sturm meine Anstrengungen zunichte, riß mir die Leinwand aus den Händen und zerstörte in einem Augenblick, was ich in zehn Minuten schwersten Kampfes erreicht hatte. Um acht Uhr hatte ich erst das zweite Reff in die Fock geschlagen. Um elf war ich noch nicht viel weiter gekommen. Meine Fingerspitzen bluteten, und alle Nägel waren abgebrochen. Vor Schmerz und Erschöpfung weinte ich heimlich im Dunkeln, wenn Maud es nicht sah.
Verzweifelt gab ich es auf, das Großsegel zu reffen, und entschloß mich, den Versuch zu machen, unter gereffter Fock beizudrehen. Noch drei Stunden brauchte ich, um Großsegel und Klüver zu beschlagen, und um zwei Uhr morgens konnte ich, mehr tot als lebendig, feststellen, daß mein Versuch geglückt war. Die gereffte Fock tat ihren Dienst. Die ›Ghost‹ hielt sich am Winde und zeigte keine Neigung, sich quer in den Seegang zu legen.
Ich war ganz ausgehungert, aber Maud versuchte vergebens, mir etwas einzuflößen. Mit vollem Munde schlief ich auf dem Stuhl ein.
Wie ich aus der Kombüse in die Kajüte kam, weiß ich nicht Ich wurde von Maud geführt und gestützt. Als ich lange darauf erwachte, lag ich in meiner Koje. Maud hatte mich hingelegt und mir die Schuhe ausgezogen. Ich war ganz steif und zerschlagen und schrie vor Schmerz auf, als ich mit meinen wunden Fingerspitzen das Bettzeug berührte.
Es war offenbar noch nicht Morgen, und so schloß ich die Augen und schlief wieder ein.
Wieder erwachte ich, verwirrt, daß ich nicht besser schlief. Ich zündete ein Streichholz an und sah auf die Uhr. Sie zeigte Mitternacht. Und ich hatte das Deck um drei Uhr nachts verlassen! Nach einigem Nachdenken fand ich die Lösung: Ich hatte einundzwanzig Stunden geschlafen. Ich lauschte eine Weile auf das Stampfen der ›Ghost‹, das Rauschen der See und das gedämpfte Tosen des Windes, dann drehte ich mich auf die andere Seite und schlief friedlich weiter bis zum Morgen.
Als ich um sieben Uhr aufstand, sah ich nichts von Maud und schloß daher, daß sie in der Kombüse sei, um das Frühstück zu bereiten. Ich begab mich an Deck und fand, daß die ›Ghost‹ sich prächtig hielt. In der Kombüse brannte zwar das Feuer, und das Wasser kochte, aber ich fand keine Maud.
Ich entdeckte sie schließlich im Zwischendeck neben Wolf Larsens Koje. Ich betrachtete ihn, den Mann, der von der höchsten Zinne des Lebens herabgeschleudert war in dies furchtbare Lebendigbegrabensein. Sein stilles, ruhiges Gesicht zeigte eine Milde, die ich nie zuvor gesehen. Maud blickte mich an, und ich verstand. »Sein Leben ist im Sturm erloschen«, sagte ich.
»Aber er lebt noch«, antwortete sie mit unendlicher Zuversicht in ihrer Stimme.
»Er hatte zuviel Kräfte.«
»Ja«, sagte sie. »Aber jetzt binden sie ihn nicht mehr. Er ist ein freier Geist.«
»In Wahrheit: Er ist ein freier Geist«, entgegnete ich; dann faßte ich ihre Hand und führte sie an Deck.
Die Gewalt des Sturmes brach sich in dieser Nacht, das heißt: er legte sich ebenso langsam und allmählich, wie er aufgekommen war. Als ich am nächsten Morgen nach dem Frühstück Wolf Larsens Leiche zum Begräbnis an Deck schaffte, wehte es noch stark, und die See ging hoch. Das Wasser spülte immer wieder über das Deck hinweg und lief durch die Speigatten ab. Eine heftige Bö traf plötzlich den Schoner, der sich überlegte, daß die Leereling völlig begraben war, und das Pfeifen in der Takelung wuchs zu einem wilden Kreischen. Wir standen bis zu den Knien im Wasser. Ich entblößte den Kopf.
»Ich erinnere mich nur eines Teils des Rituals,« sagte ich, »nämlich: ›Und der Leichnam soll ins Meer geworfen werden.‹«
Maud sah mich an, überrascht und entsetzt. Aber die Erinnerung an etwas, das ich einst gesehen, wurde lebendig in mir und ließ mich Wolf Larsen begraben, wie Wolf Larsen einen andern begraben hatte. Ich hob das Ende des Lukendeckels, und der in Segelleinen eingenähte Körper glitt, die Füße voran, ins Meer. Das eiserne Gewicht zog ihn nieder. Er war verschwunden. »Leb wohl, Luzifer, du stolzer Geist«, flüsterte Maud, so leise, daß ihre Worte vom Heulen des Windes übertönt wurden; aber ich sah ihre Lippen sich bewegen und verstand.
Uns an der Reling haltend, arbeiteten wir uns nach achtern durch. Da blickte ich aufs Meer hinaus. Die ›Ghost‹ hob sich in diesem Augenblick auf einer Woge, und ich sah deutlich, zwei bis drei Meilen entfernt, einen kleinen Dampfer, der, rollend und stampfend, gerade auf uns zukam. Er war schwarz gestrichen, und nach der Beschreibung der Jäger erkannte ich ihn als einen Zollkutter der Vereinigten Staaten. Ich zeigte ihn Maud und führte sie schnell auf die Ruff.
Dann stürzte ich nach vorn an die Flaggenkiste, aber in diesem Augenblick fiel mir ein, daß ich vergessen hatte, für ein Flaggenfall zu sorgen.
»Wir brauchen kein Notsignal,« meinte Maud, »wenn sie uns nur sehen.«
»Wir sind gerettet«, sagte ich ernst und feierlich. Und dann in überströmendem Glück: »Ich weiß kaum, ob ich mich freuen soll oder nicht.«
Ich sah sie an, unsere Blicke begegneten sich. Wir lehnten uns aneinander, und ehe ich es wußte, hatte ich sie in meine Arme geschlossen.
»Muß ich es sagen?« fragte ich.
Sie antwortete: »Du mußt nicht, aber es wäre so süß, so unsagbar süß, es zu hören.«
Unsere Lippen trafen sich. – –
»Mein Weib, mein liebes kleines Weib!« sagte ich und streichelte mit der freien Hand ihre Schulter, wie alle Liebenden tun, obwohl sie es in keiner Schule gelernt haben.
»Mein Gatte!« sagte sie, und ihre Lider zitterten und ihre Augen verschleierten sich, als sie mich anblickte und ihren Kopf mit einem glücklichen kleinen Seufzer an meine Brust schmiegte.
Ich sah nach dem Kutter. Er war ganz nahe. Ein Boot wurde gerade herabgelassen.
»Einen Kuß, Liebste«, flüsterte ich. »Noch einen Kuß, ehe sie kommen –«
»Und uns vor uns selber retten«, vollendete sie mit einem bezaubernden Lächeln, so rätselhaft, wie ich es noch nie gesehen, denn es enthielt alle Rätsel der Liebe.