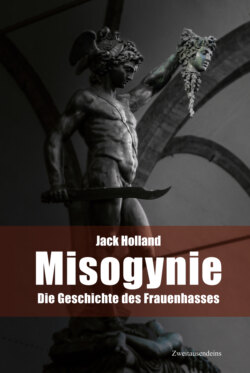Читать книгу Misogynie - Jack Holland - Страница 6
1 Pandoras Töchter
ОглавлениеMan kann den Zeitpunkt, an dem eine Diskriminierung beginnt, nur selten genau bestimmen. Aber wenn der Frauenhass einen Ursprung hat, dann irgendwann im 8. Jahrhundert v. Chr. irgendwo im östlichen Mittelmeerraum.
Um diese Zeit verbreiteten sich in Griechenland und Judäa Schöpfungsgeschichten von mythologischer Kraft, in denen vom Sündenfall des Menschen erzählt und die Schuld an allem daraus resultierenden Elend und Leiden den Frauen und ihrer Charakterschwäche angelastet wird. Beide Schöpfungsmythen sind fest im Weltbild der abendländischen Kulturen verankert, gespeist von ihren beiden einflussreichsten Quellen: In der jüdischen Tradition, wie sie in der Genesis erzählt (und zumindest in den Vereinigten Staaten von den meisten Menschen noch heute für wahr gehalten) wird5, ist Eva die Übeltäterin, bei den Griechen ist es Pandora.
Die Griechen sind die Gründungsväter unserer Geisteswelt. Ihre Vorstellung eines von Naturgesetzen bestimmten Universums, die der menschliche Geist erforschen und begreifen kann, ist das Fundament, das unserer Wissenschaft und Philosophie zugrunde liegt. Sie haben die erste Demokratie errichtet. Aber auch in der Geschichte des Frauenhasses nehmen sie eine herausragende Stellung als Wegbereiter eines negativen Frauenbildes ein, das sich bis in unsere Zeit gehalten hat und jede uns möglicherweise noch verbliebene Illusion, mit dem Aufstieg von Vernunft und Wissenschaft müsse zwangsläufig ein Niedergang von Vorurteilen und Hass einhergehen, zunichte macht.
Die erste schriftliche Überlieferung des Pandora-Mythos stammt von Hesiod, einem Bauern, der sich zum Dichter berufen fühlte und die Geschichte im 8. Jahrhundert v. Chr. in zwei epischen Dichtungen – Theogonie und Werke und Tage – aufschrieb. Seine als Bauer erworbenen Kenntnisse der Natur hinderten ihn nicht daran, in seinem Bericht von der Erschaffung der Menschheit einige grundlegende Tatsachen des Lebens zu ignorieren. Dem zufolge lebten die Männer nämlich, bevor die Frauen in Erscheinung traten, in seliger Selbstgenügsamkeit als Gefährten der Götter, »fern von Übeln, elender Mühsal und quälenden Leiden …«6. Wie in der biblischen Schöpfungsgeschichte ist die Frau nur ein nachträglicher Einfall. Aber in der griechischen Mythologie ist damit auch noch eine bösartige Absicht verbunden. Der Göttervater Zeus will die Männer bestrafen, indem er ihnen das Geheimnis des Feuers vorenthält, so dass sie das Fleisch roh essen müssen wie Tiere. Doch der Halbgott Prometheus, der die ersten Männer geschaffen hat, stiehlt das Feuer aus dem Himmel und bringt es auf die Erde. Wütend über diese Täuschung ersinnt Zeus eine beispiellose Gemeinheit in Form eines »Geschenks«: Er will den Männern »ein Übel geben, an dem jeder seine Herzensfreude haben und doch sein Unheil umarmen soll«: Pandora, das »Allgeschenk« – »weil alle Bewohner der olympischen Häuser ihr Gaben schenkten zum Leid der schaffenden Männer«7. Kalon Kakon, wie sie im Griechischen auch genannt wird, heißt »das schöne Übel«. Sie war so schön wie die Göttinnen selbst.
Von ihr kommt das schlimme Geschlecht und die Scharen der Weiber, ein großes Leid für die Menschen; sie wohnen bei den Männern, Gefährtinnen nicht in verderblicher Armut, sondern nur im Überfluss.8
Zeus weist die Götter an, Pandora einen »hündischen Sinn und verschlagene Art einzupflanzen«. Dann schickt er sie Epimetheus, dem jüngeren Bruder des Prometheus, als Geschenk. Der erliegt ihrem Zauber und nimmt sie zur Gemahlin. Pandora bringt ein großes versiegeltes Fass mit, das sie dem Willen der Götter nach niemals öffnen darf. Das Fass ist ein tönernes, bauchiges Gefäß, wie es als Vorratsbehälter für Wein und Olivenöl und in früherer Zeit auch als Sarg verwendet wurde.9 Pandora kann der Versuchung nicht widerstehen, einen Blick hineinzuwerfen:
Das Weib aber hob mit den Händen den mächtigen Deckel vom Fass, ließ alles heraus und schuf der Menschheit leidvolle Schmerzen.10
Seither, so die griechische Mythologie, sind die Menschen dazu verdammt, sich zu plagen, zu altern, Krankheit und qualvollen Tod zu erleiden.
Mythen haben die Funktion, Fragen zu beantworten, wie wir sie als Kinder gestellt haben, etwa in der Art von: »Warum leuchten die Sterne?« oder: »Warum ist der Großvater gestorben?«. Sie dienen aber auch dazu, die bestehende – natürliche und soziale – Ordnung der Dinge zu rechtfertigen und prägen Traditionen, Überzeugungen und Rollen in der Gesellschaft. Einer der zentralen Glaubenssätze der griechischen und später auch der judaisch-christlichen Kultur besagte, dass der sterbliche Mann von den Göttern beziehungsweise von Gott nicht zusammen mit den Tieren, sondern in einem eigenen Schöpfungsakt geschaffen wurde. Dieser Glaube, der sich unter konservativen Christen beharrlich gehalten hat, ist auch der Grund, warum Darwins Evolutionstheorie bis heute auf so erbitterten Widerstand stößt. Der Besitz des Feuers galt als Beweis dafür, dass sich der Mann von den Tieren unterschied und dass er in der Artenhierarchie höher stand als diese. Aber dadurch, dass sich der Mann in den Besitz des Feuers brachte, trat er den Göttern zu nahe. Für diesen Hochmut nun wurde er mit der Frau bestraft, die ihn daran erinnern sollte, dass der sterbliche Mensch, gleichgültig was seine Herkunft und seine höheren Ziele sein mögen, genauso in die Welt eintritt wie das niedrigste Tier. Heute wird diese ursprünglich verächtliche Sicht von einigen ins Gegenteil verkehrt: Sie preisen gerade diese, wie sie es sehen, engere Verbindung der Frau zur Natur. Die Griechen jedoch sahen in der Natur eine Bedrohung ihres höheren Selbst, und die Frau war für sie die mächtigste (weil verführerischste) Verkörperung der Natur. Sie musste ihres Menschseins beraubt werden, obwohl sie den Fortbestand der Menschheit sicherte. Ihr gebührte Verachtung, weil sie die Lust entfachte, die uns in den Kreislauf von Geburt und Tod führt, aus dem es kein Entrinnen gibt.
Die Griechen schoben nicht nur Pandora die Schuld für die Sterblichkeit des Menschen in die Schuhe, sie definierten darüber hinaus die Frau als die Antithese zur männlichen These, das »Andere«, das in festen Grenzen gehalten werden musste. Vor allem aber legten die Griechen das philosophisch-wissenschaftliche Fundament für eine dualistische Sicht der Wirklichkeit, in der Frauen auf ewig dazu verdammt waren, diese wandelbare und grundsätzlich verachtenswerte Welt zu repräsentieren. Das ist eines der Paradoxa, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen: dass einige der Werte, die uns am meisten bedeuten, in einer Gesellschaft geprägt wurden, in der Frauen erniedrigt, verunglimpft und geschmäht wurden. »Im Athen des Dunklen Zeitalters setzte sich eine auch dem heutigen Leser vertraute geschlechtsspezifische Rollenverteilung endgültig durch«11, schreibt die Historikerin Sarah Pomeroy. Das heißt, neben Platon und dem Parthenon verdanken wir Griechenland einige der billigsten geschlechtlichen Dichotomien wie die vom »guten« und vom »bösen« Mädchen.
Hesiod verfasste seine Schriften etwa fünf Jahrhunderte, nachdem die Stämme, aus denen später die Griechen wurden, als Eroberer in den Mittelmeerraum eingedrungen waren und neben dem griechischen Festland auch die umliegenden Inseln und die westlichen Küstengebiete Kleinasiens (die heutige Türkei) besetzt hatten. Im 6. Jahrhundert hatten sich die Griechen im Westen bis nach Sizilien, in die Küstenregionen Süditaliens und an die Südostküste Galliens (des heutigen Frankreich) ausgebreitet. Sie brachten ihr Pantheon kriegerischer Götter mit, deren Mächtigster Zeus mit dem Donnerkeil war. Nun ist eine Kultur noch nicht zwangsläufig frauenfeindlich, nur weil sie ein paar gewalttätige Kriegsgötter hat. Ältere Kulturgruppen, auf die die Griechen bei ihren Eroberungszügen stießen, wie die Ägypter oder die Babylonier beispielsweise, hatten Kriegsgötter in Hülle und Fülle, aber sie hatten nichts, was dem Mythos vom Sündenfall vergleichbar gewesen wäre. Im sumerischen Gilgamesch-Epos, das um 3000 v. Chr. in Mesopotamien entstand, gibt es einen Helden, der wie Prometheus die Götter herausfordert. Gilgamesch tut dies, indem er gleich ihnen Unsterblichkeit erlangen möchte; aber in diesem Fall wird keine Frau zum Instrument eines rachsüchtigen Gottes gemacht, der die Männer dafür bestraft, dass sie das Schicksal der Sterblichkeit nicht hinnehmen wollen. Gilgamesch macht auch nicht die Frauen für das »Los der Menschen« verantwortlich; daran, dass wir sterben müssen, sind die Götter schuld. Die Göttin, die über das Paradies herrscht, sagt zu Gilgamesch:
Gilgamesch, wohin läufst du? Das Leben, das du suchst, wirst du sicher nicht finden! Als die Götter die Menschheit erschufen, teilten den Tod sie der Menschheit zu, nahmen das Leben für sich in die Hand. Du, Gilgamesch – dein Bauch sei voll, ergötzen magst du dich Tag und Nacht! Feiere täglich ein Freudenfest! Tanz und spiel bei Tag und Nacht! Deine Kleidung sei rein, gewaschen dein Haupt, mit Wasser sollst du gebadet sein! Schau den Kleinen an deiner Hand, die Gattin freu’ sich auf deinem Schoß! Denn auch solcher Art ist des Menschen Los!12
In der nomadischen Kultur der Kelten, die sich etwas später in Nordwesteuropa ausbreitete, gab es zwar ebenfalls jede Menge Geschichten vom gefundenen und verlorenen Paradies, aber den Mythos vom Sündenfall sucht man auch hier vergebens. Wie die Sumerer stellten sich die Kelten das Paradies als blühenden Garten vor, in dem schöne Frauen herrschen und die Männer verführen, sich einem Leben in Glückseligkeit hinzugeben. Der einzige Konflikt, der daraus resultiert, ist der innere Zwiespalt des Mannes, der zwischen Heimweh und seinem Verlangen nach den Frauen des Gartens hin- und hergerissen ist. Hier gibt es die Lust, aber ganz ohne negative Folgen. Die Kelten kennen keine Entsprechung der Pandora oder der Eva.
Die Götter des Pantheon – der Überlieferung nach auf dem Olymp angesiedelt – wurden zu den Nationalgöttern Griechenlands und erhielten ein paar charakteristische Wesenszüge. Vier der fünf höheren Göttinnen sind entweder jungfräulich oder geschlechtslos. Die wichtigste von allen, Athene, ist so androgyn wie die Freiheitsstatue im Hafen von New York. Sie wird gewöhnlich mit Schild, Schwert und Helm dargestellt, gekleidet in ein langes, schweres Gewand, das ihre Körperformen verhüllt. Aphrodite, die Göttin der Liebe, verhält sich gelegentlich wie ein himmlischer Schwachkopf. Die Geschlechtslosigkeit der griechischen Göttinnen steht in eklatantem Gegensatz zur gewalttätigen Draufgängernatur ihrer männlichen Gegenparts. Und zu allem Überfluss steht dem griechischen Pantheon mit Zeus ein Serienvergewaltiger als Göttervater vor. Fast alle seine zahlreichen Nachfahren sind durch Vergewaltigung einer sterblichen Frau gezeugt, mit Ausnahme von Athene und Dionysos, die Zeus höchstpersönlich gebiert. Athene entspringt – in voller Rüstung, mit Schwert und Schild – dem Kopf des Zeus, Dionysos wird aus seinem Schenkel geboren.
Alle Religionen verlangen von uns, dass wir an das Unmögliche glauben. Im Schöpfungsmythos um Pandora, in dem Männer ohne weibliches Zutun das Licht der Welt erblicken können, drückt sich die männliche Wunschvorstellung von einer autarken, von Frauen gänzlich unabhängigen Existenz aus. Der unmögliche Wunsch gipfelt im griechischen Pantheon in dem männlichen Anspruch, Frauen ausgerechnet da für überflüssig zu erklären, wo sie tatsächlich unentbehrlich sind – bei der Fortpflanzung. So absurd der Mythos vom Göttervater, der zur Mutter der Götter wird, auch klingen mag, erhielt er doch Auftrieb durch Aristoteles’ Lehre, in der die Rolle der Mutter während der Schwangerschaft als eine rein nährende definiert ist. Er sah sie als passive Empfängerin des männlichen Samens, der außer der Umgebung alles enthält, was der Fötus zu seiner Entwicklung benötigt. Was immer die Frauen können, die Männer können es offenbar besser – auch wenn man noch von keinem griechischen Mann gehört hat, der sich darum gerissen hätte, Möglichkeiten seiner Befruchtung und Gebärfähigkeit zu erforschen.
Die Frauenfeindlichkeit breitete sich in Griechenland im 8. Jahrhundert v. Chr. genau zu der Zeit aus, als der Einfluss der Familiendynastien nachließ und die Macht auf den Staatskörper des Stadtstaates überging. Die Historikerin Susan Blundell schreibt:
Wo die politische Macht im Herrscherhaus wurzelte, waren die Grenzen zwischen familiären und politischen, zwischen privaten und öffentlichen Dingen nicht annähernd so scharf gezogen. Die Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen war fließend, und so kam es, dass eine Frau – in Abwesenheit ihres Mannes – politische Macht ausüben konnte.13
Bündnisse zwischen Adelsfamilien waren von großer Bedeutung, und die Frauen spielten beim Knüpfen solcher Bande eine entscheidende Rolle. Das spiegelt sich im Werk Homers, eines der begnadeteren Zeitgenossen Hesiods. In der Ilias, der Geschichte von der Belagerung Trojas, hat Menelaos von Sparta seiner Gattin Helena die Königswürde zu verdanken. Für ihn ist es nicht nur ihrer unvergleichlichen Schönheit wegen lebenswichtig, Helena wiederzubekommen, nachdem sie sich mit Paris nach Troja davongemacht hat, sondern vor allem deshalb, weil sein Thron davon abhängt.
In der Ilias und in der Odyssee greift Homer auf Geschichten aus der älteren dynastischen Zeit zurück. In diesem ursprünglichen Stoff sind Frauen im Allgemeinen positiv porträtiert: Sie sind komplexe, starke Charaktere und gehören zum Einprägsamsten, was die Literatur zu bieten hat. Das Ende dieser Periode ging einher mit dem Übergang von der Hirtenkultur zu einer arbeitsintensiveren Ackerbauwirtschaft, in der die Sicherung von Besitz ein wichtiges Anliegen war. Aber wie jede andere Form eines tiefsitzenden Hasses kann man die Frauenverachtung, die aus Hesiods Werken und überhaupt aus den noch existierenden Schriften des 8. Jahrhunderts spricht, nicht allein auf die Veränderungen der politischen und gesellschaftlichen Strukturen zurückführen. Sie schufen lediglich den Rahmen, der es Männern leicht machte, sich als Frauenhasser zu profilieren.14 Die Frau, gegen die sich dieser Hass am vehementesten Bahn brechen konnte, war eine Erfindung des 8. Jahrhunderts: Helena von Troja, Playmate der griechischen Misogynie, das Gesicht, »das tausend Schiffe trieb, [das] Trojas Feste hat in Brand gesteckt«15.
Helenas Mutter Leda war eines von Zeus’ Vergewaltigungsopfern, sie wurde von ihm in Gestalt eines Schwans heimgesucht. Aber in ihrer bemerkenswerten Rolle als vielschichtige Ikone, die sowohl Lust als auch Abscheu erregt, ist Helena in Wahrheit eher eine Tochter der Pandora. Wie bei dieser ist ihre Schönheit eine Falle. Sie weckt ein ungeheures Verlangen in den Männern. Aber wer dem Verlangen nachgibt, öffnet die Schleusen der blutigen Zerstörung. In der Ilias schmäht Helena sich selbst als »schnödes, unheilstiftendes und schändliches Weib« und wiederholt damit die Charakterisierung der Pandora.16 Auf der Höhe der griechischen Klassik wird der Selbsthass zu einem Wesenszug der Frauenfiguren in manchen der großen Dramen, und Helena wird zum zentralen Objekt der Misogynie. Sie ist die Schlächterin und der Fluch der Männer, Hure und Vampir, Zerstörerin von Städten, vergifteter Kelch und Männerfresserin – so ziemlich jedes frauenfeindliche Klischee wird ihr übergestülpt. In Euripides’ Die Troerinnen warnt Hekabe, die Witwe des Priamos, den siegreichen spartanischen König Menelaos:
O töte sie, ich preise dich darum!
Schau sie nicht an, sie weckt die alte Glut!
Sie fängt die Männer, sie zerstört die Stadt,
Verbrennt die Häuser mit dem Zauberblick,
Wir alle kennen ihn zu unserm Leid.17
Hekabes mahnende Worte sind vergebens. Menelaos braucht Helena so sehr und so groß ist sein Verlangen nach ihr, dass er es nicht über sich bringt, sie zu bestrafen. Er nimmt sie mit nach Sparta zurück, wo sie ihr Eheleben fröhlich wieder aufnehmen, während den anderen Frauen nichts bleibt als ein Leben in Sklaverei und Wehklagen um ihre verlorenen Ehemänner, Väter und Söhne.
Die Geschichte der Helena ist wie die der Pandora eine Allegorie, in der körperliches Begehren und Tod untrennbar miteinander verbunden sind. Mit dem Verlust ihrer Jungfräulichkeit – dem Öffnen des Fasses – bringt Pandora den Tod in die Welt, so wie Paris’ Verlangen nach Helena den Krieg mit allen seinen Schrecken entfesselt. Allegorien dieser Art sind Ausdruck dessen, was Sigmund Freud als den ewigen Kampf zwischen Eros und dem Destruktions- oder Todestrieb – Thanatos – beschreibt.18 In einer frauenverachtenden Kultur lernen Frauen, schwere Schuldgefühle zu empfinden, weil ihre Schönheit Begierde weckt und so den Kreislauf von Leben und Tod initiiert.
Dieser komplizierte Tanz von Eros und Thanatos spielt auch in anderen Kulturen und Mythologien eine Rolle, hier aber vor allem als unausweichlicher Teil des Lebens. Mit den Göttinnen der keltischen Mythologie wird das Prinzip des Lebens wie des Todes assoziiert. Diese Doppelrolle wird jedoch nicht dualistisch, also als zwei ständig miteinander im Kampf liegende Prinzipien, interpretiert. Die Kelten sehen ihre Göttinnen als diejenigen, die unbefangen die Kräfte des Lebens und des Todes miteinander versöhnen, so wie es jede Mutter in Wirklichkeit tut: Indem sie Leben in die Welt setzt, bringt sie auch den Tod. Im Verständnis der Kelten ist diese Versöhnung von Leben und Tod kein Grund für Schuldzuweisungen und Vorwürfe, sondern sie liegt einfach in der Natur der Dinge. Aber in der dualistischen Weltsicht der Griechen verkörpert die Natur die Schwächen und Grenzen des Menschen, und die Frau verkörpert die Natur. Das macht sie für den Mann zur verhassten, Fleisch gewordenen Mahnung, die ihn permanent an seine Schwächen erinnert. Das ist die Sünde der Pandora und ihrer Töchter, für die das Patriarchat, von seinen Märchen bis zu seinen philosophischen Lehren, alle Frauen bestrafen will.
»Ein durchgängiges Prinzip der Mythologie lautet: In dem, was bei den Göttern dort oben geschieht, spiegeln sich immer Ereignisse auf der Erde«19, schreibt der britische Dichter Robert Graves. Beziehungs- und Verhaltensmuster, die ihre Legitimation in der Mythologie finden, schlagen sich in der Regel im Gesetzeswerk und in gesellschaftlichen Konventionen nieder. Im 6. Jahrhundert v. Chr. offenbarte sich dies in den neu entstandenen Demokratien und Stadtstaaten wie beispielsweise Athen, wo sehr schnell ein restriktiver Verhaltenskodex für Frauen entwickelt wurde.
Einem modern denkenden Menschen mag die Vorstellung, dass der gesellschaftliche Status der Frauen mit dem Aufkommen der Demokratie niedriger wurde, als eklatanter Widerspruch erscheinen. Aber Gleichberechtigung und allgemeines Wahlrecht waren nicht das ideologische Fundament, auf der die griechische und die römische Demokratie errichtet wurden. Beides waren Sklavenhaltergesellschaften, in denen demokratische Rechte nur für die erwachsenen männlichen Bürger galten. In einer Sklavenhaltergesellschaft hätte die Prämisse, dass alle Menschen gleich geboren werden, in einem offensichtlichen Widerspruch zu einer ebenso eigennützigen wie allgemeingültigen Wirklichkeit gestanden. Sklaverei war das »natürliche« Produkt systemimmanenter Ungleichheiten. In einer Gesellschaft, in der bereits eine Form der Ungleichheit institutionalisiert ist, hat es eine andere nicht schwer, sich durchzusetzen.
Gesetze, die vorschrieben, wie Frauen sich zu verhalten hatten und welche Möglichkeiten der Entfaltung sie genossen, belegen aufs anschaulichste und drastischste, wie Hesiods Allegorie der Frauenfeindlichkeit zu einem gesellschaftlichen Faktum wurde. Rechtlich gesehen standen Frauen in Athen auf der Stufe eines Kindes und blieben ihr Leben lang unter der Vormundschaft eines Mannes. Eine Frau durfte das Haus nur in Begleitung eines Aufpassers verlassen. Sie wurde selten mit ihrem Mann zu Tisch geladen und wohnte in einem abgetrennten Bereich des Hauses. Offizielle Bildungswege blieben ihr verschlossen. »Ein Weib soll sich nicht im Denken üben. Denn das wäre arg«, wusste der Philosoph Demokrit dazu zu sagen. Frauen wurden verheiratet, wenn sie die Pubertät erreichten, nicht selten mit einem Mann, der doppelt so alt war wie sie selbst. Der Altersunterschied und das geringere Maß an Lebenserfahrung und Bildung stärkten die Vorstellung von der naturgegebenen Minderwertigkeit der Frau. Den Ehemännern zur Warnung legt Menander einer Figur in einem seiner Lustspiele die Worte in den Mund: »Wer seine Frau das Schreiben lehrt, ist schlecht beraten: Er gibt einer Schlange noch zusätzliches Gift.«20
Ehebruch des Mannes galt nicht als Scheidungsgrund. (Dieser Grundsatz hielt sich in England noch bis 1923, ein Beleg dafür, wie stark die britische Oberschicht vom Geist der griechischen Klassik durchdrungen war.) Wenn aber eine Frau Ehebruch beging oder vergewaltigt wurde, musste ihr Mann sie verstoßen, sonst wurden ihm seine Bürgerrechte aberkannt. So gesehen waren die Frauen in der ersten Demokratie der Welt schlimmer dran als im autokratisch regierten Babylon. Unter dem 1750 v. Chr. von König Hammurabi entworfenen Gesetzeswerk hatte ein Ehemann, dessen Frau des Ehebruchs überführt worden war, immerhin das Recht, diese zu begnadigen.
Einvernehmlicher Geschlechtsverkehr mit der Ehefrau eines anderen war in Griechenland ein schwereres Vergehen als die Vergewaltigung derselben. Im Prozess gegen einen Mann, der beschuldigt wird, den Liebhaber seiner Frau ermordet zu haben, liest der Anwalt der Verteidigung aus den Gesetzestexten des Solon aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. eine Passage vor, in der es um Vergewaltigung geht:
Daher also, hohes Gericht, war der Gesetzgeber der Meinung, dass der Vergewaltiger eine niedrigere Strafe verdiene als der Verführer: Für Letzteren hat er die Todesstrafe vorgesehen, für Ersteren nur eine Geldstrafe. Er ging davon aus, dass diejenigen, die Gewalt anwenden, von den Personen, gegen die sich diese Gewalt richtet, gehasst werden, während diejenigen, die ihr Ziel mit schmeichelnden Worten erreichen, sich so im Denken der Frauen einnisten, dass die Ehefrauen anderer Männer sich ihnen stärker verbunden fühlen als ihrem eigenen Gatten, so dass der ganze Haushalt in ihrer Gewalt ist und nicht mehr mit Sicherheit gesagt werden kann, ob der Vater der Kinder der Ehemann oder der Liebhaber ist.21
Der Ehemann verteidigte sich mit dem Argument, es sei sein gutes Recht gewesen, den Liebhaber seiner Frau zu töten, weil er die beiden in flagranti erwischt habe. Wurde eine Frau Opfer einer Vergewaltigung, so hatte sie mit der gleichen Strafe zu rechnen wie eine Ehebrecherin, durfte nicht mehr an öffentlichen Feiern teilnehmen und keinen Schmuck mehr tragen. Wie in fundamentalistischen muslimischen Kreisen unserer Zeit wurde dem Opfer die Schuld für die Vergewaltigung zugeschoben. Sie wurde mit gesellschaftlicher Ächtung bestraft, ein furchtbares Los in einem so eng gefügten Gemeinwesen wie dem Stadtstaat.22
Solon beschnitt die Freiheit der Frauen noch auf anderen Gebieten: Ihr öffentliches Auftreten bei Beerdigungen, wo ihnen eine Rolle als bezahlte Klageweiber zugestanden wurde, und an Feiertagen wurde gesetzlich geregelt, die Möglichkeit, privaten Reichtum zur Schau zu stellen, eingeschränkt. Sie durften Land weder kaufen noch verkaufen und mussten, wenn sie noch unverheiratet waren und keine Brüder hatten, beim Tod des Vaters dessen nächsten männlichen Verwandten ehelichen. Söhne, die aus dieser Ehe hervorgingen, erbten allen vorhandenen Landbesitz. Auf diese Weise wurden die Frauen zum »Vehikel, durch das der Besitz in der Familie gehalten werden konnte«23. Selbst nach der Eheschließung stand die Frau weiterhin unter dem Einfluss ihres Vaters, der das Recht für sich in Anspruch nehmen konnte, ihre Ehe zu annullieren und sie mit einem anderen Mann zu verheiraten, wenn ihm das vorteilhaft erschien. Einem anderen, ebenfalls Solon zugeschriebenen Gesetz zufolge durfte kein Bürger von Athen einen anderen freien Bürger versklaven (auf Personen, die nicht das Stadtbürgerrecht besaßen, traf das Gesetz nicht zu), mit einer Ausnahme: Ein Vater oder Haushaltsvorstand durfte die unverheiratete Tochter des Hauses in die Sklaverei verkaufen, wenn sie vor der Ehe ihre Unschuld verloren hatte.
Um die Unschuld der »braven« Mädchen vor Aufdringlichkeiten zu schützen, mussten »böse« Mädchen her, die die sexuellen Bedürfnisse der Männer befriedigten. Die Legalisierung staatlicher Bordelle, die mit Sklavinnen und Ausländerinnen besetzt wurden, waren die Folge. Während die braven Mädchen nur einer Kategorie (Ehefrau/Mutter) zuzuordnen waren, gab es bei den bösen Mädchen Abstufungen von der umsorgten Hetäre – der antiken Entsprechung der Kurtisane – bis zur einfachen Hure, die jeder gegen einen geringen Obolus auf dem Straßenstrich in der Nähe der Müllplätze, wo die Menschen ihre Notdurft verrichteten, aufgabeln konnte. Die Sexualität der Prostituierten war eine öffentliche Dienstleistung; sie hatte den Stellenwert einer Kanalisation, über die die körperlichen Begierden der Männer abgeleitet wurden.24
»Wir heiraten das Weib, um eheliche Kinder zu erhalten und im Hause eine treue Wächterin zu besitzen; wir halten Beischläferinnen zu unserer Bedienung und täglichen Pflege, die Hetären zum Genuss der Liebe«, soll Demosthenes, der bedeutendste Redner des antiken Athen, einmal gesagt haben. Diese Abgrenzung, die weibliche Tugend mit Asexualität gleichsetzt, wird bis heute dazu benutzt, Frauen zu entmenschlichen.
Angesichts der Vielzahl der Grenzen, die den Frauen gesetzt waren, verwundert es nicht, dass unter den Männern die Beschäftigung mit dem Thema Grenzüberschreitung durch Frauen fast obsessive Züge annahm. Symptomatisch für diese Obsession war die Faszination der Griechen für die Amazonen, dieses legendäre Volk von Frauen, das die männlichste aller Domänen, nämlich die organisierte Kriegsführung, für sich erobert hatte. Zum ersten Mal im 5. Jahrhundert bei Herodot (dem Vater der Geschichtsschreibung) erwähnt, tauchen die Amazonen in der griechischen Kunst und Literatur immer wieder auf, und das Thema hat sich bis heute gehalten. Der griechischen Überlieferung zufolge lebten die Amazonen an den Grenzen der Zivilisation und widmeten sich ausschließlich ihren kriegerischen Ambitionen. Männer ließen sie nur in ihre Nähe, wenn sie sich paaren wollten, von den Sprösslingen dieser Begegnungen zogen sie nur die weiblichen auf, die männlichen Kinder wurden ausgesetzt. Die Amazonenkultur ist das Spiegelbild des patriarchalen Athen. In der Amazone trifft die männliche Fantasie vom autarken Mann auf ihr alptraumhaftes Gegenteil, die autarke Frau.
Die Faszination der Männer für die kriegerische Amazone hat eine lange Geschichte; sie reicht von der Antike bis zur Comic-Heldin Wonder Woman und den Profi-Wrestlerinnen unserer Zeit. Was Amazonen und Wrestlerinnen verbindet, ist die Tatsache, dass ihr Kampf kein Kampf ist, sondern reine Fantasie. Die mit einer gewissen Lustangst einhergehende Faszination der Männer jedoch ist real und nahm bei den Athenern ein Ausmaß an, das an Besessenheit grenzte. Kämpfe zwischen Männern und Amazonen gehörten in der Antike zu den beliebtesten Frauenabbildungen überhaupt. Bis heute sind mehr als 800 entsprechende Kunstwerke erhalten, von denen bei weitem die meisten aus Athen stammen.25 Das Amazonenmotiv ziert so ziemlich alles vom Tempel bis zur Amphore und zum Trinkgefäß. Wohin sich ein Athener auch wenden mochte, unweigerlich fiel sein Blick auf eine Szene, in der ein Mann mit erhobenem Schwert oder Speer eine Frau an den Haaren vom Pferd zerrt, mit einem Dolch auf sie einsticht oder sie zu Tode knüppelt, wobei seine Speerspitze auf ihre entblößte Brust zeigt, während ihre kurze Tunika über die Schenkel hochgerutscht ist. Der heiligste Tempel von Athen, der Parthenon, wurde 437 v. Chr. zu Ehren von Athene, der Schutzgöttin der Stadt Athen, und zur Feier des Sieges der Griechen über die persischen Eindringlinge errichtet. Doch das Bild, das man als Schmuckwerk für Athenes Schild wählte, hatte keinerlei Bezug zu historischen Ereignissen. Es zeigt den sagenhaften Sieg des mythologischen Stadtgründers Theseus über ein einfallendes Amazonenheer. Die Beliebtheit solcher Szenen ist nicht nur damit zu erklären, dass sie das einzige Motiv boten, in dem Frauen nackt oder teilweise unbekleidet abgebildet werden konnten. (Ansonsten durfte den gesellschaftlichen Konventionen zufolge nur der männliche Körper entblößt dargestellt werden). Die Szene wiederholt sich mit pornografischer Hartnäckigkeit. Aber wie in der Pornografie kann die Wiederholung nicht über die drängenden Ängste hinwegtäuschen, die ihr zugrunde liegen.26
Die Ängste des Mannes vor der Frau, die ihr gesetzte Grenzen überschreitet, finden ihren nachhaltigsten und denkwürdigsten Ausdruck in den griechischen Dramen. Sämtliche erhaltenen Tragödien wurden innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne im 5. Jahrhundert von attischen Dichtern geschrieben. Es gibt nur ein einziges Stück aus dieser Zeit, nämlich Philoktetes von Sophokles, in dem keine Frau vorkommt. In den Titeln von mehr als der Hälfte aller Tragödien taucht der Name einer Frau oder eine andere weibliche Anspielung auf. Das Interesse der Dichter richtete sich auf Frauen und ihre ungeheuerlichen Taten.
Die Handlung der Tragödien basierte fast ausschließlich auf Homers großen Epen, ihre Charaktere waren seinen bronzezeitlichen Helden, Heldinnen und Schurken nachempfunden. Es war in etwa so, als wären heutige Dichter einer literarischen Konvention verpflichtet, die sie zwingt, Stoff und Personal all ihrer Romane auf der Artussage aufzubauen. Daher wurde immer wieder die Frage gestellt, wie viel wir aus diesen Dramen tatsächlich über das Leben und die Probleme real existierender Frauen jener Zeit erfahren können. Die Frage ist jedoch nicht, wie wirklichkeitsgetreu sie das Leben der damaligen Frauen wiedergeben, sondern ob das, was sie uns über die gesellschaftlichen Ängste in Bezug auf das Verhältnis zwischen Männern und Frauen verraten, ein realistisches Bild der Situation vermittelt. Und dass sie das tun, steht außer Zweifel.27
In Medea von Euripides ermordet die gleichnamige Heldin ihre Kinder, um sich an ihrem Mann, dem mythologischen Helden Jason, zu rächen, als dieser sie verlässt und eine andere Frau heiraten will. In Agamemnon von Aischylos nimmt sich Klytaimnestra einen Geliebten, als ihr Mann gen Troja in den Krieg zieht; nach seiner Heimkehr ermordet sie ihn und reißt die Staatsmacht an sich. In Sophokles’ Elektra überredet Agamemnons Tochter ihren sich sträubenden Bruder Orest, aus Rache für den Mord an ihrem Vater nunmehr ihre Mutter Klytaimnestra zu töten. Antigone erzählt die Geschichte einer Frau, die entgegen dem Verbot ihres Onkels Kreon ihren Bruder bestattet und dafür zum Tod durch Einmauern verurteilt wird. In Euripides’ Tragödie Die Bakchen wird berichtet, wie die Anhängerinnen des orgiastischen Weingottes Dionysos in Amazonen verwandelt werden. Sie ziehen plündernd durch die Lande, zerstören alles, was ihnen in den Weg kommt, besiegen einen Trupp Soldaten im Kampf und zerreißen König Pentheus bei lebendigem Leib, als er sie heimlich bei einer ihrer angeblichen Orgien beobachten will.
In allen diesen Geschichten nimmt die Tragödie ihren Lauf, wenn sich Frauen gegen das patriarchalische System auflehnen und zeitweise die Fesseln sprengen, die dieses System ihnen auferlegt hat. Indem sie dies tun, berufen sie sich auf das Recht, das die »Natur« fordert. Nicht selten geschieht die Auflehnung im Namen der Familie, deren Belange über die Ansprüche des Staates gestellt werden. »So geh hinunter, wenn du lieben willst, und liebe dort! Mir herrscht kein Weib im Leben«28, ereifert sich Kreon, als Antigone verkündet, dass sie sich aus Liebe zu ihrem Bruder verpflichtet fühlt, diesen gegen das königliche Gesetz anständig zu begraben.
Sich auflehnend überschreiten die tragischen Heldinnen die Grenze zu einem gesellschaftlich nicht annehmbaren weiblichen Verhalten und nehmen dadurch maskuline, fast amazonenhafte Züge an. Als Antigone gegen das königliche Gesetz rebelliert, wird sie von ihrer Schwester Ismene ermahnt: »Dies auch denke, Weiber sind wir und dürfen so nicht gegen Männer streiten.«29
Die Botschaft ist ambivalent, wenn nicht gar widersprüchlich. Einerseits zeigt der Dichter Verständnis für die Frauen, die durch Leid und Unterdrückung zur Auflehnung getrieben wurden, andererseits unterstreicht er in der daraus resultierenden Gewalt und Barbarei das Bild von den Frauen als Naturereignis, als wilde und irrationale Geschöpfe, die eine Bedrohung der von Männern geordneten Welt sind. Am vehementesten wird dies in einem Werk zum Ausdruck gebracht, das geradezu beispielhaft ist für die Frauenfeindlichkeit damaliger Literatur, nämlich in Hippolytos von Euripides:
Fluch euch! Ich werde nimmer satt, die Weiber
Zu schmähn, ob man auch spöttelt, dass ich’s tu.
Denn immer sind von Grund aus schlecht auch sie.
Und wer sie nicht zur Keuschheit kann erziehn,
Gestatte mir, auch künftig sie zu schmähn.30
Auch wenn die Ungerechtigkeiten, unter denen die Frauen zu leiden haben, erkannt werden, bleibt doch die Notwendigkeit bestehen, die patriarchale Ordnung zu verteidigen, in deren Rahmen sie geschehen.
Die Sicht der Frau als »das Andere«, als Antithese des Mannes, spricht deutlich aus den griechischen Dramen. Dafür, dass sich dieser Dualismus der Geschlechter in der abendländischen Kultur so nachhaltig eingebürgert hat, tragen nicht zuletzt Platon und Aristoteles die Verantwortung, die ihn philosophisch und wissenschaftlich untermauert haben.
Platon (429–347 v. Chr.) wird von vielen als der bedeutendste und einflussreichste Philosoph aller Zeiten – von der Antike über das Mittelalter bis zur Neuzeit – angesehen. Seine Ideen über das Wesen der Welt haben sich überall dort, wo die abendländische Kultur und ihr kämpferischster Eroberungstrupp, das Christentum, Fuß fassen konnten, ausgebreitet und die intellektuelle und geistige Entwicklung in Erdteilen und Ländern beeinflusst, die zu Platons Zeit noch gar nicht entdeckt oder erforscht waren. Aber Platons Beitrag zur Geschichte der Misogynie birgt auch Widersprüche.
So wird Platon gelegentlich als erster Feminist gepriesen, weil er in seinem Hauptwerk, Politeia, die Utopie eines Staates entworfen hat, in dem die Frauen die gleiche Ausbildung und Erziehung genießen wie die Männer. Gleichzeitig markiert seine dualistische Sicht der Welt jedoch die Abkehr vom einfachen, veränderlichen Dasein, das seiner Argumentation nach eine Wunschvorstellung ist und vom klugen Mann mit Verachtung behandelt werden sollte. Zu diesem Dasein zählte er auch Ehe und Fortpflanzung, niedere Bereiche des Lebens, die er mit den Frauen assoziierte. Er selbst war nie verheiratet und stellte die »reine« Liebe zwischen Männern über die Liebe zwischen Mann und Frau, die er näher zur animalischen Lust rückte. Platon hat diese Form des Dualismus – der dem Mann geistige Ziele und der Frau die fleischliche Lust zuordnet – nicht erfunden, aber er hat ihm eine philosophische Schlagkraft verliehen, die ihresgleichen sucht.31
Ein Philosoph entwickelt seine Gedanken nicht im luftleeren Raum; so abstrakt oder absurd sie auch sein mögen, es findet sich immer etwas in der konkreten Wirklichkeit, das eine Erklärung dafür liefert. »Platon war das Kind einer Zeit, die noch die unsere ist«32, schreibt Karl Raimund Popper in seiner Kritik an Platons Staatstheorie. Die Suche nach einer höheren, vollkommeneren Welt jenseits des sinnlich Wahrnehmbaren fand vor einem geschichtlichen Hintergrund statt, der von Hungersnöten, Pestepidemien, Unterdrückung, Zensur und blutigen Bürgerkriegen gekennzeichnet war. Die Ereignisse, die Griechenland erschütterten, als Platon ein junger Mann war, prägten sein Denken. Er wuchs als Sohn einer wohlhabenden Athener Familie in der Zeit des Peloponnesischen Krieges zwischen Athen und Sparta auf, der, von wenigen Waffenstillständen unterbrochen, von 431 v. Chr. bis 404 v. Chr. dauerte. Selten hat sich ein Krieg so nachhaltig auf den Verlauf der Geschichte ausgewirkt wie dieser. Die Folgen des Peloponnesischen Krieges für Griechenland kann man mit den Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf Europa vergleichen. Er beendete das goldene Zeitalter des klassischen Griechenland und damit eine der künstlerisch und intellektuell fruchtbarsten Perioden, die die menschliche Zivilisation je erlebt hat. Die Destabilisierung des politischen Gleichgewichts in Griechenland bereitete den Weg für die Eroberungsfeldzüge mazedonischer und später römischer Truppen. Unter der Herrschaft der Dreißig, der pro-spartanischen Oligarchie in Athen, wurde Platons verehrter Lehrer Sokrates nach einer Anklage wegen Gottlosigkeit zum Tod durch Trinken des Schierlingsbechers verurteilt. Der Peloponnesische Krieg – und das allein schon machte ihn zu einem Wendepunkt in der Geschichte – veränderte Platons Sicht der Welt grundlegend. Er war jetzt von einem tiefen Misstrauen, ja Hass gegen die Demokratie erfüllt.
Platons erste Utopie war ein totalitärer, von einer Elite regierter und von »Wächtern« nach außen verteidigter Staat, dessen wirtschaftliche Grundlage von einer Unterschicht von Gewerbetreibenden und Bauern gewährleistet werden sollte. In der rigiden Welt dieses Staates sind frivole Lustbarkeiten wie Liebesdichtung und Tanz verboten, den Wächtern sind jeder materielle Besitz und jede Form von Eitelkeit verwehrt. Platon, der den Körper als etwas grundsätzlich Schlechtes betrachtete, machte aus seiner Verachtung für die sinnlich erfahrbare Welt keinen Hehl. In Symposion bezeichnet er individuelle Schönheit als »Nebensächlichkeit« und spricht von der Sterblichkeit als einer »Seuche«. »Wem sie [die Begierden] also nach Kenntnissen und allem dergleichen hinströmen«, erklärt er im sechsten Buch von Politeia, »dem gehen sie, denke ich, auf die Lust, welche der Seele für sich allein zukommt, und halten sich dagegen von der durch den Leib vermittelten zurück, wenn einer nicht zum Schein, sondern wahrhaft philosophisch ist.«33 Nichts ist erlaubt, was die Elite davon abhalten könnte, über das absolute Schöne und das absolute Gute nachzudenken – das absolut todsichere Rezept für absolute Langeweile.
Platon hat alle seine Werke in der Form von Dialogen zwischen Sokrates und seinen Schülern verfasst. In Politeia spricht er sich dafür aus, ausgewählte Frauen in die Klasse der Wächter aufzunehmen und Ihnen die gleichen Pflichten aufzuerlegen wie den Männern, und er begründet dies mit seiner Theorie, der einzige Unterschied zwischen den Geschlechtern liege in den biologischen Rollenverteilungen und physischen Kräften. Männliche und weibliche Wächter sollen gemeinsam ausgebildet werden und lernen, und sie dürfen »weder Häuser zu eigen haben noch Land noch sonst ein Besitztum«34. Gegenseitige Anziehung zwischen den Geschlechtern sei zwar unvermeidlich, so meint er, aber »ohne Ordnung sich zu vermischen oder irgend sonst etwas auf diese Art zu tun, kann wohl weder für fromm geachtet sein in einer Stadt von Seligen noch werden es die Oberen zulassen«35. Um eine echte Elite heranzuziehen, müssen sich die Besten mit den Besten zusammentun und Nachkommen hervorbringen. Die Produkte dieser Paarungen werden gleich nach der Geburt von ihren Müttern getrennt, in einer staatlichen Institution aufgezogen und von Ammen genährt. So bleibt den Müttern das zeitaufwändige und kräftezehrende Geschäft des Stillens erspart. Und da Privatbesitz abgeschafft und daher nichts zu vererben ist, sind »so auch die Kinder gemein, so dass weder ein Vater sein Kind kenne, noch auch ein Kind seinen Vater«36.
Bei Platon geht die Gleichberechtigung der Frauen auf Kosten ihrer geschlechtlichen Identität. Sie sind sozusagen zu Männern ehrenhalber geworden. Der einzige biologische Unterschied, der ihnen zugestanden wird, ist die Vermehrung. (Ein paar Jahrtausende später wird in radikalfeministischen Kreisen die gleiche These aufgestellt werden – dass nämlich Männer und Frauen sich nur in ihren Geschlechtsteilen unterscheiden und alles andere anerzogen sei.) Die weiblichen Wächter dürfen Kinder gebären, aber keine Bindung zu ihnen entwickeln. Die »Mutterrolle« übernimmt der Staat. Kontrolle über die Sexualität ist der Schlüssel zur Herrschaft des Staates über seine Bürger. Sie wird zu einem politischen Instrument. Indem sie alle familiären Bindungen, insbesondere die zwischen Mutter und Kind, negiert, richtet sich Platons Utopie gegen den Gedanken der Individualität an sich. Und das hat sie mit allen totalitären Ideologien gemein, in denen der Individualismus ausgelöscht wird, damit sichergestellt ist, dass die Bedürfnisse des Staates uneingeschränkte Priorität genießen.
Die Verteufelung weltlicher Vergnügen gehört zu den Aspekten in Platons Utopie, die man in totalitären Staaten des 20. Jahrhunderts wiederentdecken kann. Wenn Platon Sex als Mittel zu dem alleinigen Zweck propagiert, eine »Elite zu züchten«, nimmt er die nationalsozialistische Vision einer Herrenrasse vorweg. Die Geschlechtslosigkeit der weiblichen Wächter findet ihr Echo im kommunistischen China, wo Männer und Frauen in ihren Mao-Anzügen nicht mehr zu unterscheiden waren. In Afghanistan verboten die Taliban in ihrem fanatischen Eifer, einen islamischen Gottesstaat zu errichten, nahezu jede Form von Dichtung und Musik, und es galt sogar als subversiv, einen Frisörsalon zu eröffnen. In allen totalitären Staaten seit Platon war der Gebrauch von Make-up für Frauen verpönt.
Für Platon kann »das Andere« in verschiedener Form auftreten. Es kann beispielsweise auch nach Volkszugehörigkeiten definiert werden. Sokrates bezeichnet die Barbaren als die »natürlichen Feinde« der Griechen, so wie Frauen die »natürlichen Feinde« der Männer sind. Die Spaltung der Welt in widerstreitende Prinzipien macht es uns leicht, exklusive Kategorien zur Zuordnung von Menschen zu schaffen. Es ist kein Zufall, dass Misogynie und Rassismus oft im gleichen gesellschaftlichen Umfeld gedeihen.
Platons Dualismus findet seinen entschiedensten philosophischen Ausdruck in der Theorie der Formen, die den Wächtern als zentrale Weisheit und Kernpunkt ihrer Ausbildung vermittelt werden soll. Wer sie nicht begreift, kann die wahre nicht von der falschen Wirklichkeit unterscheiden. Und die wahre Wirklichkeit ist in Platons Augen nur mit dem Verstand fassbar.
Zur Theorie der Formen heißt es in Politeia:
Vieles Schöne und vieles Gute, was einzeln so sei, nehmen wir doch an und bestimmen es uns durch Erklärung. Dann aber auch wieder das Schöne selbst und das Gute selbst und so auch alles, was wir vorher als vieles setzten, setzen wir als eine Idee eines jeden und nennen es jegliches, was es ist. Und von jenem vielen sagen wir, dass es gesehen werde aber nicht gedacht; von den Ideen hingegen, dass sie gedacht werden aber nicht gesehen.37
Diese »Idee eines jeden« setzt Platon mit Gott gleich, der zeitlos ist in seiner Vollkommenheit. In einem Gespräch über das Wesen Gottes definiert er Gott als höchste Verwirklichung der Vollkommenheit und äußert sich abfällig über das homerische Pantheon, in dem die Götter sich, Zauberern gleich, ständig verwandeln. »Also ist es auch für Gott unmöglich, dass er sich selbst sollte verwandeln wollen; sondern jeder von ihnen bleibt, wie es scheint, das er so schön und trefflich ist wie möglich auch immer ganz einfach in seiner eigenen Gestalt«38.
Platons Theorie der Formen untermauert den Mythos der Pandora und ihres verderblichen Einflusses auf die heile Welt der Männer mit einem tragfähigen philosophischen Fundament, und sie liefert den gedanklichen Nährboden für das christliche Dogma der Erbsünde, dem zufolge der Mensch durch den bloßen Akt der Empfängnis von der Vollkommenheit Gottes abfällt und in den Abgrund der Äußerlichkeiten, des Leidens und der Sterblichkeit gestoßen wird. Mit dem Sündenfall geht der von der Frau verführte Mann zwangsläufig auch des vollkommen Guten verlustig. Diese dualistische Sicht der Wirklichkeit diskriminiert die Welt der Sinne und stellt sie in einen ewigen Widerstreit mit der höchsten Erkenntnis: der Erkenntnis Gottes. Sie hat das Bild christlicher Denker nachhaltig geprägt, für die Frauen im wörtlichen wie im übertragenen Sinne das verkörpern, was unbeständig, veränderlich und verachtenswert ist.
Schuf Platon mit seiner Theorie der Formen die philosophische Grundlage für den Frauenhass, so lieferte sein Schüler Aristoteles (384–322 v. Chr.) die wissenschaftliche Rechtfertigung dafür. Auch wenn uns viele der wissenschaftlichen Theorien des Aristoteles heute lächerlich erscheinen, dürfen wir nicht vergessen, dass sie die abendländische Sicht der Welt fast zwei Jahrtausende lang geprägt haben. Erst die wissenschaftliche Revolution im 17. Jahrhundert setzte dem Einfluss seiner Ideen ein Ende. »Vom frühen 17. Jahrhundert an ging nahezu jeder ernstzunehmenden intellektuellen Errungenschaft der Angriff gegen einen aristotelischen Lehrsatz voraus«39, schreibt Bertrand Russell.
Aristoteles ist als einer der erbittertsten Frauenhasser aller Zeiten in die Geschichte eingegangen. Seine Sicht auf Frauen begründet er sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Auch wenn er vielleicht ein genauer Beobachter der Natur war – Charles Darwin äußerte sich beeindruckt über seine Beschreibung verschiedener Tierarten –, versagte seine Beobachtungsgabe beim Blick auf die Frauen offensichtlich. Als Zeichen ihrer Minderwertigkeit führte er unter anderem ins Feld, dass sie keine Glatze bekommen, was er als eindeutigen Beweis für ihr kindliches Wesen deutete. Er behauptete außerdem, Frauen hätten weniger Zähne als Männer, was Bertrand Russell zu der Bemerkung veranlasst haben soll: »Dieser Fehler wäre Aristoteles nicht unterlaufen, wenn er seiner Frau ab und zu erlaubt hätte, den Mund aufzumachen.«40
Aristoteles hat den Zweck als fundamentale Größe der Naturwissenschaften eingeführt. Seiner These zufolge ist es der Zweck der Dinge, einschließlich aller lebendigen Dinge, das zu werden, was sie sind. Aristoteles, der noch nichts von Genetik und Evolution wusste, sah den Zweck als Verwirklichung des Potenzials eines jeden Dinges, es selbst zu sein. In gewissem Sinne ist dies die materialistische Variante von Platons Theorie der Formen: Es gibt den einen idealen Fisch, und alle tatsächlich existierenden Fische sind Verwirklichungen dieses einen. Das Ideal ist ihr Zweck.
Auf Menschen, insbesondere auf Frauen übertragen, hat ein solches Konzept unangenehme, aber vorhersagbare Folgen; es wird nicht als Erklärung der Ungleichheit, sondern als deren Rechtfertigung herangezogen. Über die Entstehung der Tiere von Aristoteles ist eines der übelsten Beispiele hierfür. In diesem Werk erklärt der Autor den nach seiner Ansicht unterschiedlichen Zweck von Mann und Frau: »Das Männliche ist dem Weiblichen von Natur aus überlegen; das eine herrscht, das andere wird beherrscht; dieses Prinzip gilt zwangsläufig auch für das gesamte Menschengeschlecht.«41 Daher muss Aristoteles zufolge der männliche Samen Träger der Seele oder des Geistes sein und alle Anlagen des fertigen Menschen in sich vereinen. Die Frau, die den männlichen Samen empfängt, liefert lediglich den Stoff, die nährende Substanz. Das Männliche ist das aktive Prinzip, das Bewegende, die Frau ist das passive Prinzip, das Bewegte. Das Kind kann seine Anlagen nur dann vollständig entwickeln, wenn es männlich ist; herrscht durch einen übermäßig starken Menstruationsfluss im Leib die »kalte Konstitution« des Weiblichen vor, so erreicht das Kind nicht sein volles menschliches Potenzial, es wird, mit anderen Worten, ein Mädchen. Aristoteles’ abenteuerliche Ausführungen gipfeln in der Behauptung, die Frau sei nichts weiter als ein misslungener, verstümmelter Mann.
Vieles von dem, was Aristoteles über das Wesen der Frauen sagt, steht im Zusammenhang mit seinen Theorien zum Sklaventum. Sklaven sind, so meint er, von der Natur dazu bestimmt, das zu sein, was sie sind – genau wie die Frauen. Nur fehle es ihnen an der Urteilskraft, die den Frauen immerhin gegeben, wenn auch mit keinerlei Befugnissen verbunden sei. Für Aristoteles ist Gehorsam die natürliche Haltung der Frau, sie erfüllt damit den Zweck ihres Daseins. Und schließlich war Sklaven und Frauen noch eines gemein: Die Minderwertigkeit gegenüber dem Herrn – dem Sklavenhalter im einen, dem Ehemann im anderen Fall – war ewig und unveränderlich.
Die Verunglimpfung der Frauen als verstümmelte Männer brachte Gepflogenheiten mit sich, die in den Nächten, wenn das Schreien von Neugeborenen die Stille zerriss, nicht zu überhören waren. »Wenn du mit einem Sohn schwanger gehen solltest, wenn das Kind ein Knabe ist, lass es sein, ist es aber ein Mädchen, wirf es fort«, heißt es in einem Brief, den ein Mann namens Hilarion im Jahr eins v. Chr. an seine Frau Alis schrieb. Der Brauch, ungewollte Neugeborene auf Müllplätzen auszusetzen, hielt sich, bis sich das Christentum im Römischen Reich als wichtigste Religion durchsetzte.42 Die Mehrzahl der ausgesetzten Säuglinge waren missgebildete oder kranke Kinder oder eben »verstümmelte Knaben«, also Mädchen. Der Brauch war so verbreitet, dass sich die braven Bürger vom Schreien der ausgesetzten Kleinen vermutlich nicht in ihrer Nachtruhe stören ließen. Archäologen machten bei Grabungen die verblüffende Entdeckung, dass in den Grabstätten Athens aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. doppelt so viele Männer bestattet waren wie Frauen. Im Jahr 180 n. Chr. klagte der römische Geschichtsschreiber Cassius Dio darüber, dass es für die hochgestellten Männer des Reiches keine Frauen mehr zum Heiraten gebe. Frauen, schrieb ein anderer Gelehrter, werden »selektiv beseitigt«. In Verbindung mit einer hohen Sterblichkeit der Frauen im Kindbett oder bei Abtreibungen war daher gesichert, dass die männliche Bevölkerung zahlenmäßig bei weitem stärker war als die weibliche.43 Aber nicht alle ungewollten Töchter starben. Da jeder ausgesetzte Säugling automatisch Sklavenstatus hatte, sahen sich Bordellbesitzer regelmäßig auf den Müllplätzen um und nahmen die Mädchen mit, aus denen später Prostituierte wurden. Wir werden nie erfahren, wie viele Millionen Töchter der Pandora auf den Müllplätzen des griechischen und des römischen Reichs verhungerten und erfroren oder, wenn sie mehr »Glück« hatten, ein Dasein als Prostituierte erwartete.
Mit einem zahlenmäßigen Ungleichgewicht zugunsten der männlichen Bevölkerung ist oft ein niedrigerer gesellschaftlicher Status der Frauen verbunden. Heute finden wir eine solche Situation in Teilen Indiens und Chinas, wo die selektive Abtreibung weiblicher Feten dazu geführt hat, dass es weniger Frauen als Männer gibt, und Frauen einen entsprechend niedrigen Status genießen. Als »knappe Ware« werden sie auf ihre Rolle als Ehefrau und Mutter beschränkt.
Wenn Frauen dagegen den Männern zahlenmäßig überlegen sind, steigt ihr gesellschaftliches Ansehen.44 Dieses Phänomen ist in Sparta belegt, der Stadt, die siegreich aus dem Peloponnesischen Krieg hervorgegangen war und Platon als Vorbild für seinen Idealstaat diente. Sparta wich von der Normalität ab: Hier war Säuglingsmord zwar durchaus gebräuchlich, aber es wurde nicht zwischen Jungen und Mädchen unterschieden, sondern nur zwischen kranken und gesunden Kindern. Alle gesunden Nachkömmlinge wurden aufgezogen, und da Jungen bei der Geburt oft schwächlicher und anfälliger sind als Mädchen, wurden mehr männliche als weibliche Säuglinge ausgesetzt. Die Kriege, in die Sparta ständig verwickelt war, taten ihr Übriges, um die Sterblichkeitsrate unter den Männern drastisch hochzutreiben. Zudem heirateten spartanische Frauen relativ spät für die damalige Zeit. Dadurch standen ihre Chancen, eine Schwangerschaft zu überleben, um einiges besser. Weil von spartanischen Frauen erwartet wurde, dass sie als Mütter der künftigen Krieger in bester körperlicher Verfassung waren, sorgte sich der Staat um ihre Gesundheit. Sie trainierten – sehr zum Entsetzen, wahrscheinlich aber auch zum heimlichen Ergötzen des übrigen Griechenland – nackt wie die Männer, nahmen an sportlichen Wettkämpfen teil und waren im Allgemeinen kräftiger und gesünder als ihre Geschlechtsgenossinnen anderswo. Die Athenerin Lysistrata sagt in Aristophanes’ gleichnamiger Komödie zu einer Frau aus Sparta:
Wie hübsch du bist. Und wie gesund ihr seid,
Und Muskeln! – Du könnt’st einen Stier erwürgen!45
Darüber hinaus bestand ihre nicht eben züchtige Alltagskleidung aus einer kurzen, freizügigen Tunika, was Aristoteles und andere griechische Moralapostel mit Entrüstung zur Kenntnis nahmen. Eine spartanische Frau konnte den Besitz ihres Mannes erben und verwalten, was dazu führte, dass sich im 4. Jahrhundert v. Chr. zwei Drittel des Grundbesitzes in Sparta in Frauenhand befand. Das Ergebnis dieser Gesellschaftsordnung war – auf den ersten Blick ein Paradox – ein Militärstaat, in dem Frauen einen höheren Stand innehatten als in Athen, dem Mutterland der Demokratie.
Sparta verschwand von der Bühne der Geschichte, und die Rechte der spartanischen Frauen fanden nur noch als widernatürliche Kuriosität Erwähnung. Platon und Aristoteles dagegen lebten fort als die beiden Säulen des philosophischen und wissenschaftlichen Denkens in der westlichen Welt, auf denen das wuchtige Gebäude des Christentums ruhte. Platons Theorie der Formen mit der ihr immanenten Verachtung für die sinnlich erfahrbare Welt und Aristoteles’ biologischer Dualismus, der Frauen als misslungene Männer betrachtet, lieferten das intellektuelle Rüstzeug für die vielen Jahrhunderte der Frauenfeindlichkeit, die folgen sollten.
5 Siehe Statistiken in: Steven Pinker, Das unbeschriebene Blatt. Die moderne Leugnung der menschlichen Natur, deutsch von Hainer Kober, Berlin, Berlin Verlag 2003, S. 18
6 Hesiod, Werke und Tage, übersetzt und herausgegeben von Otto Schönberger, Stuttgart, Philipp Reclam jun. 1996, S. 11
7 Ebd., S. 9
8 Hesiod, Theogonie, übersetzt und herausgegeben von Otto Schönberger, Stuttgart, Philipp Reclam jun. 1999, S. 49
9 Robert E. Meagher, Helen: Myth, Legend, and the Culture of Misogyny, London, New York, Continuum 1995
10 Hesiod, Werke und Tage, S. 11
11 Sarah B. Pomeroy, Frauenleben im klassischen Altertum, deutsch von Norbert F. Mattheis, Stuttgart, Kröner 1985, S. 63
12 Aus einer altbabylonischen Tafel, deren Text in die neueren Übersetzungen des Gilgamesch-Epos keinen Eingang gefunden hat.
13 Susan Blundell, Women in Ancient Greece, Cambridge, Harvard University Press 1995
14 Der griechische Dichter Semonides schrieb im 7. Jahrhundert v. Chr.: »Denn Zeus hat dies als größtes Übel geschaffen: die Frauen, und legte es uns als Fessel und unzerreißbare Bande an.«
15 Christopher Marlowe, Die tragische Geschichte vom Leben und Tod des Doktor Faustus, 4. Akt, deutsch von Alfred van der Velde, Stuttgart, Reclam 1966
16 Homer, Ilias, 6. Gesang, deutsch von Johann Heinrich Voß, Frankfurt am Main, Insel 1990
17 Euripides, Die Troerinnen, übertragen von Ernst Buschor, München, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung 1957, S. 50
18 Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur. Und andere kulturtheoretische Schriften, Frankfurt am Main, Fischer 1997, S. 82f.
19 Aus dem Vorwort von Larousse Encyclopedia of Mythology, London, Hamlyn 1968
20 Zitiert in: Eva Keuls, The Reign of the Phallus, New York, Harper & Row 1985
21 »A Husbands Defense, Athens circa 400 B. C.« in: Mary R. Lefkowitz und Maureen B. Fant (Hrsg.), Women’s Life in Greece and Rome. A sourcebook in translation, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 3. Aufl. 2005
22 Pomeroy, Frauenleben im klassischen Altertum, a.a.O.
23 Ebd.
24 James N. Davidson, Kurtisanen und Meeresfrüchte. Die verzehrenden Leidenschaften im klassischen Athen, München, Siedler Verlag 1999
25 Keuls, The Reign of the Phallus, a.a.O.
26 Abby W. Kleinbaum, The War against the Amazons, New York, New Press 1983. »Verwundet, geprügelt, besiegt und niedergemacht mit den Speeren der klassischen Helden, mit der moralischen Entrüstung der Kirchenväter und zahlloser Kämpfer für das Christentum, mit den Künsten und Kräften der Helden der Renaissance, mit der Unerschrockenheit und Gier der Conquistadores der frühen Neuzeit, leben die Amazonen doch fort und begegnen uns wieder und immer wieder in der westlichen Kultur«, schreibt Kleinbaum in Anspielung auf die Hartnäckigkeit des Amazonen-Mythos.
27 Aristophanes hat in seinen ebenfalls im 5. Jahrhundert entstandenen Komödien ganz ähnliche Themen aufgegriffen und Frauen porträtiert, die sich gegen die gesellschaftliche und politische Ordnung und bestehende Moralvorschriften auflehnen. Zweifellos spiegeln sich in seinen Stücken die Sorgen, Interessen und Zwänge seiner Zeit wider. Aus der Tatsache, dass sich die Stoffe und Motive in Tragödien und Komödien gleichen, können wir schließen, dass beide ein relevantes Bild ihrer Zeit wiedergeben.
28 Sophokles, Antigone, 2. Akt, 1. Szene, übersetzt von Friedrich Hölderlin, Frankfurt am Main, Insel 1979
29 Ebd.
30 »Hippolytos«, in: Euripides, Tragödien, übersetzt von Hans von Arnim und Franz Werfel, Wiesbaden, Berlin, Vollmer 1958, S. 105
31 Platons Dualismus war kein neuer Gedanke. Im 6. Jahrhundert v. Chr. hatte Pythagoras eine Tabelle der Gegensätze aufgestellt. Die Tabelle enthielt zehn Begriffspaare, die der Überzeugung des Philosophen nach die Welt beherrschen, darunter gut/böse, rechts/links, Licht/Dunkelheit, begrenzt/unbegrenzt und männlich/weiblich. Auch die vier Elemente, die in der Auffassung der Antike die gesamte Natur ausmachten, bildeten zwei Gegensatzpaare: Feuer und Luft, Erde und Wasser. In dieser Sicht war der Unterschied zwischen Mann und Frau ein ewiger und unveränderlicher Gegensatz und eine nie versiegende Quelle des Konflikts.
32 Karl Raimund Popper, »Der Zauber Platons« in: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Bd.1, Tübingen, Mohr, 7. Auflage, 1992
33 Platon, Politeia. Der Staat, nach der Übersetzung von Friedrich Schleiermacher, in: Platon, Werke in acht Bänden, vierter Band, hrsg. von Gunther Eigler, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2001, S. 473
34 Ebd., S. 415
35 Ebd., S. 397
36 Ebd., S. 393
37 Ebd., S. 537f. Im Höhlengleichnis erklärt Platon seine Theorie von der falschen Auffassung der sinnlich wahrgenommenen Welt: In einer unterirdischen Höhle sind Menschen von Kindheit an gefangen und so festgebunden, dass sie nur auf die ihnen gegenüberliegende Höhlenwand blicken können. Hinter ihnen brennt ein Feuer, und zwischen dem Feuer und ihrem Rücken gehen Leute vorbei, von denen die Gefangenen nur den Schatten sehen, den sie an die Wand werfen. Weil sie nichts anderes kennen, halten sie dies für die Wirklichkeit. So wie die Gefangenen sich von den Schatten einer Wirklichkeit täuschen lassen, die sie nie unmittelbar gesehen haben, wissen wir, die wir die Welt nur durch die Sinne erfahren haben, nichts über die universale und unvergängliche Welt der vollkommenen Formen, von der das, was wir um uns herum sehen, hören, schmecken und ertasten, ein bloßer Schatten ist. Der Philosoph gleicht dem Gefangenen, der aus der Höhle entkommen ist und die Welt außerhalb ihrer gesehen hat.
38 Ebd., S. 171
39 Bertrand Russell, Philosophie des Abendlandes. Ihr Zusammenhang mit der politischen und sozialen Entwicklung, übersetzt von Elisabeth Fischer-Wernecke und Ruth Gillischewski, Frankfurt am Main, Holle 1950
40 Bertrand Russell zitiert in: Keuls, The Reign of the Phallus, a.a.O.
41 Aristoteles, Werke in deutscher Übersetzung, herausgegeben von Ernst Grumach, Hellmut Flashar, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft o. J.
42 Lefkowitz und Fant (Hrsg.), Women’s Life, a.a.O.
43 Pomeroy, Frauenleben im klassischen Altertum, a.a.O.
44 Marcia Guttentag und Paul F. Secord, Too Many Women: The Sex Ratio Question, Thousand Oakes, Sage Publications 1983
45 Aristophanes, Lysistrata, neu übersetzt von Erich Fried, Berlin, Wagenbach 2000, S. 35