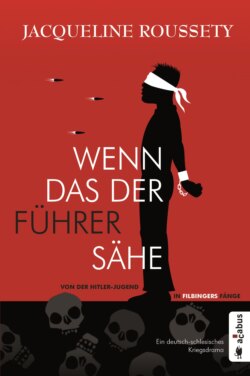Читать книгу Wenn das der Führer sähe … Von der Hitler-Jugend in Filbingers Fänge - Jacqueline Roussety - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSchlesien
Mohrau 1932
Die Familie
In meinem jungen Leben hat es meinen Bruder Walter immer gegeben. Er war ein Teil meines Ichs, das sich im familiären Umkreis entwickeln durfte, sich die ersten Jahre in dieser kleinen Gemeinschaft festigte, bis ich eigene Schritte wagte und Neues kennenlernte. In vielen Dingen prägte der große Bruder mich mehr als meine Eltern, die Tag und Nacht mit irgendetwas beschäftigt waren. Mit sich, der Politik, der Dorfgemeinschaft und später dem Kampf ums Überleben innerhalb genau dieser Gemeinschaft, die irgendwann morsch und zerrüttet war, auseinanderbrach, keinen Schutz mehr bot. Walter, der einzige Sohn inmitten der Mädchenschar und natürlich der Liebling unserer Mutter Anna, zog alle Blicke auf sich, was ihm nicht immer behagte. So manches Mal wäre er wohl lieber unsichtbar geblieben. Mein Vater Alfred tat, was er konnte, um ihm den Sinn des Lebens näherzubringen, ihn auf seine Aufgaben als Mann vorzubereiten.
Nach schlesischem Brauch sollte er als ältester Sohn später einmal den Hof übernehmen. Aber Walter war mit seinen knapp zehn Jahren ein Träumer, ein Bursche wie ein Wiesel, der, wann immer er konnte, vor den Anforderungen des Alltags zu fliehen wusste. Ein Charakterzug, der ihn das Leben kosten sollte. Wahrscheinlich waren es gerade die sorglosen Kinderjahre, die ihm eine Zukunft voll der Harmonie und Arglosigkeit vorgaukelten – eine Zukunft, die die Realität für uns in Wahrheit nie vorgesehen hatte. Nichts trübte den Blick, alles schien wunderbar, unser Leben in einer gewachsenen familiären Struktur, einer intakten Gemeinschaft, innerhalb derer sich jeder auf jeden verlassen konnte.
Die Auswirkungen der Inflation der 20er Jahre bekamen wir Kinder nicht mit. Aber Mutter hielt alles akribisch in ihren Tagebüchern fest, sodass ich Jahre später begriff, was in jener Zeit überhaupt los gewesen war. Sorgen und Ängste der Erwachsenen in ihrer eigenen Welt, an der wir Kinder nicht teilhatten. Die weltweite Agrarkrise war natürlich auch in unserem Dorf zu spüren gewesen. Walter erzählte mir, dass Thea, meine ältere Schwester, und er, wenn sie die Küche betraten und die Eltern mit sorgenvoller Miene vor einem Haufen Geldscheine sitzen sahen, instinktiv spürten, dass etwas in der Welt der Erwachsenen nicht stimmte. Wenn Vater ihnen dann aber aus den Scheinen kleine Schiffe bastelte, schienen alle Sorgen vorerst vergessen. Die große Depression aus Amerika, die auch Deutschland wirtschaftlich aus den Angeln hob, bekam in unserer Küche keine Chance, sich festzusetzen. Meine Großeltern, die nur ein paar hundert Meter weit weg wohnten, schauten jeden Tag vorbei, erzählten Geschichten aus ihrer Jugendzeit, in der alles viel überschaubarer gewesen sei in diesem Dorf, das sich den Traditionen, dem menschlichen Miteinander verschrieben hatte. Dann saßen alle beisammen und hielten sich für unbesiegbar. Ich lag in meinem Weidenkörbchen und nuckelte zufrieden am Daumen. Die Familie war unser Zuhause, unsere Burg und Festung, die uns vor Wind und Wetter und allen stürmischen Gezeiten schützen würde. Was störte uns die Wirtschaftskrise, die irgendwo in den dunklen Städten ihr Unwesen trieb? Mutter ging am nächsten Morgen auf den Markt und tauschte hausgemachte Ziegenbutter gegen andere nützliche Waren ein.
Mutters Ziegenbutter galt immer als etwas Besonderes, und zwar aus folgendem Grund: Die Ziegenbutter, von Natur aus weiß, sollte nach ihrer Vorstellung zumindest so aussehen wie Kuhbutter. Sie holte sich Safran aus der Drogerie und färbte die blasse Ziegenbutter damit ein. Aber meistens verschätzte sie sich in der Dosierung. Oft wies die Butter am Ende eine kräftige orangene Tönung auf. Das sah exotisch aus, war einfach ein Hingucker. Auf jeden Fall konnte nicht eine Mohrauer Kuh mit der Farbe von Annas Butter mithalten. Dafür bekamen wir im Gegenzug all jene Dinge, die wir nicht selbst auf dem Hof besaßen.
Das Geben und Nehmen auf dem Dorf besaß noch seinen Wert, half so manchem zu überleben. Hier ließ man keinen verrecken.
Auf unserem kleinen Hof lebten mit uns ein Schwein namens Fritz, eine Kuh und drei Ziegen sowie eine kleine Hühnerschar. Damit waren wir in der Lage, uns relativ gut zu ernähren in den Zeiten, in denen Hunger und Not viele Familien trafen. Neben selbst angebautem Obst und Gemüse und Kartoffeln besaßen meine Eltern die elementaren Grundnahrungsmittel, um sich und uns Kinder satt zu kriegen.
Besonders den Bauern in Schlesien ging es Ende der 20er Jahre schlecht und so manch einer dachte daran, sein bisschen Hab und Gut zu verkaufen und sich in eine der entfernten Metropolen zu begeben. Doch dort, so hörte man, herrschte die große Arbeitslosigkeit, die vor allem die mittlere und ärmere Schicht der Gesellschaft traf. So blieben die Leute mit ihrem bisschen Hoffnung. Und warteten. Und bei nicht wenigen löste sich die Hoffnung allmählich auf, bis ihnen das blanke Entsetzen ins Gesicht geschrieben stand.
Meinen Eltern ging es nicht ganz so schlecht. Wer damals etwas von den Machenschaften der Banken und Börsen verstand, wie mein Vater, der legte sein Geld beizeiten in Häusern und Grundstücken an. Wer konnte, auch in Gold. Die beiden hatten sich in den 20er Jahren ein großes, mehrstöckiges Haus aus Stein gekauft. Es lag auf der anderen Seite des Baches und ein Holzsteg verband die „Neue Welt“, wie die Dorfbewohner diesen neu angelegten Teil nannten, mit dem Rest des Dorfes. Neben dem Haus befanden sich der Stall und darüber der Heuboden mit einer Luke zum Abladen des getrockneten Grases. Gegenüber stand eine Scheune, einst dazu gedacht, das Getreide aufzunehmen; hier lagerte mein Vater seine Steinplatten. So bildete der gesamte Komplex eine Art Burg. Das große Tor öffnete sich zum geräumigen Hof und hier wuchs ich auf, in unserer Bauernburg. In dieser Geborgenheit des Elternhauses plätscherte unsere Kindheit unbekümmert dahin, ohne sonderliche Spuren oder Narben zu hinterlassen.
Ich erinnere mich, dass die schneeweiß getünchten Steine zu jeder Tageszeit in einem anderen Farbton leuchteten. Morgens und abends eingetaucht in sanften Goldstaub, umgeben vom üppig blühenden Garten. Noch war der Kredit nicht abgezahlt, aber wir hatten ein Dach über dem Kopf und viel Platz, um uns auszutoben.
Vater musste dafür einige Jahre im Marmorbruch arbeiten. Eine körperlich schwere und gesundheitsgefährdende Arbeit, die nicht ohne Folgen blieb für ihn, aber er wollte den Kredit so schnell wie möglich tilgen. Er stammte, wie man damals so schön sagte, aus gutem Hause, aus Neisse, der nächstgelegenen kleinen Stadt, die sich der Moderne verschrieben hatte mit Bars, Kaschemmen, Automobilen und städtischem Flair. Beide Elternteile waren Musiklehrer und glaubten, etwas Besseres zu sein. Als der begabte große Sohn sich in die zierliche kleine Anna vom Land verliebte und diese auch noch ehelichte, da war es vorbei mit der Familienidylle, die geprägt war von einer gewissen Avantgarde, von mondänem Chic aus aller Welt und ausgelassenen Partys. Da war ihren Lebensvorstellungen dieses „Gesinde“ in die Quere gekommen.
„Dieses Bauernmädel heiratest du mir nicht! So eine findest du doch in jedem Straßengraben!“, beschied Rotraud ihrem Sohn Alfred.
Er verließ daraufhin das elterliche Haus und heiratete seine Anna ohne den Segen dieser stolzen Eltern. Sie blieben der Hochzeit ihres ältesten Sohnes fern. Anna war zutiefst verletzt. Denn ihre Eltern hatten beiden Töchtern eine Ausbildung ermöglicht und sie nicht wie „Bauernmädel“ großgezogen.
Als ihr Vater nach dem Ersten Weltkrieg zurückkehrte, musste er feststellen, dass seine Frau und die zwei Töchter sowohl den Hof als auch die Versorgung der Familie allein bewältigt hatten. Es gab nicht eine Maschine, nicht ein Ding, das seine Frauen nicht beherrschten. Denn auch der einzige Sohn war eingezogen worden und kehrte nicht zurück. Irgendwo im Westen, in einem der vielen Schützengräben, war er umgekommen. Ein schlichtes Kreuz auf dem Friedhof erinnerte an den Jupp. Nun mussten alle lernen, mit der neuen Situation umzugehen. Anna und ihre Schwester Irmtraud wollten raus aus der dörflichen Enge, raus aus dem Mief von Stall und Feld. So durften die beiden in Neisse eine Ausbildung beginnen. Mutter bewarb sich später als Stenotypistin und arbeitete im Kontor von Herrn Rosenthal, Irmtraud arbeitete im Bürgeramt.
Während Irmtraud sich in den jungen Ernst verliebte, der eine Tischlerei betrieb, und zu ihm ins Nachbardorf zog, lernte Anna in Neisse ihren Alfred kennen. Und da er sich daraufhin mit seinen Eltern überwarf, zog Alfred in das Dorf seiner jungen Frau.
Ursprünglich sollte sie gar nicht auf dem Hof arbeiten. Und als wirkliche Bauern sahen sich meine Eltern sowieso nicht. Meine Mutter hatte noch bis kurz vor meiner Geburt als Stenotypistin in Neisse gearbeitet. Aber drei Kinder zur Tagespflege, das konnte und wollte sie ihren Eltern nicht mehr zumuten; die hatten mit ihrem eigenen Haus und Hof genug zu tun. So verrichtete meine Mutter also auch bäuerliche Tätigkeiten. Dennoch erhielt sie den Kontakt zu ihrem ehemaligen Kontor aufrecht. Nicht selten kam der Prokurist vorbei, in einem dieser schicken Automobile, brachte das eine oder andere an Arbeit mit und meine Mutter konnte von zu Hause aus der Firma mit Schreibarbeiten aushelfen. In der guten Stube stand immer ihre Schreibmaschine. Und wenn sie auf die Tasten einhämmerte, hörten wir das rhythmische Klappern im ganzen Haus, unterbrochen von einem feinen Pling, sobald eine Zeile voll war.
Das sind die vertrauten Geräusche, die man in der Erinnerung wie einen kostbaren Schatz aufbewahrt. Sie streicheln die Seele, trösten einen, wenn Gewitterwolken die Helligkeit verdrängen. Wie oft wühle ich in meinen Gedanken und grabe die alten Bilder der Kindheit aus!
Es sollte einige Jahre dauern, bis die elegante Rotraud das Bauerngesindel besuchte, um das dritte Enkelkind – nämlich mich – in Augenschein zu nehmen. In der Zeit verstarb Alfreds Vater, ohne sich mit dem Sohn versöhnt zu haben. Diese ohnmächtige Verzweiflung, die alle befiel, brachte die Großen endlich dazu, sich einander wieder anzunähern. Tod und Trauer der Erwachsenen mussten erst die Oberhand gewinnen, um uns Kindern wieder eine ganze Familie zu schenken. Mit meinen blonden Haaren und veilchenblauen Augen wurde ich zum Band zwischen diesen Parallelgesellschaften, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Oma Rotraud wurde meine Patentante. Der Groll darüber, dass ihr einziger Sohn nicht einer hoffnungsvollen Musikerkarriere nachgegangen war, nagte zeitlebens an ihr; das verzieh sie ihm trotz allem nicht.
Stattdessen fuhr ihr Alfred nun morgens im Dunkeln mit dem Fahrrad zur Arbeit – in der einen Hand die Sturmlaterne, mit der anderen balancierte er sein Rad die unebenen Wege und Pfade entlang. Dabei heulte der Wind über die Dächer und die herbe schlesische Natur zeigte erbarmungslos ihr wahres Gesicht. Meine Mutter ging beim benachbarten Bauern melken, tippte zu Hause diverse Briefe und arbeitete zusätzlich als Teppichweberin, wobei sie nicht selten mitten am Tag am Webstuhl einschlief. Dann stand ich da, hielt meine Stoffpuppe umklammert und beobachtete, wie ihr Kopf langsam auf die prächtigen, farbigen Muster sackte, während die Hände sich noch in den bunten Fäden festklammerten. Von irgendwo draußen klang das Lachen anderer Kinder herein, dann ein Aufschrei von Thea, die wieder einmal von unserem Bruder geärgert wurde. Schweinchen Fritz lief quiekend aus dem Stall und Walter hatte seine diebische Freude daran zu testen, wer lauter und länger schrie: Thea oder Fritz. Meistens gewann Thea und Fritz bekam zur Belohnung etwas Fressbares, das er sich in Windeseile schmatzend einverleibte. Und danach wartete er hoffnungsvoll auf die nächste Attacke.
Ich freute mich für Fritz, denn meine ältere Schwester zeigte mir sehr wohl, dass sie mich als lästig empfand. Auch optisch waren wir grundverschieden. Sie mit ihrem wunderschönen Gesicht, den ovalen braunen Augen und den dunklen Haarwellen; dagegen ich mit den schlohweißen Haaren, heller Haut und den kleinen hellblauen Augen, die Thea verächtlich „Schweinsäuglein“ nannte. Walter hatte einen goldblonden Schopf und schöne große, dunkelblaue Augen. Ich habe nicht selten gedacht, der Klapperstorch hätte mich einfach falsch abgesetzt.
Mutter hörte all das Gequieke und Gejammere schon nicht mehr, sie war bereits eingenickt. Und im Flur tickte Großvaters alte Uhr, die zu jeder Stunde einen sonoren Glockenschlag von sich gab. Ich fühlte mich wundersam geborgen mit dieser schlafenden Mutter und den vertrauten Stimmen und Geräuschen, die von überall her zu mir hereindrangen und wie unsichtbare Bilder an den Wänden haften blieben.
Es gab aber auch härtere Zeiten, wie Walter mir Jahre später erzählte. Da kochte Vater tagein, tagaus Grießbrei für uns und abends gab es Klappstullen mit Schmalz oder Stampfkartoffeln. Das Brot brachte Oma vorbei – sie hatte es am Tag gebacken – und abends klapperten ihre Stricknadeln, damit wir Kinder etwas Warmes auf dem Leib trugen. Das ging wohl selbst Vater zu weit und deshalb versuchte er, sich selbstständig zu machen, fertigte mit zwei Mitarbeitern auf dem eigenen Grundstück Zementsteine, Zementartikel, Zaunpfosten und Wegplatten an und betätigte sich zudem noch als Kohlenhändler. Er trug im Winter die Presskohlen aus und wir Kinder tobten zwischen Feldern und Hühnern herum.
Im Winter 1929/30, einem der härtesten, den die Mohrauer je erlebt hatten, brach sein Zementgewerbe ein. Das Wasser gefror in den Schüsseln, so manches Rohr drohte zu platzen. Die Kurbel der Wasserpumpe ließ sich um keinen Millimeter mehr bewegen, die Stämme etlicher Obstbäume brachen laut krachend auseinander. Wieder gab es keinen Verdienst. Selbst Kohlen wurden zur Mangelware. Und wer brauchte im Winter schon eine Terrasse oder Zementklötze? Mein Vater war arbeitslos, wie Millionen andere auch. Er empfand es als Schmach, es erfüllte ihn mit Verzweiflung und Wut.
„Erwerbslos“ hieß das im Amtsdeutsch. Mutter hat im Tagebuch nur dieses eine Wort vermerkt. Es prangte auf der Seite wie ein fürchterliches Mal.
„Ich geh stempeln. Nun bin ich ein Stempelbruder wie so viele andere auch“, murmelte Vater vor sich hin. Er erhielt den Bedürftigkeitsbescheid und eine Zahlkarte.
Pro Woche bekam er acht Mark und neunzig Pfennig Stempelgeld für fünf Personen. Ich vermute, es war nicht selten, dass die schicke Rotraud mit ein paar Groschen aushalf. Eine Schmach, die dem Sohn die Röte ins Gesicht trieb, wie ich ebenfalls später in Mutters Tagebuch nachlesen konnte.
Ihre Schrift verrät die innere Verfassung, in der sie war, wenn sie ihre Eindrücke festhielt. Die Schwiegermutter löste bei meinen Eltern immer eine Art Hilflosigkeit aus; es verletzte ihr Selbstwertgefühl, wenn sie sich in die Belange der Familie einmischte. Aber der Hunger der Kinder wog schwerer als verletzte Eitelkeit. Denn auch beim Kontor drohte der Konkurs und es gab vorerst keine Schreibarbeiten mehr für Anna.
So fehlte auch das Geld für das Wirtshaus vom alten Josef, der immer ein Auge zudrückte und ab und an heimlich die Schnapsflasche öffnete, um das eine oder andere Gläschen zu füllen. Aber jetzt musste jeder Pfennig gehortet werden. Also traf man sich einfach bei uns in der großen Küche. Zum Kartenspielen, zum Reden und Diskutieren; nicht selten ging die ganze Nacht dabei drauf.
Die Freunde
Wir gehörten zu den Ersten im Dorf, die ein Radio besaßen. Ein Gut, das Vater aus seinen wohlhabenderen Zeiten mit in die Ehe gebracht hatte. Und so wurden neben beschwingter Musik auch die politischen Reden angehört, die die Erwachsenen auf unterschiedliche Weise beeinflussten. Das ging jahrelang so, dass sich viele Leute bei uns trafen. Wer konnte, brachte etwas Essbares mit. Bier wurde aus einem kleinen Fass ausgeschenkt und wir Kinder bekamen Himbeer- oder, wer wollte, Zuckerwasser. Die Schlesische Funkstunde AG bot vor- und nachmittags ein abwechslungsreiches Programm. Abends lauschte man den neuesten Meldungen aus aller Welt, denn immer mehr rückte das „Großdeutsche Reich“ mit seinen politischen Wirren in den Vordergrund der Berichterstattung. Grund waren unter anderem die vielen Splitterparteien, die es nicht schafften, innerhalb der neuen Republik einen Konsens zu finden, wie Vater oft vor sich hin murmelte. Walter war häufig dabei, lauschte den Gesprächen der Erwachsenen, und ich kauerte auf der warmen Ofenbank, bis mir die Augen zufielen und irgendjemand mich ins Bett brachte. Bis weit in die Nacht hinein wurde lauthals und heftig über Politik diskutiert – unser Schmied und Sattlermeister Herbert zum Beispiel war ein glühender Verehrer der kommunistischen Partei.
„Denn nur die wahre Revolution, wie Lenin sie vorgeführt hat, schützt den Menschen vor weiterem Unglück“, triumphierte er mit erhobener Stimme.
Ich meinte zu sehen, dass immer, wenn er laut sprach, seine Haare sich ein wenig aufrichteten. Und hatte er Gustav, unseren Frisör, über Monate nicht aufgesucht, dann standen sie ihm buchstäblich zu Berge. Seine Devise lautete: „Wer Hitler wählt, wählt Krieg. Und dieser Mann will den Krieg.“ Diese Parole der Kommunisten hat Mutter mit mehreren Linien im Tagebuch festgehalten und dick unterstrichen.
Mit leuchtenden Augen saß Walter vor Herbert. Für ihn war Krieg gleichbedeutend mit Abenteuer, Kämpfen und Stark-sein-Dürfen. Er wollte auch in einen Krieg ziehen und hoffte nun, dass die Erwachsenen damit warteten, bis er groß war.
Dieser Wunsch sollte ihm gewährt werden …
Herbert hat die Gedankenwelt meiner Mutter sehr geprägt und beeinflusst. Seine politische Meinung, die Gespräche mit ihm waren es, die sie am meisten suchte, um sich ein eigenes Bild der politischen Lage zu bilden. Vielleicht war sie nicht im klassischen Sinne eine Intellektuelle. Aber sie war klug, wissbegierig und besaß ein schnelles Auffassungsvermögen. Und sie besaß ein großes Herz. Es kam nicht von ungefähr, dass sie sich eher mit den Weltoffeneren aus dem Dorf verbunden fühlte als mit den traditionsbewussten Bewohnern. Auch hatten die Jahre in Neisse – der kleinen Stadt, in der die große weite Welt ein paar Spuren hinterlassen hatte – sie geprägt.
Otto, ein Sozialist, der sich besonders mit Vater austauschte, besaß hier in Mohrau ein Fuhrunternehmen. Otto erkannte der Republik noch eine Daseinsberechtigung zu, wurde aber unter lautem Gelächter niedergeschmettert mit dem Ausruf: „Dieses Kabinett der Patrone mit seinen N otstandsparagraphen!“
Der eine oder andere Nachbar war schon zu dieser Zeit überzeugter Nationalsozialist, Anhänger jener neuen Partei, die in rasendem Tempo Wahlkreis für Wahlkreis eroberte, mit dem Mann an der Spitze, dessen angsteinflößende Stimme immer öfter aus dem Radio zu uns dröhnte. Mutter hat sehr früh angefangen, diese Partei im Tagebuch zu erwähnen. Die ließ ihr wohl von Anfang an keine Ruh.
„Eine stampfende Wahlkampfmaschine!“, so ihr trockener Kommentar. Dabei schüttelte sie sorgenvoll den Kopf.
Der junge Wilhelm, kurz Willi gerufen, der immer mit Vater zusammensaß und ins Leere politisierte, wie Vater es bezeichnete, war überzeugt, nur dieser Adolf Hitler würde es schaffen, den Deutschen ihre verlorene Würde zurückzugeben. Nur einer wie er könne dem geliebtem Vaterland zu Größe, Glück und Wohlstand verhelfen. Das hatte er schließlich versprochen! Und Brot! Und Arbeit!
Meine Mutter stand inmitten dieser Männerschar und ihre Bemerkung: „Es wird uns auch ohne dieses braune Pack bald besser gehen“, wurde von den paar NSDAP-Anhängern kopfschüttelnd kommentiert: die Anna mit ihrem sozialistischen Gedankengut, beeinflusst vom roten Herbert! Typisch Frau eben – und so weiter.
Am liebsten war mir der alte Herr von Schilling, unser Patron, wie alle ihn nannten. Er war einst vermögend gewesen, hatte aber schon in der ersten Weltwirtschaftskrise 1923 fast sein gesamtes Hab und Gut verloren. Sein gutsähnliches Anwesen konnte man noch bestaunen und seine Pferdezucht war weit über Schlesien hinaus berühmt gewesen. Auf dem Gestüt waren nur edle Pferde gezüchtet worden; grasend hatten sie auf den großen Koppeln gestanden. Der Patron selbst lebte nach wie vor in einem der gepflegten Gebäude. Nur still war es da geworden. Die vielen Menschen, die dort einst gelebt und gearbeitet hatten, waren in alle Himmelsrichtungen verstreut. Die Henriette, seine ehemalige Wirtschafterin, bemühte sich, ihm einen würdigen Lebensabend zu bieten.
Seine beiden Söhne waren während des „Großen Krieges“ gefallen und obwohl sie für den Kaiser gestorben waren, der doch alle in diesen sinnlosen Krieg hineingeworfen habe, wie der Patron immer wieder ausrief, hoffte er stets auf die Restauration der Monarchie. Nur einem Kaiser würde es seiner Meinung nach gelingen, Zucht und Ordnung in dieses marode Land zu bringen. Am Revers trug er das Verdienstkreuz von 1914/18; einst schimmernd wie ein kostbarer Stein, war es inzwischen stumpf und matt – der verlorene Glanz einer untergegangenen Ära. So viel Kapital habe der Herr Schilling damals in Kriegsanleihen gesteckt, raunten die Dorfbewohner einander zu; er sei ein Held gewesen, ein echter Patron. Nur hatte all das keine Bedeutung mehr. Der Große Krieg gehörte längst der Vergangenheit an. Niemand wollte sich damit noch abgeben, hatte die Niederlage doch, da war man sich einig, nur Schmach und Schande über Deutschland gebracht.
Mit seinem Monokel, dem immer fein gekämmten Haar und dem abgetragenen schwarzen Frack sah der Patron so anders aus als die anderen. Und zugleich lagen in seinem schwermütigen Blick eine scheue Ängstlichkeit und ewige Trauer. Er ging ein wenig gebeugt, so als ruhte eine ständige Last auf seinen Schultern, der er sich nicht gewachsen fühlte. Seine feingliedrigen Finger umklammerten den silbernen Knauf seines Gehstocks. Meine Mutter beobachtete er stets mit einem scheuen Augenaufschlag. Die Anna, ja, die hatte es ihm angetan. Diese kluge Frau, die sich nicht so leicht beirren ließ, die einen gesunden Menschenverstand besaß und sich wie eine Löwin für Familie und Freunde einsetzte. Selbst in schweren Zeiten zauberte sie immer etwas auf den Tisch, hatte ein Ohr für die Sorgen der anderen und wenn sie lachte, dann bebte ihr gesamter kleiner Körper. Alle hatten Respekt vor ihr und Vater war stolz auf seine lebenskluge, patente Frau.
„Und warum gibt es zwischen der KPD und der SPD keinen Frieden?“, fragte Mutter kopfschüttelnd. „Warum keine gemeinsame Aktion starten, und wenn es nur dafür wäre, die Braunen mit vereinter Kraft zu schwächen!“
„Die KPD strebt doch nur die alleinige Macht des Proletariats an! Wo soll das hinführen? Wir brauchen neuen Wind in dieser Republik, die eh auf sehr wackligen Füßen steht“, konterte Willi sofort und warf Herbert einen verächtlichen Blick zu. „Ihr Roten werdet Deutschland nicht wieder aufbauen. Ihr wollt eine Weltrevolution, die nur von den Russen bestimmt werden soll. Wer will zu diesem Gesocks dazugehören? Ich bin gerne deutsch. Ich liebe Deutschland und werde dafür kämpfen, dass es auch mein Land bleibt. Und nur zu deiner Information: Nicht nur der Pöbel hat Hitler letztes Jahr gewählt, wie du immer gern behauptest, auch Teile des schicken Bürgertums. Jawohl! Die Leute sind müde von der ‚ach so großen modernen Welt‘, die einfach alles und jeden auffrisst, was nicht mithalten kann.“
Seine einst reiche F amilie hatte während der Wirtschaftskrise große Ländereien verloren. Willi suche immer nach dem besserem Leben, wie Vater erklärte. Ihm kam Willi vor wie ein junger Hund, der in größter Verzweiflung sein Herrchen sucht. Lange Zeit hatte er Vater für diese Rolle auserkoren. Wissbegierig lauschte er seinen Worten, hing förmlich an seinen Lippen. Mutter sagte einmal scherzend: „Gott hat mir den Bruder genommen und nun haben wir den Willi!“
„Würdest du auch auf einen Menschen schießen, Willi?“, wisperte Walter und fummelte aufgeregt an seinem Pullunder, den auszuziehen er seltsamerweise vergessen hatte.
Dieses verhasste Kleidungsstück symbolisierte die Schule, die penible Ordnung, eine vorgegebene Hierarchie, die er inbrünstig ablehnte. Eine Hierarchie, die ihn zwang, Befehle auszuführen, die ihm nicht behagten. Auch ein Wesenszug, den er nie ablegen sollte. Und für den er später einen hohen Preis zahlte.
„Ja, mein Junge, ich würde auch zur Waffe greifen, wenn ich mein Vaterland verteidigen müsste. Denn wer Deutschland dem Untergang weihen will, dem werde ich mutig entgegentreten. Das würdest du auch tun, wenn du vor der Wahl stündest.“
„Mama, ich will auch in den Krieg ziehen!“, jubelte Walter. „Willi, könnt ihr bitte warten, bis ich groß bin? Ich meine das mit dem Krieg und dem Schießen?“
„Schaff du erst mal deine Schule, denn einen Bengel, der nicht rechnen und schreiben kann, nehmen die nicht“, murmelte Mutter und schmierte ihm eine weitere Stulle.
Damit wurde der erste Hunger gedämpft. Walter schwieg. In Gedanken war er in einer Welt, zu der ich als kleines Mädchen keinen Zutritt bekam.
„Na, Willi“, meine Otto lakonisch, „dann kannste dich ja gleich einreihen in eure braunen Truppen. Liest man doch jetzt fast täglich, von den Straßenschlachten zwischen den Kommunisten und den Nazis. Mittlerweile wird sich nicht mehr nur geprügelt, es wird auch geschossen. Salven sollen pfeifend durch die Straßen und Höfe in Breslau peitschen, es trifft wohl auch so manchen Unschuldigen. Besonders vor den Wahltagen geht es hoch her. Auch in Neisse sind diese Auseinandersetzungen nicht mehr zu übersehen. Und das ist nur ein paar Kilometer von uns entfernt. Da muss man nicht bis nach Breslau fahren. Was denkst du, wie lange noch, bis auch wir hier im Sumpf versinken? Da lob ich mir die junge Republik, die einfach den Fortschritt will und den Frieden sucht.“
„Immer nur dem anderen seinen Willen aufzwingen wollen, das kann doch nicht gutgehen!“, mahnte mein Vater.
Der Patron räusperte sich, strich mit seinem alten Finger über das blanke Holz der Tischplatte. Er wiegte den Kopf und begann sehr leise zu reden. Seine Stimme hatte etwas Beruhigendes. Schlagartig hielten alle inne. Es schien, als spräche er aus einer anderen Welt zu uns.
„Meines Erachtens haben sich die beiden großen Arbeiterparteien gegenseitig handlungsunfähig gemacht. Jetzt sind sie wie gelähmt, keiner prescht vorwärts, um die Situation zu verändern. Da hocken sie wie ängstliche junge Vögel in ihren engen Nestern und warten ab, was die Zeit so bringt.“
Es blieb ruhig. Er sah auf und fuhr fort: „Aber genau dieses Warten nutzt Herr Hitler aus, um sich in der Republik einzunisten und sie dann auf Dauer zu vernichten, sich mit aller Gewalt durchzusetzen, politisch wie gesellschaftlich. Ein wahres Gottesgeschenk für den Mann aus Österreich. Er spielt sehr gekonnt mit den Gefühlen der Menschen! Seine Partitur handelt von der Sehnsucht nach einer intakten Gesellschaft, mit Brot und Arbeit und einem geregelten Alltag. Wie schnell sind SA- und SS-Männer von der Hitlerpartei zu Hilfspolizisten berufen worden? Da gehen sie und tragen stolz ihre schwarz-weiß-rote Armbinde über der sauberen braunen Uniform. Dabei wüten sie unzivilisiert in den Straßen, mit geladenen Pistolen und Gummiknüppeln, die sie auch mutwillig einsetzen.“
Sein Blick war, während er sprach, durch den Raum gewandert und an Willi haften geblieben. Er sah den jungen Mann nachdenklich an. Dann fuhr er fort, sprach eindringlich in Herberts Richtung.
„Die KPD und die SPD sollten sich in der Tat zusammenschließen. Es muss doch möglich sein, die wirkliche Gefahr, die auf uns alle zurollt, zu erkennen. Wie eine Lawine, die nicht mehr aufzuhalten ist, wenn ihr Linken es nicht schafft, euch einig zu sein.“
„Die SPD unterstützt nur die Großindustrie und das Junkertum, denen geht es nur um wirtschaftliche Interessen, nicht um die Belange der einfachen Leute, die tagtäglich ihre Sorgen haben! Und die nennen sich sozial? Wie sollen wir mit denen Hand in Hand gehen?“, brüllte Herbert und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Ich zuckte zusammen.
Meine Mutter fuhr herum, starrte ihn an und es wurde augenblicklich still.
„Bitte nicht vor den Kindern. Bei mir ist jeder willkommen, jeder darf hier seine Meinung sagen, aber wer grob wird, verlässt meine Küche. Und zwar auf der Stelle. Ich liebe mein Land auch, unsere Bräuche, und ohne die Dorfgemeinschaft wäre ich bestimmt sehr einsam. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand mit seiner Ansicht alles hundertprozentig besser machen kann. Von jedem etwas, das wäre die Demokratie, die uns in diesen schweren Zeiten helfen könnte. Und nicht das gegenseitige Zerfleischen und Augen-Ausstechen. Was nützen Verletzungen, Blindheit oder gar Tod? Das bringt keinem was und dieses bisschen Leben ist doch mehr als kostbar! Wir sollten alle Respekt vor dem Leben haben, der Natur und Gott vertrauen.“
Traudel betrat die Küche und es war, als trüge sie eine frische Frühlingsbrise herein. Alle atmeten erleichtert auf. Dankbar begrüßte man sie, fragte nach ihrem Wohlbefinden und als Peter auch noch in die Küche stürmte, war unsere Gemeinschaft wieder bei den alltäglichen Dingen angelangt.
Traudel, eine Freundin von Mutter, hatte die oberste Etage unseres Hauses bezogen; dort wohnte sie mit ihrem Sohn Peter. Ihr Mann war einige Jahre zuvor gestorben; sie war allein mit dem Kind und arbeitete in Neisse in der Porzellanfabrik. Peter und Walter wurden unzertrennliche Freunde. Oft zogen sie abends los und trieben ihre Scherze mit den Nachbarn. Auch teilten sie die Liebe zum Boxen. Mit viel Humor beschreibt Mutter im Tagebuch, wie Walter glühend vor dem Radio saß, als Franz Diener, deutscher Meister im Schwergewicht, gegen Max Schmeling in 15 Runden verlor. Walter hatte einen neuen Helden. Und zusammen mit Peter erlebte er anno 1930 und ’32 den ersten und zweiten Fight Schmeling gegen Sharkey. Max wurde Weltmeister im Schwergewicht. Von da an kannten die Jungen ihren Traumberuf. Boxen wurde zu ihrer Religion. Traudel und Mutter lächelten weise, zupften an den jungen Bohnen und warfen sie in eine Schüssel.
„Diese Träume! Wer weiß, was Gott ihnen für eine Zukunft bescheren wird!“, heißt es an einer Stelle im Tagebuch.
Das Dorf
Trotz der unsicheren Wirtschaftslage und der politischen Wirren, die die Erwachsenen schier in den Wahnsinn trieben, hatten wir Kinder in Mohrau das Glück, in einer wahren Idylle aufzuwachsen. Die Landschaft bot ein üppiges Bild mit strotzenden Farben und glühender Blütenpracht.
Vaters großes Hobby war sein Garten – sein Paradies, in dem er sich frei und ungezwungen fühlte. Rund um das Haus sah es aus wie in einem Schmuckkästchen. Mit Liebe wurde allem sein Platz zugewiesen; selbst das Hühnerhaus bekam einen bunten Anstrich, damit es ins Gesamtkonzept passte. Dort thronte erhaben der Gockel auf dem roten Dach, das mit einer blauen Borte verziert war, und weckte pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen das halbe Dorf. Die Farben schienen ihn zu Höchstleistungen anzuspornen. Er, der Bote des Lichts, rief uns Menschen zu Arbeit und Gebet. Dann scharte er seinen Harem um sich, fünf Damen, die jeweils zwei bis drei Gelege mit maximal zehn Eiern ausbrüten konnten.
Genau diese Anzahl konnte die Glucke unter ihrem Gefieder warm halten. Neben Eiern lieferte uns die Schar auch Fleisch und Federn. Für die Fütterung der Hühner waren wir Kinder eingeteilt und ich fand es herrlich, wenn sie sich um mich sammelten, um die Körner zu picken, die ich ausstreute.
Alle hatten wir unsere Pflichten zu erfüllen und Mutter dirigierte den kleinen Hausstaat gekonnt. Sie war morgens als Erste auf den Beinen. Sie fachte im Herd das Feuer an, während Walter und Vater im Stall die Tiere versorgten. Thea half Mutter in der Küche und ich durfte zwischen allen hin und her rennen und zusehen. Wo ich schon zur Hand gehen konnte, versuchte ich mein Bestes. Sobald die großen Tiere ihr sauberes Bett, trockenes Stroh und Futter erhalten hatten, wurden die Hühner versorgt und wir schauten nach frischen Eiern. Danach saßen wir alle gemeinsam am Küchentisch. Meist gab es Milchsuppe mit getrocknetem Brot, Hafermus und Obst. Im Winter aß Vater oft Pellkartoffeln mit Schweinefett, damit er etwas Anständiges im Magen hatte, wenn er die Kohlen ausfuhr.
Mutter war neben den Hausarbeiten auch für das Gemüse und die blühenden Hecken zuständig, die dem Grundstück vom Frühjahr bis in den späten Herbst ein schmuckes Aussehen verliehen. Vater pflanzte Bäume, pfropfte und veredelte sie, experimentierte wie ein Wissenschaftler mit den neuesten Methoden. Sein größter Stolz jedoch waren die Rosen. Eigenhändig holte er die Wildlinge aus dem Wald. Den großen Korb auf den Rücken geschnallt, verschwand er für Stunden im Geäst, kletterte in den Hängen, kam zurück mit seiner Beute und veredelte sie zu Hochstämmchen. Aus der Wassertonne schöpfte er seine Kanne voll und dann begoss er seine neueste Errungenschaft mit solcher Inbrunst, dass ich manches Mal dachte, unser Vater sei eigentlich der geborene Gärtner. Der Duft, der uns dann wochenlang umgab, betörte die Sinne und nicht selten kamen wir uns vor, als wären wir zu Gast in Dornröschens zauberhaftem Schloss, umrankt von einem Meer aus Rosen.
Wie oft saß ich oben auf dem Hopfenberg und genoss den Panoramablick auf mein vertrautes liebes Dorf, umgeben von Fichten und uralten Linden, die ihre langen Schatten über Wiesen und Pfade warfen. Hier konnte man sich nach Herzenslust den Wind um die Nase wehen lassen.
Der Hopfenberg war nicht im eigentlichen Sinne ein Berg, eher ein Hügel. Kleine, blitzsaubere Dörfer und die Stadt Neisse lagen in die umliegenden Täler eingebettet. An der Sandgrube gab es den besten Blick auf das Elternhaus, und stundenlang saß ich da und beobachtete, wie das Licht sanft ums Haus strich, Farben über die Mauern goss und Blüten und Bäume in ihrer ganzen Pracht erstrahlen ließ. Wie verwunschen lagen die Häuser im Sonnenlicht – Tupfen in der Landschaft.
„Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt, dem will er seine Wunder weisen in Berg und Tal und Strom und Feld.“ So schrieb unser von Eichendorff. Er war Schlesier und hatte einst all diese Pracht vor Augen gehabt. Durch Gedichte und Balladen und den reichen Schatz unserer Volkslieder ist mir die Ehrfurcht vor der Schöpfung ins Herz gepflanzt worden und formte mein Wesen mit, eine Ehrfurcht, die bis ans Lebensende wirkt – unveränderlich.
Vom Hopfenberg aus konnte ich das ganze Dorf überblicken. Spielende Kinder tummelten sich draußen, sobald die erste Frühlingssonne schien. Und wie oft turtelten hier oben verliebte Pärchen! Davon zeugten unzählige Herzen mit Initialen, die in die mächtigen Stämme der Buchen geritzt waren, als ewiges Liebesbekenntnis. Aus weiter Ferne strahlte einem die Rathausspitze der Stadt Neisse entgegen. Diese Turmspitze war zum Wahrzeichen der Stadt erkoren, die bei aller Modernität mit ihren vielen altertümlichen Gebäuden noch aussah wie im Mittelalter. Auch die Türme und Türmchen der zahlreichen Kirchen zeichneten sich am Horizont ab – eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch. Neisse, neun Kilometer von uns entfernt, hieß damals nicht umsonst das „Schlesische Rom“ oder die „Stadt der Giebel und Türme“.
Dieses Bild trage ich noch als alte Frau im Herzen. Die unbeschreibliche Natur, die mein Dorf umgab und behütete. Diese Bilder sind aus meinem Leben nicht zu löschen. Die Erinnerungen an die Heimat haben mich nie einsam werden lassen, haben mich unendlich reich gemacht und geben mir bis heute Kraft. Erinnerungen an die Kindheit. Die Zeit der Sorglosigkeit.
Sehr oft habe ich mir gewünscht, wir wären 1933 einfach alle in einen Dornröschenschlaf gefallen und erst nach Ende des Krieges wieder erwacht. Es hätte keiner hundert Jahre bedurft. Und alles ginge einfach seinen normalen Gang weiter: Oma könnte den Kuchen fertig backen, Mutter der Thea ein neues Kleid überziehen und Walter mir endlich das Fahrradfahren beibringen. Vater müsste seine Rosen, die das ganze Haus überwuchert hätten, stutzen und in eine überdimensionale Vase stellen. Und draußen würde die Mohre in ihrem gemächlichen Tempo weiterfließen, während am Ufer die Frösche fröhlich quakten.
Wir Kinder dürften unsere Jugendzeit ganz anders erleben. Stattdessen entwickelte sich ein düsteres Märchen mit bösen Figuren und zwielichtigen Gestalten, die vor allem die junge Generation in einen dunklen, undurchdringlichen Wald führten, aus dem viele nicht wieder hinausfanden. Da nützten auch keine weißen Kieselsteine. Dieses tote Geäst hatte nichts mit dem lichten „Kinderwald“ gemein, der uns schützend zwischen seinen Bäumen aufnahm und auf dessen bekannten Pfaden und vertrauten Wegen wir sicher nach Hause wandelten.
Mein großer Bruder war mein Beschützer. Nichts schien sein Gemüt zu trüben, immer strahlten seine Augen und sein Lächeln ließ im Frühjahr den Schnee schmelzen, wie Oma zu sagen pflegte. Und doch, ein Ereignis ist bei ihm haften geblieben. Immer wieder wurde es in Familienrunden erzählt.
Walter war gerade vier Jahre alt und hatte von Oma einen roten Luftballon geschenkt bekommen. Es war sein erster Kirmes-Besuch. Er verlor den Luftballon aus der Hand und dieser flog davon. Alle strahlten dem dahinschwebenden roten Ballon hinterher, der sich immer weiter in den Himmel erhob, bis er irgendwann von einer Wolke verschluckt wurde. Die Menschen lachten, doch Walter stand in der Menge und weinte bittere Tränen. Er war so unglücklich, dass er den Vorfall auch Jahre später nicht vergessen hatte. Und genau dieses Gefühl – in einer Menge zu stehen und sich doch gänzlich allein und verlassen zu fühlen – das sollte ihm eines Tages zum Verhängnis werden.
Nicht selten bettete Walter den Kopf an einen Stamm und lauschte dem Rauschen der Blätter, floh nicht nur vor seinen Schwestern, die ihn regelrecht belagerten, wenn sie die Hilfe des großen Bruders benötigten, sondern auch vor der Schule. Er hatte gewaltige Probleme, konnte nicht stillsitzen, sich einfach nicht konzentrieren. Sei es der Vogel, der draußen auf der Fensterbank hockte, sei es eine Wolke, die besonders schön geformt war, oder der nächste Streich, den er ausheckte – seine Gedanken wanderten wie durch ein großes Bilderbuch. Oft setzte er sich auf die kleine, von Efeu überwucherte Laube, die wie verloren vor dem Bahngleis unter einer Linde stand. Mit der Uhr in der Hand wartete er auf die Züge, die vorbeifuhren. Er kannte jeden Zug. Er wusste immer genau, zu welcher Uhrzeit welche Kleinbahn vorbeifuhr – und dass eines Tages er selbst in einem dieser Züge sitzen würde, um in die Welt hinauszuziehen.
Die Schule mit ihren klaren Regeln und Vorschriften raubte ihm die Luft zum Atmen. Die trockene Kreide zerbröckelte in seiner Hand. Die Feder seines Füllers war immer verbogen, alle seine Hefte zeugten mit ihren hässlichen Tintenklecksen wie ein mahnendes Zeugnis von seiner Unordentlichkeit. In dem engen Raum mit den 30 Kindern konnte er keinen klaren Gedanken fassen. Meine Eltern waren oft verzweifelt. Zeugnisse im heutigen Sinn wurden nicht geschrieben, erst das spätere Schulentlassungszeugnis gab Aufschluss über erbrachte Leistungen. Dennoch wurde eine Art Bewertung vorgenommen: Die nicht guten Schüler mussten ganz vorn sitzen, während die besseren hinten Platz nehmen durften.
Walter saß immer in der ersten Reihe. Sehnsüchtig blickte er zum Fenster hinaus. Die Welt da draußen war so viel reicher!
Eines Morgens brachte der Vater ihn persönlich in die Schule. Damit der Weg durch den Wald ihn ja nicht zu anderen Abenteuern verführte. Während Vater sich mit dem Lehrer unterhielt, dem guten alten Herrn Gebauer, der seinem Zögling großes Verständnis entgegenbrachte, war Vater sich sicher, dass er den Bengel ordnungsgemäß abgeliefert hatte und dieser nun für den Vormittag seinen Platz einnahm. Dass es eine Hintertür gab, zu der Walter sich noch während des Gespräches langsam hinbewegte und durch die er sich hinausschlich, hatte Vater offensichtlich vergessen. Walter war schneller wieder im Wald als Vater. Er kletterte auf sein Baumhaus und zog einfach die Strickleiter hoch.
Wie oft stand ich unten, spähte in das dichte Laubwerk und kam nicht hinauf zu meinem großen Bruder in das grüne Blätterdach. Stattdessen legte ich ein Ohr an den Baum, eine uralte Eiche, schaute hinauf in die Krone, die sich in den sachten Windböen wiegte, und hörte das leise Rauschen, einem Murmeln gleich; wie Stimmen, die flüsternd auf mich einredeten.
Er selbst blickte über die Wipfel hinweg und schnitzte Messer, die er später gegen andere nützliche Dinge eintauschen konnte. Als er mich einmal mit nach oben nahm, konnte ich seine Sehnsucht verstehen.
„Kennst du die Geschichte vom Vogel Greif?“, fragte er flüsternd.
Ich schüttelte den Kopf und sah in seine blauen Augen, die wie zwei Bergseen schimmerten.
„Er war der Schrecken des ganzen schlesischen Landes und wohnte wie ich auf einer Eiche. Alles verbarg sich vor ihm, so sehr fürchtete man den Vogel Greif. Kein Mensch wagte es, in die Nähe seines Horstes zu kommen. Er konnte mit seinen gewaltigen Klauen einen ausgewachsenen Ochsen davontragen! Den gab er seiner Brut zu fressen!“
„Einen ganzen Ochsen?“, flüsterte ich und schaute mich um, ob nicht irgendwo der Vogel Greif lauerte.
„Ja, und etliche Schafe und Ziegen! Und eines Tages begann er sogar Kinder zu rauben.“
Ich schluckte.
„Kleine Kinder.“
Ich spähte zu Boden.
„Doch der König rief: Wer den Vogel Greif töte, der werde seine Tochter zur Frau bekommen! Und ein junger Bursche, der ganz allein lebte, der beobachtete den Vogel Tag und Nacht. Er verstand die Zeichen der Natur und hörte in der Nacht die Stimmen des Waldes und so wusste er, wann der Vogel Greif seinen Horst verließ. Im richtigen Augenblick schlug er zu, legte ein gewaltiges Feuer und verbrannte das Nest. Der Vogel Greif wurde furchtbar wütend, versuchte das Feuer zu löschen, verbrannte aber mit seinem Nest und der junge Bursche konnte dem König den Vogel übergeben. Fünf starke Ochsen mussten das tote Tier zum Schloss schleifen, so schwer und mächtig war es. Der König hielt Wort und der Bursche vermählte sich mit der schönen Tochter. Und wenn jemals wieder ein Vogel Greif zu uns nach Schlesien kommt, dann sitze ich hier oben und kann ihn beobachten! Ich kenne jeden Baum hier und werde uns alle von dem Ungeheuer befreien! Und deswegen, Hanna, kann ich nicht in der Schule sitzen. Stell dir vor, der Vogel Greif kommt just in dem Moment hier zu uns in den Wald!“
„Nicht wahr“, sprudelte es aus mir heraus, „du passt schon auf, dass er nicht wieder kleine Kinder frisst, oder?“
Walter hob die Hand, zeigte ein großes Indianerehrenwort und versprach, immer auf mich aufzupassen. Ich atmete auf. Mein großer Bruder! Er würde mich beschützen.
Rasch kletterten wir hinunter und rannten durch den Wald bis zur Mohre, wo wir die Schuhe auszogen, um die Füße ins Wasser zu tauchen. Die Mohre, ein kleiner grüner Gebirgsbach, in dem Walter, der Schule wieder einmal glücklich entronnen, oft angelte. Glücklich bescherte er uns einen Weißfisch oder Forellen, die Mutter immer stolz zubereitete. Sie glaubte an ihren Sohn, war sicher, dass seine Zeit noch kommen würde. Er sei ein Kind der Natur und das rege seine Phantasie an, tröstete sie sich immer.
Sobald es warm war, liefen wir barfuß durch die Gegend, ein ungezwungener Zustand, der auf dem Land noch weit verbreitet war. Die Alten betrachteten das Barfußlaufen als wertvollen Gesundheitsschutz und wir Jungen fügten uns gern. Im Sommer sprangen wir in den Fluss oder See. Wer nicht schwimmen konnte, schnallte sich einen Korkgürtel um den Bauch. Oder man behalf sich mit auf eine Schnur gefädelten Keksdosen auf dem Rücken. Das schepperte und gab eine ordentliche Geräuschkulisse ab, die nur von unserem Geschrei übertönt wurde. Viel Spielzeug gab es bei uns nicht. Die Jungs besaßen ihren Kreisel, den sie mit einer kleinen Peitsche vorantrieben, manch einer vielleicht auch ein Metallauto der Marke „Märklin“, aber ein Messer war wichtiger. Damit konnte man sich eine ordentliche Angelrute schnitzen. Bunte Jo-Jos waren bei allen beliebt, viele Mädchen besaßen eine Puppe, vielleicht einen kleinen Puppenwagen, aber wir nutzten eher das große Angebot der Natur, wenn wir uns aus allen Dörfern zusammenrotteten.
Natürlich gab es auch die harten und kalten Winter, die sich die eine oder andere Seele gnadenlos einverleibten. Geburt und Tod, Leben und Sterben, auch das gehörte zu unserem Alltag. Die Geburt eines neuen Erdenbürgers verfolgten wir mit dem gleichen Interesse wie das Sterben eines Menschen.
Wurde ein Kind geboren, brachte man unter Gesang Blumen, Körbe mit Eiern, Honig und eine Kanne frisch gemolkener Milch. In dem Haus, in das die Trauer eingekehrt war, schmückte man unter anderen Gesängen den Toten mit Blumen. Die Frauen wuschen ihn, wir Kinder beobachteten neugierig, ob der Verstorbene nicht doch unter den geschlossenen Lidern hervorlinste. In beiden Fällen wurde ausgiebig Pastinakenschnaps getrunken, dazu gab es Suppe mit selbst gemachten Nudeln sowie Schlesisches Himmelreich: Klöße gefüllt mit Backobst und Schweinefleisch. Anschließend gab es den Schlesischen Mohkucha.
Am Ende waren wir Kinder nie ganz sicher, welcher Anlass der traurige und welcher der fröhliche war. Die Erwachsenen waren in beiden Fällen irgendwann so außer Rand und Band, dass wir weder vor einer Geburt noch vor dem Tod sonderlich Angst hatten. Beides schien ein rauschendes Fest wert zu sein, bei dem die Dorfkapelle aufspielte.
So blieb das geliebte Dorf in unseren Kinderseelen für lange Zeit eine wunderbare, intakte Gemeinschaft, in der man sich gegenseitig half. Neben den reichen Gutsbesitzern, denen selbstverständlich das beste Ackerland gehörte und die diverse Weiden und Waldungen ihr Eigen nennen konnten, besaßen die meisten von uns ein paar Morgen Land zum Bewirtschaften. Zudem die obligatorischen Kühe, Schafe, Schweine und Hühner, die versorgt wurden, meist für den eigenen Bedarf. Und wer etwas übrig hatte, sah zu, dass er sich am Wochenende mit seinen Waren und Vieh auf dem Markt tummelte.
Bei den meisten gab es auch ein paar Kinder aufzuziehen. Viele gingen nebenbei noch zum Arbeiten in die Fabriken in der Stadt, sodass der Rhythmus des typischen Landlebens leicht verändert, aber auch alte Ansichten durchbrochen wurden. Bei uns im Dorf setzte sich in der Mode wie in der Sprache ein gewisses städtisches Flair durch. Und interessanterweise waren es die Frauen, die davon profitierten. Kaum eine der Jüngeren trug noch lange Haare. Die meisten hatten sich dankbar von den alten Zöpfen getrennt, was sich für die Arbeit auf dem Land als Segen erwies.
Friseur Gustav war hocherfreut über all die abgeschnittenen Haare. Er nutzte sie für die Puppen, die er in seiner freien Zeit herstellte. Mit echtem Haar bekamen sie ein fast menschliches Aussehen. So gut wie jedes Mädchen besaß so eine Puppe, mit Haar, das vielleicht von der Mutter stammte, von der Tante oder der älteren Schwester.
Für den mittlerweile allseits bekannten mondänen Look reichte die Zeit vielleicht nicht, aber an Feiertagen versuchte man auch der neuen Mode gerecht zu werden. Knielange Kleider und das kecke Hütchen auf dem Kopf wurden hier genauso gern getragen wie in der Stadt. Man galt als aufgeklärt und die meisten fuhren regelmäßig in die Stadt, die mit der Kleinbahn schnell zu erreichen war. Das änderte sich natürlich in jenen Jahren, die auch hier alles zerstörten. Wir Landmenschen waren – anders als die Städter – trotz allem noch vielen alltäglichen Dingen unterworfen, wir mussten Kühe melken, schlachten, säen und ernten und mit den Jahreszeiten zurechtkommen. So schnell konnte man uns nicht indoktrinieren. Lange hatte noch der Glaube an Gott Macht über uns, doch auch der wurde uns allmählich genommen.
Die Menschen im Neisser Land waren überwiegend katholisch. Das Kirchenjahr bestimmte den Lebensrhythmus. Mit ihrem kräftigen Geläut riefen die Glocken uns zur Messe, mahnten die Seelen, sich im stillen Gebet zu läutern.
Um sieben begann die Frühmesse in der großen roten Backsteinkirche, die im gotischen Baustil gehalten war. Ihr schlanker, hoher Turm ragte gen Himmel wie der Zeigefinger Gottes. Oma ging immer zur Messe, war immer als Erste auf den Beinen. Die Bibel war abendliche Pflichtlektüre, Oma las uns daraus vor. Wir saßen da und lauschten den schaurigen Geschichten, die uns lehren sollten, unser Dasein in Demut und Dankbarkeit gottesfürchtig zu fristen. Das hielt vor bis zum nächsten Morgen und schon lief man mit seiner kindlichen Neugier in den neuen Tag hinaus und wartete auf das nächste Abenteuer. Es wurde gewerkelt und gebetet, man zog die Kinder groß und verrichtete seine Arbeit, je nach Jahreszeit, auf dem Feld oder dem Hof. Alles vertraut, alles in guter alter Tradition.
Am Sonntag trafen sich alle bei der Messe. Für viele war das die einzige Möglichkeit, Neuigkeiten auszutauschen, ihren neuen Hut oder das schicke Kleid auszuführen. Und nicht selten kamen nach der Messe viele zu uns nach Hause. Der Sonntag war der Tag, an dem man bei Anna Gröger einkehrte.
Pfarrer Bredow war ein strenger, allseits gefürchteter Mann, der seine Schäfchen gut unter Kontrolle hatte, sodass die ersten Einflüsterungen durch die NSDAP wohl bei dem einen oder anderen ihre Wirkung zeigten, aber nicht diese Macht über Andersdenkende bekamen wie schon in vielen anderen Dörfern. Bredows hochgewachsene Gestalt in der schwarzen Soutane, die ihn noch größer erscheinen ließ, war ehrfurchtgebietend. Durchdringende grüne Augen beherrschten sein fahles Gesicht und blickte er einen prüfend an, glaubte man sich schon ohne Beichte bei seinen Sünden ertappt. Nicht selten prasselten seine Predigten wie ein Strafgericht auf die verschüchterte, bestürzte Gemeinde hernieder und besonders in den Anfängen der nationalsozialistischen Zeit mahnte er die Menschen immer wieder zur Vernunft.
Stille Nacht
Ende 1932 hätten die Erwachsenen aus heutiger Sicht vieles vielleicht erahnen können, aber Weihnachten, das Fest der Liebe und Vergebung, war erst einmal wichtiger als die große Politik, die doch eher in den Städten gemacht und gelebt wurde. Das ganze Dorf bereitete sich auf diesen Abend vor und dort hatte die Politik nichts zu suchen. Alljährlich war das Christfest der Höhepunkt unseres Lebens in und mit der Natur.
Am Heiligen Abend gab es immer Kartoffeln, schlesische Weißwürstchen mit Pfefferkuchen, mancherorts auch mit Pastinakentunke. Und natürlich unsere geliebten Pulsche Klumpa, polnische Klumpen, auch Pfefferkuchen genannt. Meine Mutter buk, zusammen mit Oma, eine Riesenmenge davon. Erst wurden Plätzchen ausgestochen und mit Mandeln oder Schokostreuseln verziert, aus dem restlichen Teig formte sie kleine Kugeln, die sie eng aneinander auf das Backblech setzte, und dann schob sie alles in den riesigen Ofen, der jeder Bäckerei Ehre gemacht hätte. Auf der Ofenbank kühlte inzwischen der duftende goldbraune Rührkuchen ab, der bei uns in Schlesien Sieste genannt wurde. Wir Kinder halfen eifrig mit und durften in dieser Zeit dermaßen oft die Töpfe ausschlecken wie sonst das ganze Jahr über nicht. Während an den Fenstern filigrane Eisblumen wuchsen, glühten im Innern die Öfen und der Duft von Gewürzen und Süßem hing schwer in der Luft.
In der geräumigen Küche, in der wir die meiste Zeit verbrachten, dominierte die Feuerstelle. Auf die vordere Kante setzte man uns Frostklumpen, nachdem wir stundenlang im Schnee getobt hatten; die Füße wurden auf die Wasserwanne gestellt und ganz langsam begannen die Zehen zu kribbeln, dann ließen sie sich tatsächlich wieder bewegen und schließlich glühten sie wie Kohlen.
Der große Tisch, an dem wir alle Platz fanden, stand genau unter dem Herrgottswinkel, der natürlich geweiht war. Ein typisch katholischer Brauch: Über den Köpfen hing ein kunstvoll geschnitztes Kreuz mit unserem Heiland.
Die Waschküche, ein kleiner Nebenraum, war mit einem großen Wasserkessel ausgerüstet, unter dem wie im Herd mit Holz und Kohlen Feuer gemacht werden konnte. Mittels eines Schlauchs wurde der Kessel direkt vom Wasseranschluss aus gefüllt. Wenn Mutter und Oma Waschtag hatten, wurde der Ofen mit Holz und gepressten Briketts gefüttert, bis die Flammen schmatzend gegen den Kessel schlugen. Die wabernden Dampfschwaden trieben einem selbst im tiefsten Winter den Schweiß auf die Stirn. Und es war Knochenarbeit, die die Frauen dort vollbrachten. Mit der Hand rieben sie die Kernseife in den Stoff, mit Hilfe des guten alten Waschbretts, bis die Finger rot waren oder gar wundgescheuert bluteten. Und wenn das Wasser nicht reichte, mussten sie mit großen Eimern, die je zehn Liter fassten, raus zur Pumpe laufen, die Eimer füllen und ins Haus schleppen. Eine schwere körperliche Arbeit, die sich heute kaum noch jemand vorstellen kann. Mutter benutzte schon Soda und Waschflocken, Oma dagegen schwor zeit ihres Lebens auf die traditionelle Aschenlauge.
Das war ein Gemisch aus einem Viertel Asche und drei Vierteln heißem Wasser, das durch ein Tuch gefiltert wurde, bis es gebrauchsfertig war. Oma schrubbte auch ihre Holzgefäße und Möbel mit dieser Lauge. Nicht selten bearbeitete sie die Holzböden mit Scheuersand und der Lauge, bis das Holz glänzte. Diese eigensinnige Frau bestand nun einmal auf ihren alten Ritualen. Da half es auch nichts, dass meine Mutter ihr die neuen Sodaflocken vorbeibrachte. Oma blieb beim Althergebrachten.
Kernseife wurde für alles benutzt. Sie diente nicht nur zum Waschen, sondern auch als Shampoo und Lotion für uns Kinder. Mit einem großen Schwamm wurde sie über den Körper verteilt, danach wurde mit einem großen Schöpfer Wasser über den Kopf gegossen, um den Schaum aus den Haaren auszuschwemmen. Das geschah jeden Samstag oder, wie heute, direkt am Heiligen Abend, bevor es dann endlich in die gute Stube ging. Natürlich mussten wir es vorher schaffen, uns nicht wieder zu zanken oder uns schmutzig zu machen. Geduldig harrten wir vor der Tür aus.
Die Stube war immer blitzblank. In einer Ecke stand ein hoher, glänzend-grüner Kachelofen, aus dem es an Sonn- und Feiertagen anheimelnd knisterte. Ein seidener Wandschoner hing hinter dem weinrot bezogenen Sofa. Die ebenfalls seidenen Kissen waren mit bunten Paradiesvögeln bestickt. Diese guten Stücke hatte unsere Oma bei einem reisenden Chinesen erstanden, der hier in der Gegend seinen Handel trieb. Von Zeit zu Zeit kam er durch die Neisser Dörfer und wurde von uns Kindern wegen seines exotischen Aussehens immer aufs Neue angestarrt und ausgelacht. Aber Herr Chang sah mit seinem unergründlichen asiatischen Lächeln großzügig darüber hinweg. Geduldig präsentierte er seine Waren und wir bestaunten all die Dinge, die er bei sich trug.
Auf der Anrichte waren die hölzernen Krippenfiguren aufgestellt, die Walter zusammen mit Großvater vom Dachboden geholt hatte. Tannenzweige und Moosfladen dienten als Zierde und Unterlage, Strohsterne hingen von der Decke herab. Diese Figuren hatte Großvater einst als junger Mann für die Oma geschnitzt und ihr und seinen zukünftigen Schwiegereltern eines Weihnachtsabends stumm auf den Gabentisch gestellt. Und dann hielt er stotternd um ihre Hand an. Noch immer sahen sie einander verschämt an, wenn die Figuren vorsichtig aus dem raschelnden Papier ausgepackt und auf der Anrichte gruppiert wurden. An manchen Stellen war die Farbe abgesprungen, aber sie waren wunderschön und zeugten von einer wahren und ewig dauernden Liebe.
Auch wenn das Haus schon mit elektrischem Licht ausgestattet war, dominierten am Heiligen Abend doch Mutters rote Kerzen, die mit ihrem sanften Licht alles in eine Märchenwelt verwandelten.
Wir Kinder fieberten fast bis zur Übelkeit der Bescherung entgegen. Das seit Tagen unter viel Geheimniskrämerei verschlossene Zimmer öffnete sich, nachdem ein heller Glockenton von drinnen uns ermahnt hatte, still zu sein, weil das Christkind gerade dabei war, sich zurückzuziehen, um auch der Nachbarschaft seine Aufwartung zu machen. Stumm und voller Ehrfurcht trotteten wir in den Raum und versuchten, noch einen Blick auf das davoneilende Christkind zu werfen. Aber es war bereits spurlos verschwunden. Wie schon im Vorjahr.
Wir Kleinen sagten unsere Gedichte auf. Thea sprach ihren Text perfekt. Mit ihren glühenden Wangen sah sie aus wie die heilige Madonna in der Kirche. Ich war dermaßen aufgeregt, dass ich zu stottern begann und statt meines Gedichts das Rezept für den Rührkuchen aufsagte, unseren Sieste, das Oma immer vor sich hingemurmelt hatte, während sie die Zutaten aus der Kammer in die Küche holte. Mein Weihnachtsbeitrag wurde anerkennend aufgenommen und dann sangen wir gemeinsam Stille Nacht. Danach durften die Geschenke ausgepackt und besichtigt werden. Opa nuckelte zufrieden an seiner Pfeife und schwelgte in Erinnerungen. Vater spielte dazu auf seinem Lieblingsinstrument, der Trompete, bis die Ziegen und Fritz aus dem Stall einfielen und wir ein regelrechtes Weihnachtskonzert geschenkt bekamen. Dazwischen rumpelte Oma mit der Kaffeemühle und zum frisch aufgebrühten Kaffee wurden heiße Mohnklöße serviert.
In der Ecke erstrahlte mit Kerzen, Lametta und bunten Kugeln der Weihnachtsbaum. Ganz nach schlesischer Art und Weise waren Vater und Sohn in den Wald marschiert und hatten ihn gemeinsam geschlagen. Ein heiliger und weihevoller Akt, den Walter liebte, und dieses Mal war er mehr als stolz, denn er hatte zusammen mit Vater die Säge halten und staunend zusehen dürfen, wie der Baum langsam zur Seite kippte und schließlich krachend auf den Boden aufschlug. Das bisschen Licht, das die Petroleumlampe gab, ließ die majestätischen Schatten des Waldes über ihnen schweben, während wirbelnde Schneeflocken funkelten wie kleine Kristalle.
So richtig ruhig wurde es in dieser Nacht bei uns nie. Und geschlafen hat schon gar keiner. Ich habe jahrelang überlegt, ob man den Text „… alles schläft, einsam wacht…“ nicht lieber ändern sollte.
Walter bekam einen neuen Füllfederhalter und eine Mundharmonika. Während er dem Füller keine weitere Beachtung schenkte, strahlte er beim Anblick des silbernen Instruments übers ganze Gesicht, denn er war sehr musikalisch. Das hatte er von Vater, der darauf nicht wenig stolz war. Sah er doch, dass ein bisschen gutbürgerliches Erbe auf den Sohn übergegangen war. Noch am selben Abend konnte Walter sein erstes Stück spielen. Zuvor hatte er schon ein paar Jahre Geigenunterricht genommen, doch auch hier war bei aller Musikalität der strikte Ablauf der Übungsstunden nicht seine Welt gewesen, sodass Vater den Traum, wenigstens seinem Sohn eine Karriere als Musiker zu ermöglichen, aufgeben musste.
Am Abend durften wir Kinder Zoka-Zola trinken, heute als Coca-Cola bekannt. Dazu schleckten wir alle Sorten Frigo-Brausepulver aus der Handfläche, bis uns schlecht wurde.
Später begaben sich Vater und Opa in den Garten. Einer alten mystischen Weisheit folgend glaubte man hier in Schlesien, dass den Pflanzen und Tieren übernatürliche Fähigkeiten zufielen. Die Säfte all der entblätterten Obstbäume, so starr und tot sie auch in den Fesseln des Winters gefangen schienen, sollten sich am Heiligen Abend mit geheimnisvollem Weben zur künftigen Frucht mischen. Vater umwickelte jeden Stamm mit einem Kranz aus jenem Stroh, das während des weihevollen Nachtmahls unter dem Tischtuch ausgebreitet gewesen war. Das versprach eine reiche Obsternte.
Die Tiere bekamen die Essensreste. Oma erzählte, dann würden sie in der folgenden Nacht auf wundersame Weise die Fähigkeit erlangen, mit unserer Sprache die Zukunft zu deuten. Sie zu belauschen sei allerdings äußerst gefährlich, ja könne gar den Tod bringen. Es gab eine Sage, der zufolge sich ein Horcher im Stall verbarg und die Tiere belauschte: „In drei Tagen fahren wir unseren Herrn zum Friedhof hinaus!“, murmelten sie einander zu. Und so geschah es. Vor lauter Schreck blieb dem Lauscher das Herz stehen und wie vorausgesagt wurde er drei Tage später bestattet.
Pünktlich um Mitternacht ging es zur Christmette, denn in dieser Nacht wurde die heilige Kommunion empfangen.
„Das tut dem Seelenheil wohl“, erklärte Oma, nahm ein umhäkeltes Taschentuch aus dem Muff, das sie nur zu besonderen Anlässen nutzte, und betupfte sich würdevoll die Mundwinkel.
Durch den Schnee stapften wir den Weg zum Berg hinauf, wo die Kirche über allem thronte. Walter und Peter zogen ihre Schlitten hinter sich her. Ehrfürchtig betraten wir die Kirche. Der Kronleuchter, in prächtigem Blau-Gold, das sich in der Kassettendecke wiederholte, erstrahlte im feierlichen Glanz. Die Seitenschiffe füllten sich mit all den vertrauten Menschen aus dem Dorf, die sich festlich herausgeputzt hatten. Vater trug seinen guten alten Frack, Mutter ihren neuen Filzhut. Geschrubbte Gesichter glühten mit den Kerzen um die Wette.
Dann endlich, alles war still geworden, schritt der Pfarrer zum Altar. Ich liebte diesen sakralen Moment! Ich spähte zu meinem Bruder hinüber. Nachdenklich sah Walter auf das große Kreuz, an dem unser Jesus hing. Der schmerzverzerrte Gesichtsausdruck, das Leiden, der gen Himmel gerichtete Blick – all das berührte ihn wohl. Stumm ließ er das Schicksal des Heilands auf sich wirken. Selten habe ich ihn so versunken gesehen. Papa nahm meine Hand in die seine und ich betete inbrünstig in der Hoffnung, dass das Jesuskind mich auch nächstes Jahr wieder aus der Krippe heraus anstrahlen möge. Thea sang mit heller, klarer Stimme den Choral und Mutter drückte die Hand ihres Vaters.
Von der Kanzel wurden mahnende Worte gesprochen. Dass keiner die Nächstenliebe vergessen solle. Worte, die in den folgenden Jahren eine gespenstische Bedeutung bekamen. Doch am Ende ließ sich auch der Pfarrer von der friedlichen und feierlichen Stimmung anstecken und so stob die Gemeinde beseelt aus dem Gotteshaus, hinaus in die klirrende Kälte.
Auf dem Heimweg wurden die Schlitten aneinander gebunden und wir Kinder sausten unter wildem Geschrei und Geheul zurück ins Dorf. Den Worten „Stille Nacht“ zollten wir auch hier keinen Respekt.
Da Mutters Geburtstag am ersten Weihnachtstag folgte, kamen alle gleich nach der Messe zu uns: Freunde, Nachbarn sowie meine Tante Irmtraud und Onkel Ernst mit ihren drei Kindern Seppel, Tordis und Annika. Seppel war zwei Jahre älter als Walter, Tordis in meinem Alter und Annika gerade geboren. Die Stube füllte sich mit Geplapper und Gelächter und irgendwann stellte Opa das Koffergrammophon an und kurbelte eifrig am Aufziehmechanismus. Vater legte Platten auf und die Erwachsenen tanzten ausgiebig. Oma servierte Kaffee, Grog, Striezel und schlesische Mohnklöße, es wurde geschlemmt und gebechert. Vater holte dann noch seine Trompete hervor, begleitete gekonnt die Melodie, alles klatschte dazu im Takt und nach kurzer Zeit stieg Zigarettenrauch bis unter die Decke. Wir Kinder stahlen uns davon und rannten durchs Dorf, lugten in die Fenster und beobachteten, wie die anderen feierten. Bei dem einen oder anderen machte es den Anschein, als würde der Alkohol für ziemlich ausgelassene Stimmung sorgen. Wenn das Pfarrer Bredow wüsste!
Und am nächsten Morgen saßen sie stumm und müde in der Frühmesse. Pfarrer Bredow behauptete immer, das sei eine der ruhigsten Messen, die er im Jahr abzuhalten habe.
Der Aufbruch zum obligatorischen Besuch bei Oma Rotraud folgte noch in der frühen Morgendämmerung. Hier trafen wir auf die Geschwister meines Vaters, die ebenfalls mit ihren Kindern vorbeischauten. Das Verhältnis hatte sich nie ganz erholt; es blieb immer eine unerklärliche Spannung im Raum, wenn mein Vater auf seine beiden jüngeren Brüder traf. Sie hielten sich nach wie vor für etwas Besseres und ließen das meine Mutter sehr wohl spüren. Doch sie konnte das inzwischen mit einem tapferen Lächeln abwehren.
In Großmutter Rotrauds gediegenem Zimmer fand die Weihnachtsbescherung statt, die immer alles übertraf, was wir je gesehen hatten. Selbstgestricktes, gekaufte Anziehsachen nach dem letzten Chic, Spielzeug, Bücher, Pfefferkuchen und vieles mehr. Und für die Eltern gab es in diesem Jahr einen Fotoapparat, eine moderne Boxkamera. Mutter freute sich besonders über dieses exklusive Geschenk. Nun könne sie endlich unsere Familiengeschichte in Bildern festhalten, rief sie aus. Während wir alles bestaunten, setzte sich Großmutter Rotraud an das Klavier, klappte den Deckel hoch und spielte Oh du fröhliche, bis alle einfielen. Nach dem Kaffeetrinken, das sich bis zum Abend hin dehnte, zogen wir Mohrauer wieder unseres Weges. Erst mit der Straßenbahn durch die belebten Straßen mit ihren Droschken und Automobilen, bimmelnden Fahrrädern und den vielen Menschen, die flanierend die Auslagen in den großen Schaufenstern betrachteten. Dann ging es weiter mit unserer vertrauten Kleinbahn in die ländliche Heimat, wo wir durch den hohen Schnee stapften und Lieder sangen, bis wir spät am Abend endlich zu Hause ankamen.
Als die Eltern uns später zudeckten, erinnerten sie uns daran, dass dies die erste der schaurig-schönen Raunächte war. Mit dem Null-Uhr-Glockenschlag begann die Zeit „zwischen den Jahren“ und sie endete am 6. Januar ebenfalls mit dem mitternächtlichen Glockenschlag. Diese nun folgenden zwölf Tage und Nächte sollten den Neubeginn symbolisieren. Mutter berichtete, warum sich um diese geheimnisvolle Zeit so sonderbare Bräuche rankten.
Der Begriff „rau“ bezog sich auf das Ausräuchern der Stuben und Ställe, um böse Geister zu vertreiben, von denen es angeblich in der als mystisch bezeichneten fünften Jahreszeit nur so wimmelte. Draußen war es eisig kalt, tiefdunkel und wüst. Angsteinflößende Gestalten verjagten die heilige Stille und eine unheimliche Stimmung legte sich einer Haube gleich über das schneebedeckte Land. Oma durchschritt jeden Tag Haus und Stall, murmelte ihre Beschwörungsformeln und wirbelte mit verschiedenen Harzen, Weihrauch und Kräutern so lange den Rauch herum, bis die Augen nur so tränten. Sie wollte all die bösen Kräfte aus dem Haus treiben. Die Tiere gaben missmutige Laute von sich und noch wochenlang roch es selbst im Stall nach Weihrauch. Aber ehrfürchtig ließen wir sie gewähren. Oma wusste auch zu erzählen, dass der alte sagenumwobene Gott Wotan nun auf Erden seine schaurigen Gefährten zur wilden Jagd vorwärtspeitschte und sie dabei all die verlorenen Seelen einfingen, die ihren Frieden noch nicht gefunden hatten. Ihr Jammern drang mit dem heulenden Wind pfeifend über die Dächer, sie zerrten und zogen an den Fensterläden, bis diese sich klappernd und schlagend wehrten, um uns im Inneren des Hauses zu schützen. Aber dieses unheimliche Treiben schenkte unseren Äckern auch neue Fruchtbarkeit. Tanzte Wotan mit seinem Gefolge auf den Feldern, so weckte er mit seinem Stampfen die Erde auf. Und nur so konnte das Korn erst richtig wachsen und gedeihen.
Die Rückkehr der Sonne bedeutete für uns auch die Rückkehr des Lebens. Nach den langen Nächten und dunklen Tagen brach nun wieder die Zeit des Lichts an.
Für die letzten sechs Nächte des alten Jahres und die ersten sechs des neuen galt: Was wir in jenen Nächten träumten, sollte in Erfüllung gehen. Ein vorchristlicher Aberglaube und uraltes Brauchtum, dem wir alle anhingen.
Walter etwa wünschte sich: Einmal im Ring stehen! Unsterblich werden wie sein Idol Max Schmeling. Und er nahm sich jede Nacht vor, von seinen späteren Siegen zu träumen.
So klang das Jahr 1932 aus. Der Winter schüttete unaufhörlich seine filigranen Schneeflocken aus, bis sich die sanfte Landschaft einer wohligen Decke gleich ausbereitete. Die träge Ruhe und Stille trug uns ins neue Jahr, das natürlich ausgiebig begrüßt wurde. Und irgendwie schien für einen Moment die Zeit stehenzubleiben. Nur zögerlich kroch das neue Jahr aus der Schale des alten heraus, häutete sich wie eine Schlange, bis es sich nackt und schutzlos einer Zukunft aussetzte, die niemand erahnen konnte.