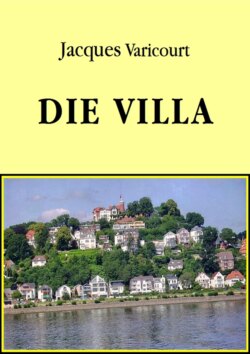Читать книгу Die Villa - Jacques Varicourt - Страница 4
Wiedersehensfreude
ОглавлениеEs fällt mir schwer, jetzt, im Nachhinein, Gründe dafür zu finden, warum ich Deutschland im Jahre 1914, am Vorabend des ersten Weltkrieges verlassen habe, aber die Ereignisse die mich damals betrafen, machten dieses nun einmal dringend erforderlich. Und wahrscheinlich hängt es auch mit meinem Geburtsjahr zusammen – 1895. Einige, wirkliche, gute Freunde und Klassenkameraden die in genau demselben Jahr das Licht der Welt erblickten, waren auf ihre ganz bestimmte- und persönliche Weise dem Schrecken der Fronten leider „nicht“ davongekommen, sie starben für Kaiser und Gottes Vaterland. Ich für meinen Teil befand mich in den Sommermonaten 1914 in den Vereinigten Staaten von Amerika, an der Ostküste. Meine Eltern besuchten mit mir und meiner Schwester Verwandte; außerdem hatte mein Vater etwas Geschäftliches zu regeln, welches ihm von größter Notwendigkeit erschienen war, trotz der angespannten Situation.
Mit meinen neunzehn Jahren hatte die fremde Sprache, das fremde Land, die neue Kultur, die Unverkrampftheit im alltäglichen Leben, das Wesen der Menschen der Neuen Welt, einen tiefen sowie bleibenden Eindruck auf mich gemacht, und als es sicher war, dass Deutschland Krieg machen würde, entschlossen sich meine Eltern in den USA zu bleiben. Für mich und meine Schwester – Melanie, die ein Jahr jünger war als ich, kam das alles sicher mehr als nur überraschend, aber wir fanden uns mit der gegebenen Situation so gut wie es uns möglich war ab. Es wäre quälend die Kriegsjahre in den USA ausführlich zu beschreiben, besonders dann, wenn man einen falschen Namen annehmen musste, nur um in Frieden leben zu können. So versuche ich mich auf meine persönliche Heimkehr nach Hamburg im Jahre 1920, Anfang Januar, zu beschränken.
Ich kam also über Bremerhaven mit dem Schiff aus Übersee an, wechselte in den Zug nach Hamburg, ließ mein mageres Gepäck von einem Bahnhofsburschen verstauen, setzte mich auf meinen Platz am Fenster, versteckte mich hinter einer Zeitung, und schon verließ die Lok samt Reise- und Gepäckwagen, im Dampf eingehüllt, gespenstisch wirkend, den Bahnhof. Ich saß allein in meinem Abteil, allein mit meinen Gedanken an Amerika, an Melanie und an meinen erst kürzlich verstorbenen Vater, der nun in amerikanischer Erde ruhte, weil er es so in seinem Testament bestimmt hatte. Meine Mutter war auch in Amerika geblieben, sie hatte Angst gehabt den Boden der Heimat, erneut, nach all den vielen Jahren, zu betreten. Und Melanie? Sie hatte geheiratet und war glücklich. Sie verzichtete ebenfalls auf eine Konfrontation mit Dingen in denen sie verwurzelt war, sie scheute zwar nicht das Land ihrer Herkunft, aber ihre Neugier, die hielt sich in privaten und überschaubaren Grenzen. Sie hatte sich schon zu sehr von dem „Sein“ und dem „Wesen“ des Deutschen entfremdet, Melanie hatte alles Deutsche abgelegt, mit Ausnahme der Kunst und der Kultur, welcher sie, nach wie vor, sehr zusprach. Ich weiß nicht, was „mich“ so dermaßen an meiner Heimat faszinierte, dass ich der Einzige unserer Familie war der nach Hamburg zurückkehrte, aber ich vermisste unser altes Haus, unseren kleinen Garten, meine Freunde, die Nachbarn, die Stadt, den Hafen und natürlich unser Hausmädchen - Frau Lorenz. Wie war es ihr ergangen während des Krieges? Lebte sie überhaupt noch? Ich hatte sie immer so sehr gemocht, fast schon geliebt; sie war die Seele unseres Hauses in Hamburg gewesen, ohne sie lief gar nichts, als die Welt, in Europa, noch in Ordnung war. Mein Vater hatte ihr seinerzeit das Haus, per Telegramm, übereignet, es muss für „Carina“, denn so hieß Frau Lorenz mit Vornamen, eine schöne Überraschung gewesen sein, plötzlich, aus den bekannten Gründen, Besitzerin einer Villa in Nienstedten zu sein - wenn auch nur im begrenzten Rahmen, denn wir alle rechneten damals mit einer baldigen Rückkehr nach Deutschland, besonders natürlich mein Vater, der sehr an seiner Stadt hing. Für ihn war es ein unerfüllter Traum geblieben durch den Krieg, aber wie dem auch sei, ich war nun, stellvertretend für ihn, derjenige der alles in Augenschein nehmen musste, nicht nur aus der von mir bereits erwähnten Neugier, nein, ich machte mir um so vieles Sorgen, vielleicht unbegründet, vielleicht eher aus der verträumten Sicht eines Deutschen: Der mittlerweile einen amerikanischen Akzent hatte, welchen er nur allzu gerne „ganz“ verborgen hätte, aber wer kann schon über seinen Schatten springen? Dennoch gab ich mir während der Zugfahrt, als bei einem Zwischenhalt Fahrgäste mein Abteil betraten, die allergrößte Mühe, so deutsch, wie nur irgend möglich zu wirken. Ich grüßte also höflich, und das Ehepaar erwiderte meinen Gruß kopfnickend während sie sich schweigend niedersetzen. Ja, und ohne weitere Worte zu wechseln, vergrub ich mein Gesicht erneut hinter der Zeitung, die mir Halt und Sicherheit gab.
Es mag dumm und als nicht-notwendig erscheinen, dass ich mich derartig verhielt, trotzdem, mir schauderte davor, dass irgendjemand mich darauf ansprechen könnte: Wie ich den Krieg überlebt habe? Warum ich „keine“ Kriegsverletzung habe? Usw. Oh ja, es war eine makabere Situation, es war in jeder Hinsicht schwer für mich und für andere die richtigen Worte in so einem Moment zu finden - würde ich in eine solche Verlegenheit geraten. Höchstens Frau Carina Lorenz, sofern sie meinem Vater noch keine Gesellschaft im unendlichen Himmelreich geleistet hatte, könnte für meine zwiespältige Lage Verständnis aufbringen. Der Briefkontakt mit ihr war vor genau einem Jahr abgerissen, eine sinnvolle Erklärung dafür gab es nicht. Wir hatten den Briefwechsel mit ihr vorwiegend auf die traditionellen Feierlichkeiten wie: Weihnachten und Ostern, Geburtstag und Namenstag gerichtet; nicht aus Faulheit, sondern wir wollten ihr (Carina) keine Schwierigkeiten bereiten während des Krieges, weil Post aus Amerika, eventuell als Spionagetätigkeit ausgelegt werden konnte, obwohl dem natürlich nicht so war. Ja, an alle diese Dinge musste ich so denken, während mich die Eisenbahn Richtung Hamburg fuhr, und mich wohl auch in sich behütete, wegen der Kälte, die absolut extrem war. Das Ehepaar gegenüber unterhielt sich sehr leise, dennoch konnte ich, ob ich nun wollte oder nicht, das ein- oder andere Wort aufschnappen. Alle beide sahen sehr mitgenommen aus, er erzählte von seinen Kriegserlebnissen: Von dem Grauen der Front, von Panzern, von Bombenkratern, von, mit Maschinengewehren ausgerüsteten Doppeldeckern die einen gezielt beschossen hatten, von Granaten die durch ihre Splitter- und ihre immense Druckeinwirkung den kämpfenden Soldaten ganze Gliedmaßen abgerissen hatten, oder auch gleich den Tod herbeiführten. Nach seinen Erzählungen hatte er die Kriegsgefangenschaft zwar überlebt, und er war auch dem lieben Gott dankbar dafür, aber er, und nicht nur er, hatte seine „Ehre“ verloren, die ihm einst so viel bedeutet hatte, als er im Fahnenmeer losgezogen war, um einen unabdingbaren Krieg zu führen, den ihm sein Kaiser einst schmackhaft gemacht hatte.
Während er das so erzählte, mit schwacher, kaum verständlicher Stimme weinte er, und er schämte sich seiner Tränen nicht. Sie, seine Ehefrau, drückte ihn daraufhin an sich, schloss mit ihm die Augen, nahm seine Hand und sprach ihm Mut zu, um das Erlebte zu vergessen, zu verarbeiten, sofern das überhaupt möglich war für einen Kriegsheimkehrer, der dermaßen an dem Verlust der „Ehre“ litt. Ich konnte diese Gefühle nicht teilen, sie waren mir fremd und abwegig; sicherlich wurde auch bei uns immer kräftig gefeiert, wenn der Kaiser, vor dem Krieg, auf Durchreise in Hamburg war, aber, „Ehre“ strahlte der Mann auf unsere Familie nicht aus. Er wollte ja den Krieg, und als er ihn verloren hatte, verzog er sich feige in die Niederlande, darum fällt es mir schwer den Mann mit dem zu kurzen Arm als „ehrenvoll“ zu empfinden. Unsere eifrigen Geschichtsschreiber werden das eines Tages dementsprechend zu Papier bringen. Und während der mir gegenübersitzende Kriegsveteran wieder seine verweinten Augen öffnete, seine Ehefrau zwei Butterbrote auspackte und an zu essen fing, da sah ich auf meine Taschenuhr - noch ein paar Minuten und der Zug müsste im Hamburger Hauptbahnhof einlaufen, dann würde ich mir mein Gepäck aushändigen lassen, eine Kutsche würde mich Richtung Nienstedten fahren und ich wäre endlich wieder daheim, ach ja, „Home sweet home“.
Genauso kam es auch, nur mit dem Unterschied, dass mich ein Automobil, samt meinem Gepäck in die heimische, nur noch ein wenig vertraute, Umgebung führte. Trotz der allgemeinen Not und des Elends, des an allem Mangelnden gab es Automobile, welche die Besucher der Stadt dort hinfuhren, wohin sie wollten. Ich hatte anderes erwartet, anderes gehört, dennoch war ich angenehm überrascht; denn wer schon einmal mit einer offenen Pferdekutsche bei drei Grad minus gefahren ist, der weiß, was ich meine. Der Taxifahrer sprach nicht viel, er hatte sich seine Schirmmütze, die offensichtlich bewusst etwas zu groß gekauft worden war, tief über die Stirn ins Gesicht gezogen, seine Lederjacke roch nach altem Fett, und zwischen den Zähnen spielte er mit dem Rest von einem Zahnstocher herum. Er fragte mich ob ich aus Hamburg sei, und ob ich Arbeit hätte, ich bejahte beides. „Es ist gut in diesen schlechten Zeiten Arbeit zu haben, denn wer jetzt auf der Strecke bleibt, der kriegt seinen Arsch niemals wieder hoch,“ sagte er zu mir, und behielt dabei seinen Blick auf der Straße. Ja, er hatte recht. Er war wohl „vor“ dem Krieg auch etwas anderes gewesen, und trotz seiner schmuddeligen Art, seiner Ausdünstung, die von seiner Jacke ausging, war an ihm, anscheinend, der Krieg, spurlos vorbei gegangen; ich kann das nicht erklären, es war nur so eine Art von Eingebung in dem Moment, als er mir während der Fahrt durch seine enorme Ruhe und seine Ausgeglichenheit, diesen Eindruck vermittelte, es war merkwürdig!
Als wir endlich in Nienstedten ankamen, er mir das Gepäck vor die eiserne Eingangspforte des Elternhauses stellte, ich ihn entlohnte und wir uns gegenseitig noch einen guten Tag wünschten, da bekam ich weiche Knie. Alles sah so unverändert und so unberührt aus, - so wie wir es verlassen hatten, genauso stand es nun wieder vor mir. Im Hause brannte Licht, und innerhalb von ein oder zwei Minuten zogen sämtliche Erinnerungen, die mich mit unserem Haus verbanden, in mir, und an mir, vorbei. Ich blickte Richtung Sitzbank, dort unten am Strand hatten wir als Kinder gespielt, Steine gesammelt, ins Wasser geworfen, wir hatten geangelt und uns über jeden Fisch, besonders, wenn es sich um Stint handelte, wenn wir ihn fingen, gefreut. Vater war im Sommer immer mit uns über die Elbe auf die andere Seite gerudert, um Schilfrohre und Weidenkätzchen zu sammeln. „Mein Gott," dachte ich so bei mir, „war das wirklich alles längst schon Vergangenheit? War das wirklich vorbei? Oder konnte ich mich nur mit der Realität nicht abfinden?“ Die nach diesem verdammten Krieg wie eine Krankheit an „meiner“ Ehre fraß. Also drehte ich mich langsam wieder um, Richtung Elternhaus, öffnete die Eisenpforte und erwartete eigentlich gar nichts. Doch plötzlich öffnete sich auch die Tür zum Haus. Carina Lorenz kam zum Vorschein. Sie trug ein hübsches, dunkles Kleid und es schien, dass sie mich erwartet hätte, denn sie wirkte so feierlich, so nett, so distanziert freundlich, so, wie es eben nur sie sein konnte. Sie hob ihre Hände wie zum Gebet, senkte sie nach einem Augenblick wieder und streckte sie mir dann entgegen. „Markus, ich begrüße dich, gib` mir dein Gepäck her, ach, und wie geht es dir? Wie war die Überfahrt? Gab es Sturm?“ Fragte sie mich während ich das Haus betrat. Ich konnte nicht sofort antworten, ich war noch wie betäubt von dem Gefühl wieder in unserem alten Haus zu sein, welches von meinem Vater einst zur „Uneinnehmbaren Festung“ erklärt wurde; natürlich hatte er das nur aus Spaß, und zu seinen Lebzeiten gesagt, aber als meine Blicke durch die vertrauten Räumlichkeiten glitten, da musste ich ihm, nachträglich, beipflichten. Denn nichts hatte sich verändert, nichts war verfälscht oder mit Trostlosigkeit übergestrichen worden, alles beinhaltete noch den alten Geist der Vorkriegszeit, die mir, gedanklich, so nahe gestanden hatte, als ich in New York das Schiff Richtung Bremerhaven betrat. Seit langer Zeit hatte mich auch endlich mal wieder jemand mit meinem richtigen Namen angesprochen - Markus, und nicht mit „Marc Hyatt“, so wie ich mich in Amerika nennen musste. Ja, aus Marc Hyatt war anscheinend wieder Markus Handke geworden. Carina, die übrigens nur vier Jahre älter war als ich, bot mir von sich aus das „du“ an, weil früher, als sie unser Hausmädchen war, da musste ich immer und ewig „Fräulein Lorenz“ zu ihr sagen, das war nun vorbei, wir unterhielten uns von gleich zu gleich. Herrlich. Bei einem steifen Grog mit viel Rum begannen wir beide zu erzählen. Ich fing an und hörte nicht mehr auf, ich überschüttete sie mit Fragen, ich verlor ein wenig die Kontrolle über meine ungezügelte Wissbegier, aber sie zeigte Verständnis und lächelte mich mit glänzenden Augen an. Schön war sie geworden, viel schöner als in meiner Erinnerung, die sich mit einem Tropfen Verklärung, noch ein bisschen erhöhte über alles Begehrenswerte, was ich schon immer für Carina empfunden hatte. Damals als ich zwölf war und sie sechzehn, da kam sie mir viel älter und erwachsener vor als jetzt, denn jetzt saß mir ein Engel gegenüber der den Krieg überlebt hatte. Sie erzählte mir, dass sie im Jahre 1915 verlobt gewesen war, doch ihr Verlobter fiel in Frankreich; uns in den USA, hatte sie nie davon geschrieben, sie wollte es einfach nicht. Außerdem erfuhr ich, dass sie von meinem Vater, bis zu seinem Tod, regelmäßig Geld erhalten hatte, für sich, für die Instandhaltung der Villa, für Medikamente und Lebensmittel. Mein verblichener Vater wollte somit erreichen, dass er, wenn wir mit ihm zurückkehren würden aus Amerika, dass dann alles so sein sollte wie an dem Tag, als wir es verlassen hatten. Und die letzte Bankanweisung war dermaßen hoch gewesen, dass noch mehrere tausend Dollar auf Carinas Konto waren.
„Dein Vater wusste, dass er sterben würde, die Sorgen über den Verlust der Heimat, die anfänglichen Schwierigkeiten in der Neuen Welt, der Aufbau der Firma, seine Frauengeschichten und vieles mehr, all das hat ihn letzten Endes krank werden lassen, es war, mit Verlaub, eine Geschlechtskrankheit an der dein Vater gestorben ist; er war ein Schürzenjäger, nicht nur in Hamburg, sondern auch in Amerika gewesen.“ Für mich war das zwar alles nichts Neues, aber ich freute mich, dass Carina, trotz ihres Wissens, in ihren Briefen an uns, mit solchen Sachen, Gnade vor Recht hatte walten lassen. Denn die nach außen hin funktionierende Ehe meiner Eltern, stand in der Tat „zeitlebens“ auf dem Prüfstand, durch die zahllosen Eskapaden und Affären meines Vaters. Und das Vertrauen welches mein Vater Carina entgegen gebracht hatte, zeigte lediglich, dass er darüber hinaus nur noch mich hatte der zu ihm hielt, wenn er über die Stränge schlug und anschließend nach Verständnis suchte. Evelyn - meine streitsüchtige und ständig unzufriedene Mutter, hatte sich, zusammen mit meiner Schwester Melanie, eines Tages verbündet und sich gegen mich, meinen Vater und Carina gestellt, nicht im offenen Kampf, es wurde nicht gefochten, nicht einmal gedroht, aber die verbalen Spitzen und die Sticheleien waren nicht zu übersehen und zu überhören gewesen. Bei Ausflügen an die Elbe, an denen auch Carina mit teilnehmen durfte, kam es des Öfteren zu Zickigkeiten, welche meine Mutter, geschickt und ganz unauffällig, in Szene gesetzt hatte. Es ging dabei wirklich nur um kleinste Kleinigkeiten, aber eben diese trafen jedes mal ins Ziel – des oder der Betroffenen. Für meinen Vater war Carina die gute Tochter, mit Benimm und Anstand, so eine Tochter hatte er sich immer gewünscht. Für meine Mutter jedoch war Carina nur eine ausgekochte Konkubine, die sich in schamlosester Weise an den Herrn des Hauses heranschmiss, um die eigentliche Dame des Hauses auszustechen, sie gar zu kompromittieren und zu demütigen. Natürlich war das kompletter Blödsinn, aber meine Mutter, meine Schwester, ja selbst des Hauses Chauffeur „Albert“ ließen immer mal wieder die ein- oder die andere Gemeinheit, auf Veranlassung von meiner Mutter, gegen Carina los. Doch unter dem Schutz meines Vaters hatte sie nichts zu befürchten gehabt. Und auch ich stellte mich, trotz meines jugendlichen Alters, immer wieder vor Carina, wenn sie gelegentlich weinend in der Küche unserer Villa saß und aufhören wollte, weil sie meine irre Mutter und die bisweilen unausstehliche Melanie nicht mehr ertragen konnte und wollte.
Im Nachhinein frage ich mich manchmal: Wer hat Carina eigentlich mehr geliebt, ich oder mein Vater? Auch wenn unsere Liebe zu ihr von grundsätzlich unterschiedlicher Natur war. Körperlich war mein Vater nie an sie herangetreten, seine Selbstachtung verbot ihm das wahrscheinlich; aber er hätte es auch aus Prinzip nicht getan, denn er wünschte sich insgeheim, dass „ich“ sie eines Tages ehelichen würde, damit „sie“ in seiner Nähe sein könnte. Doch durch den Kriegsausbruch wurde sein Plan vereitelt; und Carina, gegen den Willen ihres Vormundes nach Amerika zu holen, nein, auch das entsprach nicht seinem Stil, also schrieb er ihr mit väterlicher Fürsorge - und das, obwohl sie längst schon volljährig war. Aber er vertraute ihr eben so vieles an, nicht zuletzt die Villa, die vielleicht auf mich und Carina gewartet hatte, damit wir in ihr glücklich werden. Doch, wer weiß das schon so genau? Wenn höhere Gewalt eine Mitentscheidung trifft, die man nicht vorher sehen konnte - unabhängig von Krieg oder von Frieden, Liebe oder Hass, Glück oder Unglück, oder wie in unserem Fall von Bestimmung, denn anders konnte ich mir die Umstände, die mich in die Arme von Carina führten, nicht erklären. Es hatte längst schon zwischen uns gefunkt, wir wussten, was wir von einander zu erwarten hatten, aber wir hatten es nur noch nicht ausgesprochen. Unsere Blicke trafen sich in den Augen des anderen, wir waren so angenehm überrascht, so beseelt, so erfreut, dass wir uns gefielen, ja, es war die Liebe die in unsere Herzen eingedrungen war. Wir hatten aufeinander, ohne dass wir es wussten, gewartet, gesucht, probiert und letzten Endes waren wir uns wieder begegnet, weil die Kraft der Liebe die Ewigkeiten überdauert. Mein Vater musste es, ohne jeden nur erdenklichen Überschwang, geahnt haben, dass wir uns eines Tages finden und lieben würden.
Für Carina waren die vergangenen Jahre entbehrungsreicher und hoffnungsloser gewesen als für mich, sie wurde zwar durch die Bankanweisungen aus den USA versorgt, aber sie hatte keine Familie mehr die zu ihr hielt in den Zeiten des Krieges. Ihre Eltern waren viel zu früh verstorben, Geschwister gab es nicht, Onkel und Tanten hatten ebenfalls das Zeitliche gesegnet. Nur ihr fester Glaube, an das Ende allen Übels, der hatte geholfen. Und sie hatte ohne einen Mann an ihrer Seite: die Steckrübenwinter, die Rationierungen, den Anblick der unzähligen Verstümmelten, all das Furchtbare irgendwie gemeistert, ohne dass ihre Seele daran zu Schaden gekommen war. Carina war mit einem unglaublichen Willen von Gottes Gnaden ausgestattet, sie war, im Gegensatz zu früher, in sich ruhend, sie hatte sich in den Notzeiten der Angst, die durch das Alleinsein hervorgerufen worden waren ein dickes Fell zugelegt. Meine anfänglichen Befürchtungen, dass es ihr nicht gut ergangen wäre, während unserer Abwesenheit in den Vereinigten Staaten, waren somit grundlos gewesen. Ich hatte auch den Eindruck, dass sie sich, um mich, mehr gesorgt hatte, als ich mich um sie, und als ich sie darauf ansprach, mussten wir beide lachen. Wir lachten und wir küssten uns, bevor wir uns liebten. So verlief mein erster Tag in der heimischen Villa in Nienstedten.
Unsere Verlobung und die anschließende Heirat war nur noch reine Formsache, auch dass sie im Laufe der nächsten zwei Jahre zwei Kinder gebar, einen Jungen und ein Mädchen: Jochen und Birgit, alle diese Dinge waren von einer fast schon erschreckenden Normalität gekennzeichnet gewesen, dass ich sie nicht in einer übergewichtigen Prozedur aufführen möchte, so etwas können andere wesentlich besser, denn diejenigen, haben es meistens nötiger als man denkt. Unser Familienleben war harmonisch und es hatte sich ohne Hektik, in die Zeit der „Wilden Zwanziger“ mit eingefügt. Carina war, vorwiegend, mit den Kindern beschäftigt, ich hingegen hatte mit dem Geld aus der Erbschaft meines Vaters einige Kneipen und Restaurants erstanden, renovieren lassen und für Stammkundschaft gesorgt. Die geschlagene Nation suchte und verlangte nach Zerstreuung, ich gab ihr welche. Brot und Spiele, in bezahlbarer Höhe, so lautete meine Devise; und der Erfolg, der natürlich auch dem Personal zu verdanken war, gab meinem Slogan recht. Denn das hatte ich in Amerika gelernt, dass man nicht aufgeben darf, dass man aus den Niederlagen, und seien sie auch noch so schmerzend gewesen, etwas Positives ableiten sollte, vor allem für sich selbst. Dennoch konnte nicht jeder Nutznießer einer Epoche sein die verdrängte, die Geschehenes durch allerlei Mittelmäßigkeiten nur stützte und nicht neu erschuf, Tanz und Rausch genehmigten sich nur diejenigen die ohnehin schon immer fest im Sattel der Mitläufer saßen. Wer etwas hatte, der hatte es auch schon zuvor gehabt, der fing zwar für sich neu an, und ließ sich bestaunen und bewundern, aber die verkrüppelten Schachfiguren, welche durch Zucht und Ordnung zum Gehorsam erzogen worden waren, nein, diese hungerten, in Gruppen, vorm Staatsgebäude, einsam und verlassen, in ihren zerlumpten Klamotten, vor sich hin. Sie waren einzig und allein durch ihre Verkrüppelung noch weniger Wert als vor dem Krieg, der „so vielen“ ungeahnten Wohlstand und Reichtum versprochen hatte; dieses war eine fatale Überschätzung gewesen wie sich herausstellte, leider begriff das auch der Dümmste, unabhängig welcher Nation er entsprang, erst viel zu spät, also, hinterher, als, etwas Klügere als „er“, es ihm klar gemacht hatten. Viel zu viele Parteien überschwemmten den Markt der Sensationen, der immer mehr zu einem gedemütigten Sauhaufen verkam. Einerseits hatten einige Wenige - zuviel, und andererseits hatten einige Viele - viel zu wenig. Sehen, wollte diese Unterschiede niemand, und in so mancher Kneipe wurde schon vorab etwas beschlossen, welches gerade erst hinter einem lag. Selbst die unantastbare künstlerische, wie auch die kulturelle Elite, von der man eigentlich Aufklärung sowie aufmunternde Parolen erwartet hätte - schwieg, sie schwieg aus Gründen der Eigennützigkeit; kaum jemand wollte Dinge nachvollziehen, die einem die wahre Wahrheit zeigen würden, denn dazu war man sich dann doch, wenn es drauf ankam, zu fein und zu schade, schließlich wollte man ja auch noch leben, deshalb pflegte man seine Eitelkeiten bis zur Perfektion.
Mir fielen solche Sachen immer dann auf, wenn ich selber anonymer Gast in einer von meinen Lokalitäten war. Carina sagte dann, wenn wir mal, so ohne weiteres, darauf zu sprechen kamen, immer zu mir: „Du belastest dich mit Dingen, von denen du die Finger lassen solltest, denn andere zerbrechen sich längst schon den Kopf darüber, und denen geht es wesentlich schlechter als uns und unseren Kindern, deshalb „denken“ sie für alle, auch für uns. So ist das!“ Trotzdem war mir nicht wohl bei dem Gedanken, dass andere, wer auch immer das sein möge, für mich, sich, den Kopf zerbrachen, denn Entscheidungen wollte ich eigentlich immer noch selber treffen, und nicht treffen lassen, auch wenn das Überlassen von Wichtigkeiten auf andere, eine deutsche Tugend zu sein schien. Als ich irgendwann anfing Tagebuch über meine Rückkehr nach Deutschland zu führen, hätte ich niemals gedacht, dass alles, was mich betraf so rasend schnell vonstatten gehen würde: Das Wiedersehen mit Carina, der Beginn der großen Liebe, geschäftliche Erfolge, anfangs zwei Kinder, später in den Jahren 1925/1927 noch zwei weitere, das Erleben von neuer deutscher Geschichte, die wiederholt in Militarismus und Fanatismus enden würde, ja, ich fühlte förmlich wie nach 1927 etwas in Gange war, doch ich möchte nicht, mit Hinsicht auf meine eigene Beteiligung, schriftlich wie auch gedanklich zu weit in die Zukunft greifen, welche nicht nur Gutes verheißen sollte.
Aber als ein gewisser junger Agitator aus Österreich im Jahre 1923 in München einen Putschversuch unternommen hatte, da spürte man schon so eine gewisse Unzufriedenheit der Menschen, die nach Neuordnung und nach Einigkeit strebte; in ihren Ansätzen allerdings durch die bürgerliche Zunft erheblich behindert, teilweise sogar weggesperrt wurde. Es war das Volk selbst, das die Hebel in Bewegung gesetzt hatte, um diejenigen zu entmächtigen, die sie auch weiterhin quälten, die ihnen nur soviel gestatteten, dass sie nicht an Untergewicht zugrunde gingen, denn das hätte ein zu schlechtes Bild abgegeben, insbesondere für die aufmerksame, ausländische Presse, die die verschiedenen Strömungen in Deutschland mit Argwohn beobachtete. Also kehre ich nun zurück zum Frühjahr 1925 - Max, unser drittes Kind war geboren, zwei Jahre später erfolgte die Geburt von Petra, beides waren gesunde und drollige, dunkelblonde Prachtexemplare, die den ganzen Tag nach Milch schrien und uns alle in den Wahnsinn trieben. Bei jeder einzelnen Geburt von unseren Kindern, kamen meine Mutter und meine Schwester eiligst aus den USA angereist, um die Vervollständigung der Familie kritisch zu begutachten, so war es auch Ende August 1927.
Meine Mutter war mittlerweile neu verheiratet mit einem Amerikaner – Roger. Melanie hingegen hatte ja selber schon zwei Kindern das Leben geschenkt, sie brachte ihre Rasselbande, samt Ehemann, gerne mal über den großen Teich zu uns nach Hamburg mit, um dann von deren überdurchschnittlicher Intelligenz zu schwärmen, anhand von Schulnoten, die allerdings weder ich noch Carina jemals zu sehen bekamen.
„Wir“ konnten die schulischen Leistungen, zumindest von Jochen, der seit Oktober 1926 auf einer staatlichen Schule Zucht und Ordnung lernte, belegen. Wir waren außerdem der Meinung, dass der Unterricht in Deutschland doch sowieso etwas züchtiger und auf einer moralisch höher angelegten Basis funktionierte als in Amerika, welches Jochen im Übrigen durch einen korrekten militärischen Gruß, indem er mit der rechten Hand zackig an die Stirn schlug, bestätigte. Melanie und ihr Mann „Dave“ waren natürlich ganz anderer Ansicht, Dave sprach in einem völlig akzentfreien Deutsch von - veralteter Pädagogik, die einer dringenden Erneuerung bedurfte. Auch meine Mutter, die sich immer schon für weltbürgerlicher als der Weltbürger überhaupt hielt, nahm eine klare progressive Haltung, in Bezug auf den Schulbesuch ihres Enkels, ein. Sie erinnerte an die negativen Einflüsse, denen sie selbst während „Kaisers Zeiten“ ausgesetzt war, und die sie in ihrer Liebe zur Freiheit beeinträchtigt hätten.
Als Carina ihr daraufhin sagte, dass es doch an jedem Menschen selbst liege, was unabhängig von der Schulzeit, aus ihm werden würde, entgegnete ihr meine weltbürgerliche Mutter ziemlich hart: „Das habe ich ja auch anfangs, und später noch sehr viel mehr, bei „dir“ gesehen, wie du dich aufgeführt hast, als du „nur“ das Hausmädchen in „unserer“ Villa warst, von einem reaktionären Flittchen hast „du“ dich doch damals kaum unterschieden - erziehungsbedingt eben. Dir fehlte die schulische Grundlage einer optimalen und ausgewogenen, völkerverbindenden Freiheitsstruktur, die es einem jeden Menschen ermöglichen sollte, unabhängig und frei von Zwängen zu wählen. Ja, und wenn ich mich recht entsinne, wurdest du uns doch: Durch irgend so eine kirchliche, verkalkte, dem Mittelalter entsprungene Organisation für Hausmädchen empfohlen, und wir haben „dich“ aus „Mitleid“ in unser Haus aufgenommen, oder irre ich mich da etwa?“
Carina streckte ihr, nach dieser Attacke, die Zunge weit entgegen. Meine Mutter verzog jedoch keine Miene, sie blickte zu Melanie, Melanie jedoch hatte keine Lust mehr auf Streit, sie entschärfte die angespannte Lage am Kaffeetisch, indem sie die zur Neige gehende Schwarzwälderkirschtorte ausdrücklich lobte und sagte: „Das gibt es in Amerika zum Beispiel noch nicht so richtig zu kaufen, jedenfalls nicht in der Qualität.“
Und somit war fürs Erste Ruhe.
Der Nachmittag verlief unerwartet angenehm, und verglichen mit anderen Nachmittagen – friedlich, das Thema verlorener Krieg wurde zum Beispiel völlig außer Acht gelassen, man wollte keine, noch offenen Wunden, mit dem Salz der Schadenfreude auspinseln. Besonders hielten sich die amerikanischen Ehemänner von Mutter und Schwester zurück, sie plauderten mehr, als dass sie sich ernsthaft mit mir oder mit Carina unterhielten, allgemeines Geschwätz, nichts Wichtiges: Hollywood-Stummfilmstars, der Broadway, erste Anzeichen eines bevorstehenden, eventuellen Börsen-Crashs, das waren die Themen, aber alles eben auf eine sehr lockere Art, die ich als harmlos und nett einstufte, ebenso beurteilte Carina die beiden soliden und gestandenen Männer: Roger Gould und Dave Finney. Beide liebten ihre deutschen Frauen aufrichtig und mit einer geschickten Hand, um Schreiereien und Pöbeleien, von vornherein zu vermeiden, denn Mutter und Tochter hatten die Fähigkeit, durch enorme Gesprächslautstärke, aus dem Stegreif heraus, ihre direkte Umgebung, wenn sich beide in Debatten „unterlegen“ fühlten, oder „verhedderten“, die Betroffenen die ihnen als zu „überlegen“ erschienen, in Angst und Schrecken zu versetzen; gezielte Einschüchterung auf unterstem Niveau nennt man so etwas, glaube ich zumindest? Einerseits verfügten beide, wenn man es auf die Lautstärke beschränkte, über ein angeborenes Talent, andererseits war es der Wunsch nach großer, innerlicher Befreiung, wenn die äußeren, zum Teil, vordiktierten Zwänge und Verordnungen, einengend und züchtigend wirkten; also behalfen sich Mutter wie auch Tochter mit „Geschrei“ im weitesten Sinne, insbesondere in Momenten der Not. Ohnmachtsanfälle, Übelkeit und eine gewisse naive Hingabe zum speziellen europäischen Weltuntergangssyndrom waren mit inbegriffen, wenn es darum ging, das letzte Wort zu haben, und sei es auch noch so verkehrt. Ich kannte diese Dinge zur Genüge von früher, auch Carina waren sie nicht entgangen, nur der puritanische Roger machte den Eindruck, dass er in seiner Frau immer wieder neue Abwandlungen eines Drachen entdeckte. Melanies Ehemann „Dave“, der in seiner etwas schrulligen Darstellung so mancher Fakten, seine Erfüllung gefunden zu haben schien, war gar nicht erst daran interessiert, seine Ehefrau in direkten Augenschein zu nehmen, Dave hatte sich offensichtlich mit der Tatsache abgefunden, dass Mutter wie auch Tochter, zwei impulsive Zeiterscheinungen waren, denen man besser aus dem Weg geht, in Phasen der Streiterei.
Und so rückte der Tag der Abreise des Besuches aus Amerika immer näher. Nach zweieinhalb Wochen, mit allen Höhen und Tiefen zog es die vier samt ihrer Kinder weiter Richtung Venedig, so wie sie es immer schon gemacht hatten, wenn sie uns in den vergangenen Jahren besuchten. Der Abschied war kurz und knapp, man sagte: „Auf Wiedersehen“, schüttelte sich die Hände, wünschte sich alles nur erdenklich Gute und trennte sich, bis zum nächsten Mal. Eine Woche später erreichte uns eine Karte aus Venedig, mit ein paar lieben Grüßen unserer Umherreisenden, die Europa systematisch abgrasten, auf der Suche nach Gründen, sich eines Tages irgendwo in der Alten Welt vielleicht doch wieder niederzulassen, vorerst nur rein geschäftlich, soviel hatte Roger durchblicken lassen, denn er wusste, dass meine Mutter niemals wieder für die Ewigkeit europäischen Boden betreten würde, mit Melanie war es da ja nicht großartig anders, aber ich und Carina fanden den Aspekt einer solchen Überlegung durchaus interessant. „Es ist die heimische Erde, die einen wohl immer wieder zurückkehren lässt?“ Meinte Carina. Sie vergaß dabei nur, dass meine Mutter auf Roger nicht angewiesen war, sie hätte ihn ohne jeden Zweifel den Laufpass geben können, wann auch immer ihr danach war. Mutter hatte nun mal mehr Geld als er; er war zwar nicht ärmer als sie, oh nein, so ist das nicht gemeint, er hatte „nur“ halb so viel mit in die Ehe gebracht, und war deshalb in einer anderen Situation. Meine Mutter, und da stand sie auch indirekt zu, maß, das Ansehen und den Charakter eines Menschen, lediglich an der Höhe seines, sicher angelegten, Bankkontos, das hatte sie auch schon zu meines Vaters Lebzeiten so gehalten, und sie würde sich niemals mit dem Gedanken anfreunden, daran auch nur irgendetwas zu ändern, dafür kannte „ich“ sie einfach zu gut...
Im Jahre 1928 kam auf allen Vieren, des Hauses ehemaliger Chauffeur „Albert“ wieder angekrochen, er hatte nach diversen Tätigkeiten, die mit dem Fahren überhaupt nichts zu tun hatten, zurück zur seiner Berufung gefunden, so oder so ähnlich war seine Ausdrucksweise, als er in meinem Arbeitszimmer, sich dabei schämend, in geduckter Haltung, mit zittriger Stimme um eine erneute Anstellung bewarb. Auch er, der ewige Junggeselle, der seinen Hang zu Wein, Weib und Gesang nie so ganz abgelegt hatte, war die allgemeine wirtschaftliche Situation auf den Magen geschlagen. Seine offene Wesensart, seine Aufrichtigkeit und nicht zuletzt seine Fähigkeit Automobile nicht gleich an die nächst beste Wand zu setzen, machten es mir leicht ihn wieder einzustellen. Er kannte Carina seit damals immer noch recht gut, beide waren im gleichen Alter und Albert war ihr gegenüber sehr untergeben, sehr anständig sowie aufmerksam gegenübergetreten, als sie sich nach so langer Zeit wiedersahen. Die kleinen Gemeinheiten, die meine Mutter einst zu verantworten hatte, welche Carina am deutlichsten zu spüren bekam, bekanntermaßen „auch“ von dem seinerzeit etwas dämlichen und unbeholfenen Albert - das alles schien vergessen, und Carina reichte ihm, mit einer nicht zu übersehenden Schadenfreude, in Manier einer Dame die Hand, so dass Albert in der Hüfte, sauber abgeknickt, die Mütze vorher abgenommen, tief Luft holend, sich über die gestreckte Hand von Carina neigte, um einen Handkuss anzudeuten. Carina nahm diese Geste der totalen Unterwürfigkeit, die dem eines Sklaven glich, wohlwollend zu Kenntnis, sie weidete sich am Anblick Alberts, der mit blutunterlaufenen Augenrändern, rot angelaufenen Ohren, fest aufeinander gebissenen Zähnen, anschließend, stramm stehend vor ihr Haltung annahm, um ihre Befehle entgegen zunehmen. Ich ließ, nachdem ich mehrmals Zeuge dieser Prozedur gewesen war, Carina im Umgang mit Albert machen, was sie für richtig hielt, schließlich war sie diejenige die in unserer Villa das Sagen hatte. Der getreue Albert hatte, nachdem er gierig den, von mir unterzeichneten Arbeitsvertrag an sich gerissen hatte, allen Erwartungen zum Trotz, nicht in unserem Hause ein Zimmer bezogen, nein, er besaß eine eigene kleine Wohnung direkt am Hafen, die er sich mit seinem Lohn, den er von mir erhielt, auffallend geschmackvoll einrichtete; er hatte den Stil, im Kleinen natürlich, von uns, ganz genau von Carina übernommen, denn sie hatte in unserer Villa, im Laufe der Jahre so einiges modernisiert. Warum es bei ihm genauso aussehen musste wie bei uns? Das war mir ein Rätsel, vielleicht war er aber auch nur zu verblödet sich nach seinem eigenen Geschmack zu orientieren. Als ich Carina von meiner Beobachtung erzählte, dass sich in Albert seiner Wohnung derartige Gleichnisse befinden, und ich das doch, mehr oder weniger, merkwürdig finde, da meinte Carina nur, dass „er“ eben keine Ahnung habe, was gut und schön ist, darum kopiert er andere, die das Einrichten eines Zuhauses besser bewerkstelligen können. „Vielleicht ist er aber auch nur zu verblödet?“ Sagte Carina zu mir. „Ja," erwiderte ich, „das habe ich auch schon gedacht, na ja, wie auch immer, Hauptsache er baut keine Unfälle und fährt vernünftig,“ fügte ich leicht beschwingt hinzu. Und in der Tat, irgendetwas passte mir plötzlich nicht, da war so eine Ahnung, so ein Gefühl von zu großer Anhänglichkeit, denn, wenn einer so ist wie Albert, dann sollte man ihn trotz aller beruflichen Qualitäten im Auge behalten und das tat ich auch. Er beschiss sich fast vor Freundlichkeit, wenn er mit Carina und dem kleinen Nachwuchs unserer Familie in die Stadt zum Einkaufen fuhr, oder sonst irgendwo hin zitiert wurde. Albert genoss die Nähe, die Schönheit, die alles verzaubernde Unkompliziertheit und das Vergessen meiner Frau, sowie deren Fähigkeit zum Verzeihen, in Bezug auf frühere Ereignisse, an denen er nicht ganz unschuldig war. Ja, und ob das nun alles deutliche Warnzeichen waren, dass unsere Ehe sich auseinander bewegte, eventuelle Eifersucht meinerseits inbegriffen? Mir kam das zu jener Zeit, in der so vieles schwierig zu werden drohte - noch nicht so vor. „Ich“ vertraute. Ich vertraute so lange, bis unser Nachbar, der alles und jeden kannte und das bis ins kleinste Detail, mir, durch ein paar Worte der Vertraulichkeit, und nur erst dadurch, in mir, Misstrauen erzeugte.
Er, Herr Rösser, ein gestandener, ehemaliger Kriegsveteran, ferner ein gutsituierter, mit einer Lehrerin verheirateter, leicht exaltierter Nationalsozialist von 33 Jahren, erzählte mir einmal wortwörtlich: „Euer Albert, obwohl es mich gar nichts angeht, der macht sich ziemlich wichtig. Es würde mich nicht wundern, wenn dieser „Albert“ - Madame (Carina war gemeint), nicht nur in die Stadt und auf den Wochenmarkt fahren würde, sondern auch noch ganz woanders hin, natürlich nur, wenn die lieben und braven Kinderchen, und damit sind alle gemeint, nicht dabei sind - Monsieur Handke. Und das meine ich, „ohne“ dass ich mich aufdrängen möchte. Wenn Sie verstehen...?“ Im ersten Moment dachte ich: „Was geht dich das eigentlich an? Du intrigantes, ehemaliges, aus dem Geschlecht der Nattern und Ratten entsprungener Mistkäfer, kümmere dich um deinen Scheiß, steck` deine Nase in deine Angelegenheiten, man hat zu schweigen, man hat, auch in unserem Hause, zu übersehen und wegzuhören, wenn es sich um den Zusammenhalt einer Familie dreht, man sollte nicht vorverurteilen, denn das ist ein Fehler.“ Aber dann, als die Medizin des Misstrauens in mir an zu wirken fing, dankte ich ihm für seine diskrete Andeutung, jedoch ließ ich mir nichts anmerken. Daraufhin marschierte er wieder in sein zweistöckiges Häuschen, allerdings, versprach er mir noch: „Auch in Zukunft die Augen offen zu halten,“ und reden würde er nur mit mir darüber, wenn ihm irgendetwas Anrüchiges unter die Nase geraten sollte. Und von diesem Tage an, war, in mir, der Gedanke, dass meine Ehefrau, mich mit unserem Chauffeur betrügen würde, beinah, tief und fest eingebrannt. Jochen, mein ältester Sohn, der „immer“ zu mir hielt, hatte mir einmal zugeflüstert: „Ich glaub` die Mama und der Albert die küssen sich heimlich, wenn sie glauben, dass sie alleine sind.“ Das schien mir Beweis genug zu sein, um meine treulose Ehefrau zur Rede zu stellen. So geschah es auch noch am selben Abend, unter Ausschluss der neugierigen Öffentlichkeit, nur ich und Carina - keine Zeugen. Meine Anschuldigen sprudelten mit einer solchen Intensivität hervor, dass ich sie förmlich mit Hass, mit Vorwürfen und mit Verantwortungslosigkeit überschüttete. Ich machte ihr die wohl schlimmsten Vorwürfe die man sich vorstellen kann. Immer wieder berief ich mich auf unsere gemeinsamen Kinder, auf unser Haus, auf das geheiligte Band der Ehe, welches man nicht zerschneiden sollte, besonders dann nicht, wenn zumindest einige Kinder, noch recht klein sind, und sie die fürsorgliche Pflege einer Mutter benötigen, die sich ihnen widmet und die sich ihrer Erziehung annimmt, damit sie nicht im Sumpf der Großstadt verenden. Ich redete und redete, und als ich glaubte noch einen drauf setzen zu müssen, da unterbrach mich Carina, indem sie einen gellenden Schrei ausstieß, der mich zu Tode erschreckte.
Sie trat, mit dem Absatz ihres Schuhs, ohne jegliche Vorwarnung, in die Scheibe der Glasvitrine, welche unsere kostbarsten Schalen, Weingläser und kristallinen Geschenke aus Amerika beinhaltete. So, durch diesen Krach, versuchte sie sich Gehör zu verschaffen, was ihr auch gelang. Ich sah sie fassungslos an. Dann brüllte sie, in noch nie da gewesener Weise, los. Sie warf mir ein Verhältnis mit „Melissa“ vor. Melissa war seinerzeit Angestellte, in einer von mir, einst, renovierten Kneipe, sie hatte sich durch Fleiß und Überstunden mein Wohlwollen erworben. Melissa war eine 20ig jährige Kroatin mit schwarzem Haar, großen Brüsten, dunklen, traurigen, sich nach Liebe und Zärtlichkeit sehnenden Augen, die meine Aufmerksamkeit erregt hatten - mehr nicht. Sicher, es gab keinen Mann der sie nicht auch ein bisschen „liebte“, aber ich hatte mich unter Kontrolle, ich musste nicht gleich mit ihr ins Bett, ich hatte meine deutschen Werte und Prinzipien, auf die sich „auch“ Carina, ohne jeden Zweifel, verlassen konnte. Dass Melissa an einem Sommertag, in der Nähe unserer Villa mit ein paar Freundinnen, zu später Stunde „nackend“ in der Elbe gebadet hatte, dessen unweigerlicher Zeuge ich gewesen bin, das war purer Zufall gewesen, klärte ich Carina auf. „Die Mädchen hatten ein wenig Spaß mit sich selber, das ist doch keine Tragödie, das ist doch völlig normal," sagte ich zu meiner schnaubenden Ehefrau die mir dennoch nicht glaubte. Sie hatte nämlich von „Frau“ Rösser erfahren, dass „ich“, an jenem Abend, als die jungen Frauen sich etwas abkühlten in den Fluten des Flusses, gar nicht weit entfernt auf einer ganz bestimmten Bank saß, und sehr genüsslich das lustige Treiben der Frauen, und der später noch hinzugekommenen, ebenso jungen Männer, ganz entspannt beobachtet hätte. Ich wurde somit zu einem Voyeur abgestempelt, der im Laufe des amourösen Abends, sich selber mit hinzugesellte, um seine Liebesphantasien zu befriedigen. Aber, hiermit unterstellte man mir zu viel, man überschätzte mich, denn ich habe zwar zugeschaut, und mich sicherlich über so viel Freizügigkeit amüsiert, aber ins Geschehen eingegriffen, aktiv, nein, das hatte ich nicht. Ich weiß noch wie sich die Frauen liebten, bevor die Männer eintrafen; wie später Männer und Frauen den natürlichen Liebesakt vollzogen im fahlen Licht der, letzten noch verbliebenen Sonnenstrahlen; ferner erinnerte ich mich aber auch noch: Wie ein paar Männer einander liebten, welches für mich, etwas absolut Neues war, es war kein Sodom und Gomorrha, aber es ging hoch her. Schuld war die Temperatur, die ein heißer Sommer mit sich bringt, so dass die Hormone ein Kribbeln erzeugen. Doch Trotz meiner lyrischen Darstellung des Abends, der anscheinend von Frau Rösser ganz anders interpretiert worden war, blieb Carina misstrauisch; und dass sie (Carina) anscheinend eine heftige Affäre mit Albert hatte, jenen Fakt ließ sie völlig außer Acht, er war für sie gegenstandslos geworden, aber, unsere Ehe war dennoch angeknackst. Wir gestanden uns Freiheiten zu, zu welchen wir vorher, vor all diesen Beobachtungen von Frau Rösser, die uns offensichtlich gegeneinander ausspielen wollte, nicht in der Lage waren. Ich übersah Carinas kleine Affäre mit Albert, und sie tolerierte mein Verhältnis mit Melissa, eben der lieben Kinderchen wegen.
Und auch Frau (Elisabeth) Rösser sagte mir einmal, dass sie es als „wunderbar“ empfinde, mit welcher Selbstverständlichkeit „wir“ unsere Ehe führen. Sie nannte es: „Modern“, und sie fügte hinzu, „dass wir uns aus dem idiotischen Gerede von anderen nichts machen sollten, denn sie hätte für alles Verständnis und würde schweigen wie ein Grab.“ Ob das nun wahr war, oder auch nicht, was Frau Rösser mir da erzählte, ich blieb vorsichtig ihr gegenüber, denn sie war alles andere als zurückhaltend, wenn es darum ging: Sich mit dem Leben ihrer Nachbarn zu beschäftigen, ebenso ihr Ehemann. Der Tratsch muss beiden angeboren gewesen sein, sie konnten es einfach nicht lassen, andauernd, irgendwelche Gerüchte und Beobachtungen, die sie überhaupt nichts angingen an andere weiterzuerzählen, und das, immer in leicht abgewandelter und überspitzter Form, so dass der, oder die Betroffenen in Streit und Schreiereien verfielen. Erst dann fühlten Frau und Herr Rösser so etwas wie Befriedigung, die, das Schnittlauch in der Suppe ihrer eigenen Sexualität bildete, wenn abends ihr Mann, der stramme preußische Oberst, wie irre über sie herfiel, um ihr zu zeigen, zu welcher Potenz der deutsche Soldat noch in der Lage war, trotz der Schmach und der Niederlage des ersten Weltkrieges. Die Soldatenehre weilte unbewusst über „allem“, was der deutschen Frau, sofern sie mit einem deutschen Soldaten verheiratet war, der den ersten Weltkrieg miterlebt hatte. Ja, diese Form der Ehre hing wie eine Straßenlaterne bei Nacht über dem „Fest“ der unzerstörbaren Liebe und leuchtete den Weg der Liebenden geradewegs in Richtung einer neuen Zeit, die schon klammheimlich angebrochen war. Hitlers Mannen hatten längst erkannt, wie es um die Zukunft des geschlagenen Deutschlands stand, wie sehr der Eispickel der Enttäuschung in die Herzen derer eingedrungen war, die sich nicht mit der Tatsache abfinden konnten, dass das kaiserliche Reich, mit all seiner ehemaligen Blüte, für immer, dahin geschieden war, weil die Deutschen dem fatalen Ruf nach einer stabilisierenden Demokratie folgen wollten, auch wenn der Deutsche andere Gedanken entwickelte, die nach einer trivialen Genugtuung verlangten. Ich war ein überzeugter Nationalist, weniger Faschist, vom ersten Tage an als der Nationalsozialismus aufflammte. Ja, „ich“ wollte jemanden wie Hitler, ich wollte keine Parteien mehr die das Volk gegeneinander aufhetzten, um einen ausweglosen Konflikt auf höchster Ebene zu lösen der zu nichts führt, als zu einer gewissenlosen, peinlichen Allgemein-Veränderung, der ohnehin schon: Desolaten Weimarer Republik, die sich zu einem Gespenst, zu einem aufgeweichten Schwamm ohne Inhalt hinbewegte.
Wir, die Geschlagenen, die Weltverbrecher, wir, wir alle brauchten eine Neuordnung, die politisch, besonders auf Deutschland bezogen funktionieren sollte. Ja, wir brauchten einen eigenen Weg, ohne Vorbehalte, der trotz der Schuld, trotz der Blindheit, trotz des Mangels an Bewältigung, trotz der bürgerlichen Entziehung ihrer Verantwortung, sich zu einem System entwickelte, welches aus dem Vergangenen gelernt hatte. Denn die Machtentfaltung war nur der Anfang einer längst überfälligen Zwistigkeit zwischen den Europäischen Staaten gewesen, die sich abreagieren wollten. Es war nichts weiter als simple Kraftmeierei gewesen, die allerdings Millionen Tote forderte und zu verantworten hatte. Durch Hitler schien diese Zeit in Vergessenheit geraten zu sein, weil er anders argumentierte, weil er andere Mittel anwendete, weil er moderner an die aktuellen Probleme heran trat. Er ließ die Aktualität für sich selber sprechen, ohne auf deren Veteranen ein schlechtes Wort kommen zu lassen, denn sie brauchten keine Hinweise, sie brauchten ein neues, aggressives Sprachrohr, welches sie für sich nutzten, wenn nicht sogar einzubeziehen wussten, so war mein Eindruck, als ich Adolf Hitler in Berlin zum ersten Mal sprechen hörte. Ich verstand nicht, was er sagte, aber ich spürte die Kraft, die Entschlossenheit, die erregende Leidenschaft für die große Sache die er zu formulieren gefunden hatte. Ich war begeistert, ich war hypnotisiert und ich war fasziniert, mit welcher Überzeugung dieser Mann die Massen mobilisierte und auf seine Seite zog, ohne jemanden zu zwingen. Er war es der die Befehle gab, die uns alle mit auf eine Reise durch die Vergangenheit und der gerade erst gebildeten Zukunft nahmen, die die Deutschen, und mich auch, zu einem Übermenschen erhoben. Ich, Carina, ja selbst der gelegentlich verunsicherte Albert, der sich zwischen den Kommunisten und den Nationalsozialisten anfangs nur schwer entscheiden konnte, wir wurden allesamt stolze Parteimitglieder der NSDAP. Dass Hitlers großartige Thesen die Juden ausgrenzte, das wurde, auch von mir, mit etwas Sorge getragen, aber dann doch für richtig und notwendig empfunden, schließlich drehte es sich um unser Vaterland. Meine Geliebte Melissa, eine Halbjüdin, sah „mich“ so um 1930 mehrfach mit den kritischen Augen einer Vordenkerin an. Sie verstand nicht warum ich Parteimitglied wurde, warum ich für die Nazis spendete, warum ich in Hitler den Heilsbringer sah, Melissa liebte mich zwar, aber sie begann sich so ganz allmählich von mir abzuwenden. Ich für meinen Teil verstand selber auch nicht so ganz: Warum es plötzlich gerne gesehen wurde, dass man jüdische Geschäfte meiden sollte. Unser Schuster und Freund Herr Goldmann war auch nicht anders als wir, obwohl er Jude war, er war ein sehr fleißiger, freundlicher Mensch, der niemanden etwas zu leide getan hatte, dennoch galt er, aufgrund der politischen Entwicklung, von heut auf morgen als „Feind“, der die saubere deutsche Rasse, durch Vermischung mit seinem Blut - entweihen könnte. Häuser in denen Juden wohnten wurden mit dem Davidstern verunstaltet, Kaufhäuser wurden demoliert, all das passte mir eigentlich nicht, auch Carina fand das übertrieben und zum Davonlaufen. Wir behielten also unsere jüdischen Freunde - trotzdem, auch wenn der Blockwart uns immer wieder vor solchen Menschen, mit ihren blutschänderischen Absichten und eigentlichen Zielen warnte. Der Jude war plötzlich an allem Übel schuld, er wurde karikiert, geschlagen, gedemütigt und es lag die Vermutung nahe, dass man das Judentum gänzlich beseitigen wollte, eben aus den genannten Gründen. Ich muss zugeben, dass ich mehr als häufig die Augen verschloss, denn ich wollte der Wahrheit nicht ins Auge sehen, meine damalige Naivität ließ mir keinen Raum für eine objektive Einschätzung der Verhältnisse. Mir war es wichtiger, dass nun ein Mann wie Hitler endlich, und ein für alle Mal, zu Methoden griff die von Dauer waren, die Absicherung und einen Neubeginn verheißen sollten. Leni Riefenstahls Film, „Triumph des Willens“, welcher nach Hitlers Machtergreifung in ganz Deutschland gezeigt wurde, dieser Parteifilm brachte mich zu der Entscheidung, dass nun alles so war, wie es sein sollte. Deutschland befand sich in einem Aufbau, in einem radikalen Umbruch, man konnte die neue Zeit hautnah miterleben. Und wir, die so ziemlich von Anfang an dabei waren, wir jubelten begeistert mit, wann auch immer jemand von der Parteispitze in Hamburg sprach. Insbesondere Carina hatte sich zu einer fanatischen Faschistin entwickelt, unsere Kinder, allen voran Jochen, dienten in der zackigen Hitlerjugend. Birgit nahm begeistert an einem Pflichtjahr für Mädchen auf einem Bauernhof teil, all das geschah so um 1936 herum. Die Olympischen Sommerspiele genossen wir, also alle die zu unserer Familie dazugehörten, in Berlin. Es war unsagbar schön, ich filmte mit einer Handkamera so viel es mir möglich war, ich war wie losgelöst, ich jubelte, ich konnte einmal, durch ein Fernglas den Führer sehen, wie er dem Geschehen der Wettkämpfe beiwohnte, er war ebenfalls von der Leistung der deutschen Sportler sichtlich angetan. Seine blauen Augen verrieten den Stolz den er fühlte, der mit jeder Medaille an einen Deutschen verliehen wurde, noch dazu wenn unsere Nationalhymne erklang, sie war mir noch Jahre später, im Gedächtnis haften geblieben, denn ich finde - damals, da hörte sie sich noch gewaltiger und eindringender an, als bei anderen Anlässen, nach dem zweiten Weltkrieg. Ja, all das empfand ich als richtig, als einen fast perfekten Staat, der zudem gut funktionierte; dass hinter der Kulisse Verbrechen geschahen, nun, man hörte so etwas, man nahm es so hin, man schob es aber auch sofort wieder beiseite, um sich damit gar nicht erst großartig zu beschäftigen. Jeder hatte seine Aufgabe gefunden, jeder war endlich vom Spuk der Vergangenheit, die soviel Enttäuschung und Armut gebracht hatte, befreit. Und um ganz ehrlich zu sein: „Wir waren alle glücklich, wir liebten Volk und Vaterland inbrünstig, denn es ging ja „fast“ allen, endlich wieder so gut, dass niemand hungern musste.“
Dass Hitler die Spitze der „SA“ beseitigen ließ, na ja, auch das wurde im Nachhinein als legitim und notwendig angesehen. Röhm, der Führer der SA war eine Un-Person geworden, nicht zuletzt aufgrund seiner Vorliebe für junge Männer, die er sich aus Schulen und Universitäten zukommen ließ, um sich an ihnen zu vergehen. Im Volke war man froh, dass dieses Schwein endlich weg war, aber auch im kleinen Kreis fiel sein Name, der mit so viel Schmutz behaftet war, überhaupt nicht mehr. Deutschland brauchte nur einen Führer und der hieß „Adolf Hitler“, er tat das Richtige, er wollte uns wieder als Sieger und nicht als Besiegte sehen. Dafür waren wir ihm, ausnahmslos alle, dankbar, und ich spendete eine weitere, beachtliche Summe in die Parteikasse der NSDAP, worauf ich einen langen Brief, sowie eine goldene Anstecknadel der Parteiführung von Hamburg erhielt, ich hätte vor Stolz platzen können. „Nun hast du es offensichtlich geschafft,“ sagte Carina zu mir, „nun bist du einer von ihnen, und nun darfst du die Freiheiten genießen, nach denen du dich immer so sehr gesehnt hast.“ Das war zwar nicht ganz richtig, weil mir die Parteiführung es immer noch übel nahm, dass ich einmal mit einer Jüdin ein Techtelmechtel gehabt hatte, aber die anerkennende Bewunderung von Carina sprach eine Sprache, die mir durchaus gefallen hatte. Und auch Herr Rösser, der mich für viele Jahre eher ignorierte, als dass er mich wahrnahm, grüßte mich von nun an mit einer wohlkalkulierten, bis ins Überschwängliche gehenden Genugtuung, angesichts meiner Anstecknadel, wenn wir uns am Samstagvormittag, auf den Weg zur Sitzbank an der Elbe begegneten. Rösser, mittlerweile leicht angegraut und boshafter denn je, erklärte mir häufig, in all den Jahren in denen wir uns anfreundeten, die Wichtigkeit von Zeitabläufen, besonders von dem, was man daraus lernen könnte, um späteren Generationen die Last der Erkundung ihrer vergangenen Fehler grundlegend zu erleichtern. Seine Meinung deckte sich mit der allgemeinen Auffassung, dass man selbst etwas schaffen muss und nicht geschenkt bekommt; dass ich selbständig war, dass ich von eigenen Einkünften den Lebensunterhalt meiner Familie bestritt, war ihm anscheinend völlig entgangen. Wahrscheinlich lag es daran, dass er seine Söhne, wohlbehütet in die Hände einer nationalsozialistischen Organisationen gegeben hatte, und er nun der Auffassung war: Seine beiden zukünftigen Generäle, gehören nun zu einer Elite, zu der nicht jeder Zugang haben würde.
Rösser war nicht nur Faschist und Patriot, er glaubte auch allen Ernstes, dass „Er“ und seine Frau, seine Söhne nicht zu vergessen, dem Führer, dem Volk, den Nachbarn, vielleicht auch der ganzen Welt etwas mehr zu bieten hatten, als der gewöhnliche, durchschnittliche Bürger, der ebenfalls vom Faschismus überzeugt war. Selbst meine goldene Anstecknadel der Partei war für ihn lediglich „eine“ Auszeichnung von vielen, die man ohne weiteres erreichen konnte; ja, er argumentierte so elitär, weil er als Weltkriegsveteran, für sich, für seine Frau, nicht zu vergessen für seine beiden militanten Söhne, innerhalb der Familie einen anderen Wert darstellte als ich zum Beispiel. Ich war ihm nicht radikal genug, ich hatte ihm zu wenig Biss. Natürlich sagte er mir das nicht direkt ins Gesicht, aber ich begriff, dass er, sich, für etwas Auserwähltes hielt, dennoch versuchten ich und Carina zu Familie Rösser ein freundschaftliches Nachbarschaftsverhältnis aufrecht zu erhalten, mit allem, was dazu gehörte, auch wenn es einem „wahrlich“ nicht leicht fiel.
Es war so um die Weihnachtszeit 1936 herum, ich hatte gerade die Filmleinwand aufgestellt, den Projektor in Position gebracht, mir ein Bier auf den Tisch gestellt, die Familie komplett versammelt, da klingelte es an der Haustür, Herr Rösser, den ich neuerdings „Ludwig“ nennen durfte, stand mit Schneeflocken, über und über bedeckt, vor mir und bat um Einlass. Seiner Frau (Elisabeth Rösser) ginge es sehr schlecht, das Fieber, welches zwar keimtötend wirkt, aber ab einer bestimmten Höhe zur Gefahr für den Körper werden kann, hatte Besitz von Elisabeth ergriffen; Elisabeth wimmerte, sie hatte mit allem Schluss gemacht, sie wollte sterben, sie konnte es nicht ertragen, dass ausgerechnet sie das Bett hüten sollte, und das auch noch für längere Zeit. Ich bat Ludwig in die Küche, denn in mir war das Interesse geweckt, dabei goss ich ihm einen Korn ein, er setzte sich, sichtlich betroffen, mitleid erregend, sowie vom Hausarzt Dr. Feldermann zutiefst enttäuscht - wie er sich ausdrückte, weil dessen Diagnose nicht den Ernst der Lage widerspiegelte, in der sich nach Ludwigs Meinung, seine Ehefrau befand. Ludwig Rösser, der sonst immer so eiskalt, so ausgekocht und so stark erschien, wirkte wie ein Fisch dem man den Köder weggenommen hatte, er hatte jegliche Contenance verloren, er war fertig, er brauchte noch einen zweiten und noch einen dritten Korn, um seine Nerven einigermaßen zu beruhigen. Die Art wie er erzählte, war die Art eines gebrochenen Mannes, der alles an Hoffnung aufgegeben hatte, obwohl es keine wirkliche Veranlassung dafür gab. Aus dem etwas wirren Bericht den Rösser ablieferte ließ sich heraushören, dass Elisabeth zwar über dem Damm war, also, dass ihrer Genesung nichts mehr im Wege stehe, aber selbst der Hausarzt soll geäußert haben: „Man müsse vorsichtig sein, damit es keinen akuten Rückfall gebe.“ Und dieser eine, eigentlich eher harmlose Satz, hatte den ehemaligen Weltkriegsveteran - Ludwig Rösser, so derartig aus der Bahn geworfen, dass er bei uns, die er jahrelang ignoriert hatte, Trost und Schutz suchte. Denn auch er, der sich in jüngeren Jahren zusammen mit seiner Gattin, für die Schulmedizin interessierte, befürchtete einen akuten Rückfall. Mein Eindruck war, dass beide, Herr und Frau Rösser, vornehmlich Hypochonder waren, denen, ein realer Bezug zur Erkrankung, egal welches Organ auch betroffen ist, völlig fehlte. Rössers hatten sich in ihrer Angst, vorab, vor dem Eintreffen des Arztes, gegenseitig mit den Auswirkungen einer Influenza hochgeschaukelt, und waren somit Opfer ihrer Einbildungsgabe geworden, der sie am Ende, nach dem Besuch des Hausarztes, auch weiterhin aufsitzen sollten. Ich sah mich vor einem unlösbaren Problem stehen, wie sollte ich helfen? Wie sollte ich dem eisernen Zaun der Gedankenkraft entgegen treten? Ich hatte keine Idee, ich zögerte, ich tastete mich dennoch langsam an den verzweifelten und mittlerweile leicht angesoffenen Ludwig heran, aber er hatte die Schotten seines Kopfes längst dicht gemacht, und befand sich, nachdem er nicht mehr Herr seiner Sinne war, auf dem Heimweg.
Tage später, kurz vorm Heiligen Abend, erblickte ich in den frühen Morgenstunden Herrn und Frau Rösser; wie er sie behutsam und fürsorglich ausführte; beide stapften vorsichtig durch den frisch gefallenen Schnee, welcher sich auf die Landschaft gelegt hatte, um sie, die Landschaft, etwas freundlicher erscheinen zu lassen. Madame Rösser war also endlich über den Berg, und er, der besorgte Ernährer der Familie, hatte sein seelisches Tief offenbar auch gut überwunden. Als ich das Fenster von meinem Arbeitszimmer öffnete, blickten beide zu mir auf, sie lächelte - vom Schrecken der Krankheit endlich erholt, und er winkte mir auffallend freundlich sowie gut gelaunt zu, er nickte mit dem Kopf so, als wollte er sagen: „Wir haben es geschafft. Die Krankheit ist besiegt, der Feind ist tot, jetzt könnte man zum Alltäglichen übergehen und neu beginnen! Denn, ein akuter Rückfall scheint ausgeschlossen.“ Erst sehr viel später erfuhr ich, dass Frau Rösser eine schwere Bronchitis gehabt hatte, sie, die immer Sport getrieben hatte, sie, die sich immer gesund ernährte, sie, die Alkohol und Nikotin verfluchte, sie, ausgerechnet „sie“ war das Opfer einer Saison bedingten Krankheit geworden. Für ihn, der nicht minder asketisch lebte, waren die monumentalen Säulen seiner Selbstdisziplin eingestürzt, deshalb war er auch schon nach drei Gläsern Korn besoffen gewesen und hatte genug gehabt. Für mich war das alles nichts Besonderes, nichts Wichtiges, aber, ich sah die Rössers von jenem Tag mit anderen Augen. Dass er jetzt öfters mal, bei Problemen, zur Buddel griff, dass er und auch sie, im Frühling 1937 zum Spanferkel-Grill-Abend am Strand einluden, all das, wirkte auf mich faszinierend, ich staunte über so viel moralische Umkehr, die wirklich einzigartig war, nie zuvor war mir dergleichen widerfahren. Und nach einem triumphalen Mahl, nach einem Besäufnis aller erster Quantität und Qualität, nach Musik und Tanz, nach einem Rausch mit reichlich Leidenschaft, nach all diesen Dingen fiel mir eine Märchenfee auf, eine blonde neunzehnjährige, traumhaft schöne, von der Natur reich an Oberweite ausgestattete gottgleiche Gestalt. Sie trug einen durchsichtigen Hauch von Nichts, sie lächelte mit einem Blick der mich anzog und betörte, ich war beschenkt durch den Antlitz dieser Schönheit, die am Morgen nach der Feierlichkeit auf mich zu kam, direkt am Elbstrand, wo ich auf einer Decke genächtigt hatte, umgeben von Schnapsleichen und anderen Individuen, die im Traume durch die Welt des Frühlings geisterten.
Und während die anderen noch schliefen, ging ich mit der unbekannten Schönheit in die Büsche, sie war ein ehemaliges BDM-Mädel aus der hiesigen Führerelite stellte sich heraus, sie war ferner eine Schulfreundin meines Sohnes, „er“ hatte sie mit auf die Fete gebracht, die in totaler Bewusstlosigkeit endete. Als wir uns in die Büsche gemacht hatten, küssten wir uns, sie glühte Feuer und Flamme, sie war ekstatisch, sie war eine Frau voller Leidenschaft und Hingabe, das machte sich besonders während des unendlichen langen Geschlechtsverkehrs mit ihr deutlich, denn sie wollte richtig genommen werden, keine Spur von Liebe oder gar Zärtlichkeit, nein, nur harter Geschlechtsverkehr pur. Sie war durch und durch versaut, sie hatte Erfahrung, denn als ich in sie eingedrungen war, spürte ich keinerlei Widerstand, im doppelten Sinne, ganz im Gegenteil, sie wirkte sehr abgebrüht, sie wusste worauf es ankam, sie konnte ganz gut mit Männern, ja, sie war ehrgeizig und setzte ihre weiblichen Reize gezielt ein, eigenartigerweise gefiel mir das, obwohl sie ja, von der moralisch geprägten Zeit damals, viel zu jung für mich war. Britta, so hieß sie, hatte durch ihren jugendlichen Charme, ihre Mädchenhaftigkeit und der damit verbundenen Frische die sie versprühte „alles“, was mich in höchste Höhen entschwinden ließ. Ich war verliebt bis über beide Ohren. Sie wurde meine heimliche Mätresse, meine absolute Nummer eins; Melissa war ja ins Ausland geflüchtet, Carina trieb es allem Anschein nach auch weiterhin mit Albert, warum also sollte ich mir nicht auch etwas Süßes gönnen? Unsere Liaison war von Anfang an unsagbar schön und beruhte auf gegenseitige sexuelle Lust, wir trafen uns in Pensionen, in Hotels, - bei mir zu Hause nur, wenn Carina mit Albert und den Kindern nicht da war, ja, dann ging es hoch her. Jochen, mein Ältester ahnte, was mit mir und Britta los war, aber er verpetzte mich nicht, er ließ es zu, weil er selber die Freiheit der Lust liebte, er wechselte häufig seine Freundinnen, er war mir in vielerlei Hinsicht am ähnlichsten. Meine Ehe mit Carina existierte nur noch auf dem Papier, aber wir alle „wahrten“ den Schein nach außen hin, Carina kam ihren ehelichen Pflichten längst schon nicht mehr nach, mir war das zwar egal, aber sie war halt immer noch eine begehrenswerte Frau mit einem erschlagenden und aufreizenden Gang, der jeden männlichen Konkurrenten, das Blut ins Schwengelchen schießen ließ, sie war auf ihre Art genauso gierig wie alle anderen auch, und sie machte, was sie wollte. Albert, der König der Scheinheiligen, ließ sich nie etwas anmerken, er machte seine Arbeit, er war immer zuverlässig, er war immer sehr pünktlich, er war immer ausgeglichen und im Grunde genommen der bessere Vater - verglichen mit mir. Ich hatte damals wirklich viel zu tun, aber ich brauchte den Ausgleich der Entspannung, und diesen Ausgleich verschaffte mir Britta, ihre Eltern tappten bezüglich unserer Romanze im Dunkeln, wir verbargen geschickt die Zuneigung, welche das Geflecht der Liebe bildete, die uns lange verbinden sollte. Ich war für Britta: Vater, Bruder, Geliebter und nicht zu vergessen der großzügige Geldgeber, der ihr Freiheiten ermöglichte, die sie wiederum durch ihre unvergleichbare Hingabe ausglich, aber wir hatten trotzdem jede Menge Spaß, denn so ein bisschen Heimlichtuerei tut wahnsinnig gut, obwohl man „mich“ wegen Verführung von „noch nicht ganz Volljährigen“ hätte drankriegen können, aber Britta war das alles egal, und ich hatte mich, wenn ich mal ganz ehrlich bin, von „ihr“ im Übrigen verführen lassen, und war ihr nun total verfallen. Wie, besser gefragt, „wo“ sollte das alles bloß enden?