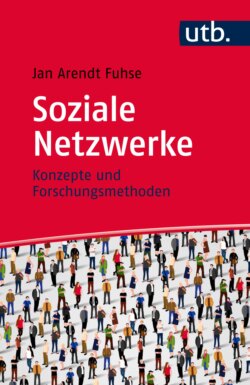Читать книгу Soziale Netzwerke - Jan Arendt Fuhse - Страница 10
Оглавление2. Vorgeschichte: von Beziehungen zum Netzwerk
[23]Seit mindestens 200 Jahren werden Menschen als eingebettet in soziale Strukturen und Relationen gedacht. In diesem Kapitel stelle ich die wichtigsten frühen Ansätze vor, aus denen sich die heutige Netzwerkforschung entwickelt hat: Den Ausgangspunkt bildet die formale Soziologie von Georg Simmel (2.1). Deren Anregungen wurden vom symbolischen Interaktionismus (2.2), von Norbert Elias in seiner Figurationssoziologie (2.3), wohl auch in der Soziometrie von Jacob Moreno (2.4), in der Gestaltpsychologie (2.5), im Human Relations-Ansatz (2.6) und in frühen Gemeindestudien und Surveys (2.7) weiter entwickelt. Relativ unabhängig davon hat die Sozialanthropologie einen eigenen Netzwerkbegriff entwickelt (2.8). Diese Ansätze werden hier knapp mit einigen wichtigen Grundgedanken vorgestellt.2
2.1 Formale Soziologie
Den Startpunkt für die Entwicklung der Netzwerkforschung bilden um 1900 die konzeptionellen Formulierungen in der formalen Soziologie in Deutschland, insbesondere bei Georg Simmel.
Georg Simmel (1858–1918) gehört zur Gründergeneration der Soziologie. Wie viele Autoren seiner Zeit versuchte Simmel die theoretischen Grundlagen für die Soziologie als eigenständige Wissenschaft zu konzipieren. Dabei setzte er nicht wie Emile Durkheim auf die Gesellschaft als integrierter Einheit oder wie Max Weber auf das handelnde Individuum als Grundbaustein. Vielmehr stehen bei Simmel soziale Konstellationen im Mittelpunkt. Sein Konzept der »sozialen Form« und seine Einsichten in die Eigenlogik von Konstellationen bilden Ausgangspunkte für die heutige Netzwerkforschung.
Grundlegend für die Netzwerkforschung wurde Simmels Gegenüberstellung von Form und Inhalt im Sozialen ([1908] 1992: 17ff). Als Inhalt bezeichnet [24] er individuelle Triebe, Interessen und Neigungen. Diese führen dazu, dass Menschen in Kontakt miteinander treten – sie bestimmen aber nicht, was dann passiert. Denn dann kommt es zu »Wechselwirkungen« zwischen den Beteiligten, und diese Wechselwirkungen führen zur Ausbildung sozialer Konstellationen des Füreinander, Miteinander oder Gegeneinander. Diese soziale Konstellationen bilden die Form – oder genauer: die Formen – des Sozialen. Sie stehen für Verfestigungen der Wechselwirkungen und bestimmen viele soziale Phänomene.
Simmel zufolge geht es in der Soziologie genau darum, diese »Formen der Wechselwirkung […] in gedanklicher Ablösung von den Inhalten« zu betrachten ([1908] 1992: 20. Eine formale Soziologie untersucht also soziale Konstellationen und blendet dabei individuelle Neigungen und Interessen tendenziell aus. Genau das will auch die Netzwerkforschung: Soziale Konstellationen werden formal (erst einmal ungeachtet individueller Eigenschaften und Motive) analysiert mit Blick etwa auf strukturelle Vorteile oder Nachteile für Inhaber bestimmter Positionen in Netzwerken.
Bei Simmel finden sich auf dieser Grundlage eine Reihe von relevanten Überlegungen für die Netzwerkforschung (Hollstein 2001: 60ff; Fischer 2010):
Das genuin Soziale fängt eigentlich erst ab einer Konstellation mit drei Personen – einer ➔Triade – an (Simmel [1908] 1992: 114ff). Ab der Triade gewinnen soziale Konstellationen ein Eigenleben, die die Wechselwirkungen bestimmen.
Individuen stehen nach Simmel am Schnittpunkt zwischen sozialen Kreisen ([1908] 1992: 456ff). Diese strukturelle Position prägt und definiert sie. Umgekehrt beeinflussen sie auch die Gruppen, in denen sie Mitglied sind (Breiger 1974).
Simmels Gesetz der großen Zahl zufolge werden Gruppen umso unpersönlicher, je größer sie sind ([1908] 1992: 89f). Je größer die Gruppe, desto weniger wird sie durch die einzelnen Individuen, deren Eigenschaften und deren Ziele bestimmt.
Der Konflikt oder »Streit« zwischen zwei Gruppen wirkt bei beiden hochgradig integrativ ([1908] 1992: 284ff). In der Auseinandersetzung mit einem äußeren Feind schließen sich die Reihen.
Ein Beispiel für eine triadische Konstellation ist die Figur des »lachenden Dritten« ([1908] 1992: 134ff). Zwei Parteien konkurrieren miteinander. Eine dritte Partei kann dann als neutraler Vermittler (etwa als Richter) auftreten. Oder sie kann die Situation als mögliches Zünglein an der Waage ausnutzen, indem sie ihre Unterstützung den beiden Konfliktparteien für entsprechende Gegenleistung anbietet. Allein die strukturelle Position sorgt hier für Vorteile.
[25]Mit seinem Fokus auf soziale Konstellationen (»Formen«) liefert Simmel einen wichtigen Grundbaustein für die Netzwerkforschung. Ihm fehlt aber ein Netzwerkbegriff für soziale Konstellationen als Muster von Sozialbeziehungen. Simmel benutzt hier noch das Gruppenkonzept. Dieses suggeriert aber eine Abgeschlossenheit und Homogenität sozialer Kontexte, die wir empirisch selten finden (Fuhse 2006: 252ff).
2.2 Symbolischer Interaktionismus
Glücklicherweise gingen die Anregungen der formalen Soziologie mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten nicht vollkommen verloren. Ein wichtiger Strang führt über den symbolischen Interaktionismus in die amerikanische Soziologie. Der Chicagoer Professor Albion Small publizierte eine Reihe von frühen Arbeiten seines Bekannten Simmel in englischer Übersetzung in den ersten Ausgaben des American Journal of Sociology (Abbott 1999: 88).
Smalls Nachfolger William Thomas, George Herbert Mead und Herbert Blumer verbanden die formale Soziologie mit dem amerikanischen Pragmatismus von Dewey, James und Peirce zum symbolischen Interaktionismus. Von Simmel kam der starke Fokus auf Wechselwirkungen und soziale Konstellationen; aus dem Pragmatismus stammen eher philosophische und psychologische Einsichten in die subjektive Verarbeitung und Konstruktion von Sinn. Die Verbindung beider Theorien führte zu der Idee, dass Menschen Symbole austauschen und verarbeiten (Blumer [1969] 1986: 2ff). Wie Simmel sahen Blumer und Mead diese symbolvermittelte Interaktion vor allem innerhalb von Gruppen.
2.3 Die Figurationssoziologie von Norbert Elias
Ein zweiter Wirkungsstrang der formalen Soziologie läuft über Norbert Elias. Im Mittelpunkt seiner Soziologie steht der Begriff der Figuration. Diese steht für ein Geflecht von Interdependenzen zwischen Menschen (oder anderen Einheiten, etwa auch Staaten; Elias 1970: 11f, 140ff). Viele soziale Phänomene wie die Ausscheidungskämpfe zwischen Staaten, der Kalte Krieg, die Königsherrschaft oder Konflikte zwischen ethnischen Gruppen lassen sich Elias zufolge aus diesen Interdependenzen erklären.
Elias wendet sich einerseits gegen Erklärungsmodelle, die von autonom handelnden Individuen ausgehen, und andererseits gegen holistische Modelle von Gesellschaft als integrierter Einheit (wie in der Systemtheorie). Hier finden sich wichtige Grundgedanken von Georg Simmel, ohne dass Elias dies explizit macht.
[26]Norbert Elias (1897–1990) ging wie viele deutsche Sozialwissenschaftler während der NS-Herrschaft ins Exil (nach Großbritannien). Erst Ende der 1970er-Jahre wurde Elias durch die Neuauflage seines zweibändigen Werks Über den Zivilisationsprozess bekannt. Andere wichtige Werke behandeln die absolutistische Herrschaft Ludwigs XIV., die deutsche Gesellschaft und Kultur vor dem Nationalsozialismus und die Frage: Was ist Soziologie?
Elias entwickelt den Begriff der Figuration bereits in den 1930er-Jahren – lange vor dem Netzwerkbegriff. Er geht über den Gruppenbegriff hinaus, weil er die Beziehungskonstellation zwischen mehreren Akteuren betrachtet und zum Beispiel auch Interaktionsstrukturen innerhalb und zwischen Gruppen in den Blick nimmt (etwa in Elias/Scotson [1990] 1965). Später spricht Elias von »Netzwerk« und »Figuration« gleichermaßen (1970: 12 et passim).
Allerdings ist der Figurationsbegriff bei Elias nicht rein formal angelegt: Als Schüler des Wissenssoziologen Karl Mannheim untersucht Elias soziale Konstellationen verknüpft mit Sinnformen wie Ideologien, Feindbildern und Stereotypisierungen.
In seinen historischen Studien greift Elias vor allem auf Dokumente und auf Romane als Quellen zurück. Die für die Migrations- und die Stadtsoziologie wichtige Untersuchung Etablierte und Außenseiter (Elias/Scotson; [1965] 1990) benutzt qualitative Verfahren wie Interviews und ethnographische Beobachtungen. Viele der Überlegungen von Elias lassen sich aber auch mit quantitativen Verfahren überprüfen.
2.4 Soziometrie
Früher als Elias wurde eine andere Gruppe von Emigranten wichtig für die Entwicklung der Netzwerkforschung. Ganz wesentliche Anstöße erhielt die Netzwerkforschung durch die frühen soziometrischen Arbeiten von Jacob Moreno.
Jacob Levy Moreno (1889–1974) studierte in Wien Medizin und Psychotherapie, ging aber schon 1925 in die USA (nach New York). Dort entwickelte er in Studien mit Kindern und mit Strafgefangenen eine eigene Methode zur Messung von Gruppenkonstellationen – die Soziometrie.
Dieses quantitativ angelegte Instrumentarium kommt der ➔formalen Netzwerkanalyse sehr nahe, war aber prinzipiell auf die Therapie von [27]Gruppenprozessen ausgerichtet. Unter anderem entwarf Moreno eine Behandlung mittels Stegreiftheater (Psycho- oder Soziodrama).
In seinem Hauptwerk Who Shall Survive? von 1936 (deutsch: Die Grundlagen der Soziometrie) umreißt Moreno die Soziometrie als »die allen Sozialwissenschaften zugrunde liegende mikroskopische und mikrodynamische Wissenschaft« ([1936] 1996: 19). Es geht um die Untersuchung von mikrosozialen Konstellationen (und Prozessen), die in einer ganzen Reihe von Wissenschaften (Soziologie, Pädagogik, Politik-, Wirtschafts- und Geschichtswissenschaft) wichtig werden.
Die theoretische Fundierung von Morenos Überlegungen bleibt dürftig. Dagegen finden sich bei ihm bereits viele ➔Netzwerkgraphen als Kern seiner Analyse ([1936] 1996: 67ff). Mit diesen »Soziogrammen« bildet er die Struktur von Beziehungen in einem Kindergarten, in Schulklassen und in einem Mädchenwohnheim ab. Dabei bietet er schon einige Grundformen von Netzwerkgraphen wie »isolierte Individuen« (A), »Paar« (B), »Dreiergruppe« (C), die »Kette« (D) und den »Stern« (E) an (siehe Abbildung 2). Zum Teil untersucht Moreno diese Beziehungsstrukturen auch schon statistisch, etwa mit Blick auf die Beziehungen zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Ethnien.
Abb. 2: Grundformen von Netzwerkgraphen (Soziogrammen)
Quelle: Eigene Darstellung nach Moreno ([1936] 1996: 69)
[28]Zurecht gelten die Arbeiten von Moreno heute als Geburtsstunde der formalen Netzwerkanalyse. Auch die von ihm gegründete Zeitschrift Sociometry wurde in der Folge sehr wichtig.3
2.5 Von der Gestaltpsychologie zur Balance-Theorie
Neben Moreno lieferten unter anderem Fritz Heider und Kurt Lewin wichtige Impulse. Diese kamen aus der Gestaltpsychologie – einer Forschungsrichtung, die sich auf das psychische Erkennen von Strukturmustern (»Gestalt«) konzentriert. Beide wendeten sich nach ihrer Emigration in die USA der Sozialpsychologie zu und untersuchten das Wechselspiel zwischen psychischen Vorgängen und sozialen Kontexten.
Bereits kurz nach seiner Emigration in die USA schlug Kurt Lewin eine Formel vor, der zufolge das individuelle Verhalten von Eigenschaften der Person und von ihrem jeweiligen Umfeld abhängt (1936). Zu diesem Umfeld gehört insbesondere die Einbettung in Relationen mit anderen – das »soziale Feld«. Heute gilt Lewin als einer der Väter der Feldtheorie in den Sozialwissenschaften (Martin 2003). Die Idee ist, dass sich Akteure an Personen in ihrer Umgebung orientieren und ihr Verhalten daran ausrichten. Die Strukturen des Felds lassen sich als Netzwerkbeziehungen analysieren (DiMaggio 1986; Powell et al. 2005). Des Weiteren entwickelte Lewin das Konzept der »Gruppendynamik« (1947): Mitglieder einer Gruppe können sich so gegenseitig beeinflussen, dass sich ihr Verhalten nicht mehr aus den isolierten Eigenheiten und Dispositionen der Beteiligten, sondern aus ihrem Zusammenwirken erklärt.
Vielleicht der wichtigste Schüler Lewins war Leon Festinger. Für die Netzwerkforschung sind vor allem Festingers Studien von Interesse, die zeigten: Soziale Beziehungen bilden sich meistens dort, wo Menschen aufeinander treffen – also etwa im privaten Wohnumfeld (Festinger et al. 1950: 34ff). Dieses Prinzip wurde später von Scott Feld als Fokus-Theorie verallgemeinert (1981): Soziale Beziehungen entstehen an Orten mit gemeinsamen Aktivitäten – sogenannten ➔»Aktivitäts-Foki« (siehe 10.2).
Auch Fritz Heider untersucht die soziale Einbettung von Einstellungen. Heider zufolge versuchen wir in unseren Einstellungen gegenüber Objekten [29] in eine Balance mit unserem sozialen Umfeld zu gelangen (1946): Wir bewerten tendenziell solche Objekte positiv, die auch von Mitmenschen positiv bewertet werden, die wir selbst mögen. Zum Beispiel orientieren wir uns an den politischen Einstellungen unserer Freunde und Familienmitgliedern. Umgekehrt sehen wir tendenziell solche Objekte negativ, die auch unsere Freunde nicht mögen. Auch dies ist eine Form möglicher Balance. Eine dritte Form besteht zwischen Menschen, die sich nicht mögen. Von diesen müssten Objekte diametral entgegengesetzt bewertet werden, um ihre Einstellungen in Balance zu bringen. Ein Beispiel hierfür wäre eine Abneigung gegen Personen, die eine uns unsympathische Partei wählen.
Diese Überlegungen bleiben bei Heider sehr abstrakt und noch in der Form von Hypothesen. Für die Netzwerkforschung wurde eine Weiterentwicklung seiner Balance-Theorie wichtig. Den Lewin-Schülern Dorwin Cartwright und Frank Harary zufolge lassen sich Heiders Überlegungen auf reine Beziehungskonstellationen übertragen (1956): Drei Akteure haben entweder nur positive Beziehungen untereinander (z. B. Freundschaft). Oder sie haben zwei negative Beziehungen und eine positive – ich werde mich also mit dem Feind meines Feindes verbünden, oder mich mit dem Feind meines Freundes oder Verbündeten ebenfalls verfeinden. Der erste Fall heißt »positive ➔Transitivität«, der zweite »negative Transitivität« ( Tabelle 1).
Tab. 1: Positiv und negativ transitive Triaden, Beispiele für Balance-Mechanismen
Positive Beziehungen sind mit [+], negative mit [-] markiert.
Quelle: Eigene Darstellung
[30] Definition: Netzwerkstrukturen sind in Balance in dem Maße, in dem die Beziehungen zwischen Akteuren konsistent positiv oder negativ sind. Positiv transitiv sind Netzwerke, wenn Akteure positive Beziehungen miteinander haben, die auch indirekt positiv verbunden sind. In negativ transitiven Netzwerken ist eine Sozialbeziehung negativ, wenn die Beteiligten indirekt über je eine positive und eine negative Beziehung verbunden sind, und sie ist positiv, wenn die Beteiligten indirekt über zwei negative Beziehungen verbunden sind.
Unterschiedliche Beziehungskonstellationen lassen sich nun daraufhin untersuchen, wie ausbalanciert sie sind. Netzwerke sind in Balance, wenn die beteiligten Akteure ➔Triaden mit positiver und negativer Transitivität bilden. Aus der Balance-Theorie ergeben sich zwei Hypothesen:
| (1) | Netzwerke neigen dazu, sich durch die Formierung von neuen Beziehungen oder die Auflösung von alten Beziehungen auszubalancieren. |
| (2) | Bestehende Netzwerkstrukturen sind überwiegend ausbalanciert. |
Beide Hypothesen sind in empirischen Studien etwa in Schulklassen recht gut belegt. Allerdings gelten sie hauptsächlich innerhalb abgeschlossener Kontexte, in denen man etwa dem Feind eines Freundes nicht einfach aus dem Weg gehen kann (Martin 2009: 42ff).
Lewin, Festinger und Cartwright forschten ab 1945 am neu gegründeten Center for Group Dynamics am Massachusetts Institute of Technology (MIT), das ein wichtiges Zentrum für die Untersuchung von Gruppenprozessen wurde.
2.6 Der Human Relations-Ansatz
Seit circa 1930 initiierten Elton Mayo und W. Lloyd Warner an der Harvard University – in direkter Nachbarschaft des MIT – die Untersuchung von Netzwerken in Organisationen und in Gemeinden (siehe nächster Abschnitt).
Mayo und Warner kamen beide aus Australien und waren dort während ihres Studiums in Kontakt mit dem strukturalen Denken des Anthropologen A. R. Radcliffe-Brown gekommen (Scott 2000: 16ff; siehe 2.8). Der Fokus der Forschung von Elton Mayo lag auf der Entwicklung von Organisationen (Unternehmen, Verwaltung etc.). Dabei ging es um die Optimierung von Arbeitsprozessen. Dafür wurden informale Strukturen von Freundschaften zwischen Mitarbeitern als wichtig erachtet. Entsprechend untersuchte Mayo mit seinem Team informale Beziehungen, die sie als »human relations«[31] bezeichneten. Aus diesem Ansatz wurden einige empirische Studien wichtig für die Netzwerkforschung:
Die Hawthorne-Studie – behandelt die Arbeitsorganisation und informalen Beziehungen in einem Elektrizitätswerk. Die Autoren rekonstruieren hier unter anderem informale Beziehungen (Freundschaften, Antagonismen) und die Beteiligungen an sozialen Ereignissen (Spielen, Konversationen, praktischen Hilfen) zwischen den 14 Arbeitern im sogenannten »Bank Wiring Room« (Roethlisberger/Dickson [1939] 1964: 501, 503f, 506f).
Mayos Kollege William Foote Whyte untersuchte informale Beziehungen in einer Straßengang in Boston – ebenfalls mit frühen Soziogrammen, aber ohne statistische Analysen ([1943] 1993: 13, 49, 156, 184, 188).
In der von Lloyd Warner angeleiteten Gemeindestudie Deep South wurden die Cliquenstrukturen zwischen afro-amerikanischen Frauen in »Old City« untersucht (Davis et al. 1941: 147ff). Deren Zugehörigkeit zu ➔Cliquen zeigte sich in der gemeinsamen Teilnahme an Veranstaltungen.
Hier finden wir das erste Beispiel für ein sogenanntes ➔Two-Mode-Netzwerk: In dem Netzwerk gibt es zwei Arten von Knoten: Akteure und Ereignisse. Beziehungen laufen immer von Akteuren zu Ereignissen und umgekehrt – nie direkt zwischen zwei Knoten der gleichen Art. Die Afro-Amerikanerinnen sind also untereinander nur über die gemeinsame Teilnahme an Ereignissen verbunden (und die Ereignisse umgekehrt nur über die Afro-Amerikanerinnen; Tabelle 2). Um die Zugehörigkeit der Frauen zu Cliquen zu rekonstruieren, sortierten Davis und seine Ko-Autoren die Reihen für die Akteure und die Spalten für die Ereignisse in der Netzwerkmatrix neu. Akteure mit gemeinsamer Teilnahme an Ereignissen und Ereignisse mit den gleichen Akteuren wurden jeweils nebeneinander platziert. Auf diese Weise zeigt Tabelle 2 eine tendenzielle Trennung der Frauen und ihrer Treffen in zwei sich leicht überlappende Cliquen.
Solche Two-Mode-Netzwerke werden in der Netzwerkforschung häufig analysiert. Sie zeigen gegenüber den üblichen Netzwerken mit nur einer Art von Knoten ganz bestimmte Eigenschaften. Two-Mode-Netzwerke lassen sich einfach in zwei getrennte Netzwerke überführen. Zum Beispiel könnten wir das Netzwerk der Frauen in Old City rekonstruieren, indem wir die Beziehung zwischen zwei Frauen immer dann als Beziehung codieren, wenn beide gemeinsam an mindestens einem (zwei, drei …) Ereignissen teilgenommen haben.
[32]Definition: In einem ➔Two-Mode-Netzwerk sind zwei verschiedene Arten von Knoten (z. B. Akteure und Ereignisse) wechselseitig verbunden (also nur Ereignisse mit Akteuren). Knoten der gleichen Art sind nur indirekt über die Knoten der zweiten Art verknüpft
Tab. 2: Akteure und Ereignisse in »Old City«
Quelle: Davis et al. 1941: 148
[33]Eine wichtige theoretische Synthese legte ein junger Kollege von Warner und Mayo in Harvard, George Caspar Homans, in seinem Buch The Human Group vor ([1950] 1992). Homans kam aus der Literaturwissenschaft und wurde später vor allem durch seine Verhaltenstheorie bekannt.
Schon in The Human Group entwickelt er eine ganz eigene These auf soziale Konstellationen. Diese baut auf empirisch beobachteten »Ereignissen« oder »Verhalten« auf – nicht auf mit Fragebögen erhobenen Daten. Bei Ereignissen handelt es sich meist um »Interaktion« mit anderen (ohne Referenz auf den symbolischen Interaktionismus). Diese sind mit individuellen Empfindungen oder Emotionen (»sentiments«) unterlegt. Interaktionen verdichten sich in Gruppen, die durch eigene Normen und eine Gruppenkultur stabilisiert werden. Zudem findet sich in Gruppen eine interne Struktur mit Anführern und Rangunterschieden.
Sowohl die Abgrenzung zwischen Gruppen als auch die internen Strukturen von Gruppen sollen nach Homans mit soziometrischen Verfahren – also mit ➔Netzwerkgraphen und -matrizen analysiert werden. So nimmt Homans etwa die Soziogramme aus dem Bank Wiring Room der Hawthorne-Studie wieder auf ([1950] 1992: 48ff). Homans präsentiert in seinem Buch eine ganze Reihe der verfügbaren Daten zu informalen Gruppenstrukturen und interpretiert sie vor seinem theoretischen Hintergrund. Allerdings fehlen bei ihm – wie bei den anderen diskutierten Beispielen für Human Relations-Studien – formale mathematische Analysen.
2.7 Frühe Gemeindestudien und Surveys
Einen etwas anderen Blickwinkel auf Sozialbeziehungen und Netzwerke verfolgten die frühen Gemeindestudien um W. Lloyd Warner und Survey-Untersuchungen um Paul Lazarsfeld. Hier geht es weniger um die Struktur von Netzwerken als um die Verteilung von Sozialbeziehungen innerhalb von Populationen. Sie bilden direkte Vorläufer der heutigen Studien zu ➔ego-zentrierten Netzwerken (Kapitel 8).
W. Lloyd Warner war wie Mayo aus Australien an die Harvard University gekommen. In den USA führte er mit Kollegen die ersten großformatigen Gemeindestudien durch. Sie untersuchten mit unterschiedlichen Methoden die soziale Struktur von Newburyport, einer industriellen Kleinstadt im Nordosten der USA. Dabei fanden sie unter anderem eine starke Rolle von informalen Gruppierungen oder ➔Cliquen. In den daraus entstandenen Yankee City-Studien analysieren Warner und Paul Lunt unter anderem, inwiefern diese Cliquen nach Schichten getrennt sind (1941: 110ff; 350ff).
[34]Auch wenn Warner und seine Kollegen hier und an anderen Stellen ein Interesse an der Struktur sozialer Beziehungen zeigen, geht es hier in erster Linie um deren Verteilung: Zwischen welchen Kategorien von Personen (hier: Schichten) bestehen in welchem Umfang Sozialbeziehungen? Auf diese Weise erfährt man etwas über das systematische Muster an Beziehungen zwischen den Kategorien in einer relativ großen Population – aber nichts über die tatsächliche Struktur von Beziehungen zwischen Einzelpersonen.
Eine etwas andere Herangehensweise finden wir in den Studien von Paul Lazarsfeld, einem österreichischen Emigranten. Lazarsfeld gilt heute als Begründer der modernen Survey-Forschung. In einer der ersten breit angelegten Umfragen zeigte er mit Kollegen die große Bedeutung des persönlichen Austauschs mit anderen in der politischen Meinungsbildung (Lazarsfeld et al. [1944] 1968). Lazarsfeld und seine Mitstreiter wiesen nach: Politische Einstellungen und dann auch die Wahlentscheidung hängen viel mehr vom persönlichen Umfeld ab als etwa von den rezipierten Massenmedien (siehe auch Schenk 1995).
In einem späteren Artikel wendet sich Lazarsfeld gemeinsam mit Robert Merton dem Phänomen der ➔Homophilie zu (1954: 23ff):
Erstens bilden sich Freundschaften vor allem zwischen Personen mit ähnlichen Werten und Einstellungen. Denn hier erhalten die Beteiligten wechselseitige Zustimmung für ihre Sichtweisen, was als belohnend empfunden wird. Dies ist das Prinzip der Werte- oder Einstellungs-Homophilie.
Zweitens führt der enge und wiederholte Austausch in Freundschaften zu einer Angleichung von Werten und Einstellungen (Anpassung; siehe 10.4) oder auch zum Abbruch der Beziehung bei zu viel beharrlichem Widerspruch.
Definition: Werte- oder Einstellungs-Homophilie steht für die Tendenz, Sozialbeziehungen vor allem mit Gleichgesinnten zu bilden (und enge Beziehungen mit Andersdenkenden aufzulösen). Davon zu trennen ist der Mechanismus der Anpassung: Innerhalb von engen Sozialbeziehungen ergibt sich eine Angleichung von Werten und Einstellungen.
Diese Zusammenhänge zwischen Beziehungen und Einstellungen entsprechen recht genau Heiders Balance-Theorie. Methodisch lassen sich die Ergebnisse von Homophilie und Anpassung im Querschnitt nachweisen, wenn in einer Population mehr Sozialbeziehungen zwischen Personen mit gleichen Werten und Einstellungen bestehen, als bei einer zufälligen Verteilung zu erwarten wäre. Um diese ➔Mechanismen voneinander zu trennen, braucht[35] es aber Daten über die Veränderungen von Beziehungen und Einstellungen über die Zeit (Lazarsfeld/Merton 1954: 37ff).
Wie in den Arbeiten um Warner wird bei Lazarsfeld in statistischen Verfahren der Zusammenhang zwischen persönlichen Beziehungen und Individualvariablen untersucht. Dabei geht es aber nicht darum, zwischen welchen Kategorien sich Beziehungen bilden. Sondern der Einfluss von persönlichen Beziehungen auf individuelle Einstellungen und Verhalten (die politische Wahl) wird untersucht. Dafür müssen Netzwerke mit anderen Variablen in Beziehung gesetzt werden. Die Studien von Warner und Lazarsfeld weisen damit in eine ganz andere Richtung als die Soziometrie und die Balance-Theorie: hin zur Untersuchung und statistischen Analyse von ➔ego-zentrierten Netzwerken in Umfragen (Kapitel 8).
2.8 Britische Sozialanthropologie
Der Begriff des sozialen Netzwerks wurde allerdings erst in einem weiteren, weitgehend unabhängigen Ansatz entwickelt: der britischen Sozialanthropologie. Diese war vor allem an der University of Manchester beheimatet.
(a) Soziale Struktur bei Radcliffe-Brown
Impulse dafür gab wiederum der Ethnologe A. R. Radcliffe-Brown. Er formulierte in seiner Präsidentschaftsrede an das britische Royal Anthropological Institute:
»human beings are connected by a complex network of social relations. I use the term ›social structure‹ to denote this network of actually existing relations.« (1940: 2)
Radcliffe-Brown spricht eher nebenbei von Netzwerken, bestimmt sie aber recht genau. Zwei Aspekte sind hier wichtig:
| (1) | Mit der Bestimmung von »sozialer Struktur« als »Netzwerk von Sozialbeziehungen« wendet sich Radcliffe-Brown gegen die häufige Konzentration von Ethnologen auf die »Kultur« der von ihnen untersuchten indigenen Stämme. Kultur sei selbst nicht beobachtbar, anders als die konkreten Sozialbeziehungen. |
| (2) | Zudem fokussiert er sich auf »tatsächlich bestehende« und empirisch beobachtbare Beziehungen. Dies widerspricht etwa der Sichtweise des französischen Ethnologen Claude Lévi-Strauss. Auch er sieht soziale Struktur in »Kommunikationskanälen«, also in sozialen Beziehungen ([1952] 1962). Allerdings sucht er dahinter liegenden Regeln, die als »Tiefenstruktur«[36] für das beobachtbare Beziehungsgeflecht verantwortlich sind. Ein Beispiel dafür sind Verwandtschaftsstrukturen. Diese zeigen sich zwar in empirisch beobachtbaren Familienbeziehungen. Aber dahinter stehen kulturelle Regeln für das Verhältnis zwischen den Geschlechtern und Generationen. |
Die britische Sozialanthropologie folgt den beiden Grundintentionen von Radcliffe-Brown und fasst soziale Netzwerke als das Muster von empirisch beobachtbaren Sozialbeziehungen.
(b) Netzwerkbegriff bei Barnes
Ein Artikel von J. A. Barnes liefert 1954 die erste Ausformulierung und empirische Anwendung des Netzwerkbegriffs. Barnes untersucht die soziale Struktur in einem norwegischen Fischerdorf (Bremnes). Diese Struktur sieht er als ➔Netzwerk und bezieht sich explizit auf das graphentheoretische Modell einer Menge von Punkten, die mit Linien verbunden werden (Barnes 1954: 43f). In Bremnes gehören hierzu (abgesehen von formalen Arbeitskontexten) »Verwandtschafts-, Freundschafts- und Nachbarschaftsbeziehungen«.
Die Bewohner von Bremnes bezeichnen ihre soziale Struktur als aufgeteilt in drei Klassen oder Schichten. Barnes findet mit seinen ethnographischen Beobachtungen eher ein homogenes und dicht gestricktes Netzwerk ohne große Rangunterschiede. Insofern folgt Barnes in seiner Studie bereits dem von Emirbayer und Goodwin formulierten anti-kategorischen Imperativ (siehe 1.3): Die Selbstbeschreibung der Bewohner mit ihren drei Kategorien von Klassen wird hinterfragt und mit der empirisch beobachtbaren Netzwerkstruktur konfrontiert. In dieser bestehen eben keine Trennlinien zwischen Klassen, sondern vor allem lokal basierte Sozialbeziehungen.
Weitere wichtige Arbeiten behandeln Netzwerke von Ehepaaren in London (Bott 1957) und die Verstädterung in Afrika. Auffällig oft geht es um soziale Strukturen im Wandel, insbesondere durch den Kontakt zwischen Indigenen und westlicher Moderne.
(c) Konzeptionelle Integration bei Mitchell
In der Folge wurde J. Clyde Mitchell der wichtigste Autor der britischen Sozialanthropologie. Schon 1974 monierte er das Fehlen einer Theorie sozialer Netzwerke, die die zahlreichen empirischen Arbeiten flankieren und leiten könnte (1974: 281ff). Zudem schlug er vor, die formale Netzwerkanalyse durch die Untersuchung von Sinn, Normen und Institutionen zu erweitern (1973: 27ff). Der Vorschlag einer Zusammenschau von Netzwerkstruktur und Kultur – genau dem Bereich, von dem sich Radcliffe-Brown mit dem[37] Netzwerkbegriff abwandte – wurde in der Ethnologie erst ab den 1990er-Jahren aufgenommen, etwa von Thomas Schweizer (1996).
Der Netzwerkbegriff in der frühen britischen Sozialanthropologie markiert also folgende Herangehensweisen:
| (1) | Der Fokus wird auf die Struktur von Sozialbeziehungen gelegt statt auf kulturelle Eigenheiten und Unterschiede. Insbesondere wird den kulturellen Selbstbeschreibungen misstraut (im Sinne des anti-kategorischen Imperativs). |
| (2) | Soziale Struktur besteht aus tatsächlich bestehenden und empirisch beobachtbaren Sozialbeziehungen, nicht aus dahinter vermuteten Regeln (wie bei Lévi-Strauss, s. o.). |
Soziale Netzwerke werden vor allem qualitativ rekonstruiert auf der Basis einer ethnographischen Einbettung der Ethnologen in ihren Forschungsgegenstand (siehe 9.3). Erst spät übernehmen die Ethnologen die quantitativen Methoden der ➔formalen Netzwerkanalyse.
2.9 Résumé
Der kurze Überblick über die Entwicklung der Netzwerkforschung ist nun abgeschlossen. Dabei ging es im Rahmen dieses Lehrbuchs vor allem um einen Überblick über wichtige Themen und um, die Herangehensweisen der frühen Autoren der Netzwerkforschung. Mit diesem Überblick zeigt sich: Schon bis zu den 1950er-Jahren wurden alle vier in diesem Buch behandelten Ansätze verfolgt:
| (1) | Anstöße für die Theorie sozialer Netzwerke (Kapitel 11) kommen aus der formalen Soziologie von Georg Simmel, dem symbolischen Interaktionismus, der Figurationssoziologie von Norbert Elias und der Gruppentheorie von George Caspar Homans. Anschließend wurde die Theoriearbeit eher vernachlässigt. |
| (2) | Viele frühe Arbeiten untersuchen Netzwerke eher qualitativ (Kapitel 9). Dazu gehören die ethnographischen Methoden der Sozialanthropologie, aber auch historische Quellenstudien bei Elias. |
| (3) | Die Gemeindestudien um Warner und die frühen Survey-Studien von Lazarsfeld betrachten Zusammenhänge zwischen Sozialbeziehungen und individuellen Kategorien und Einstellungen mit statistischen Analysen ➔ego-zentrierter Netzwerke (Kapitel 8). |
| (4) | Morenos Soziometrie und die Gruppenstudien um Lewin und Mayo führen zur ➔formalen Netzwerkanalyse, also zur graphentheoretischen und formal-mathematischen Analyse von Netzwerkstrukturen innerhalb[38] abgeschlossener und einigermaßen überschaubarer sozialer Kontexte (Kapitel 3–7). |
Zugleich zeigt der Überblick, wie unübersichtlich die Wurzeln der Netzwerkforschung sind. Zum einen bauen die verschiedenen Stränge der Netzwerkforschung nur wenig aufeinander auf. Simmel, Radcliffe-Brown, die Gestaltpsychologen und mit Abstrichen Moreno scheinen praktisch unabhängig voneinander das Denken in sozialen Konstellationen zu entwickeln. Auch bei Elias und Homans fehlen Hinweise auf Vorgänger für ihre Ansätze. Zumindest die formale Soziologie war aber im deutschen Sprachraum zwischen den Weltkriegen so bekannt, dass sicher Elias (indirekt über Mannheim), Moreno und die Gestaltpsychologen damit in Berührung kamen.
Wir können die Einflussbeziehungen zwischen den frühen Ansätzen der Netzwerkforschung selbst als Netzwerk darstellen (Abbildung 3). Dabei fungieren einzelne Autoren oder Gruppen von Autoren als Akteure. Die Beeinflussung läuft immer nur von frühen zu späteren Ansätzen und ist deswegen mit gerichteten Pfeilen markiert.
Zum anderen finden wir viele Quereinsteiger in die sozialwissenschaftliche Netzwerkforschung (Moreno, Homans, später z. B. Harrison White). Auch dies belegt die Anziehungskraft des strukturellen Denkens über die Disziplinen hinweg (Ethnologie, Soziologie, Psychologie, Politikwissenschaft, etc.).
Gemeinsam ist den verschiedenen Ansätzen und Perspektiven das, was Linton Freeman die »strukturelle Intuition« nennt (2004: 3): Akteure werden nicht isoliert gedacht, sondern in Austauschbeziehungen mit anderen [39] Akteuren. Und diese Einbettung von Akteuren bzw. die Struktur zwischen ihnen entscheidet über viele soziale Prozesse. Diese strukturelle Intuition führt aber nicht nur zur formalen Netzwerkanalyse, sondern auch zu vielen anderen Herangehensweisen.
Abb. 3: Netzwerk der frühen Ansätze in der Netzwerkforschung
Quelle: Eigene Darstellung
Leseempfehlungen:
Barnes, J. A.: »Class and Committees in a Norwegian Island Parish« Human Relations 7, 39–58.
Elias, Norbert 1970: Was ist Soziologie?, Weinheim: Juventa.
Fine, Gary Alan/Sherryl Kleinman 1983: »Network and Meaning: An Interactionist Approach to Structure« Symbolic Interaction 6, 97–110.
Freeman, Linton 2004: The Development of Social Network Analysis, Vancouver: Empirical Press.
Fuhse, Jan 2006: »Gruppe und Netzwerk; Eine begriffsgeschichtliche Rekonstruktion« Berliner Journal für Soziologie 16, 245–263.
Häußling, Roger 2010: »Relationale Soziologie« in: Christian Stegbauer/ Roger Häußling (Hg.): Handbuch Netzwerkforschung, Wiesbaden: VS, 63–87.
Mitchell, J. Clyde 1969: »The Concept and Use of Social Networks« in: ders. (Hg.): Social Networks in Urban Situations, Manchester: Manchester University Press, 1–50.
Schnegg, Michael 2010: »Die Wurzeln der Netzwerkforschung« in: Christian Stegbauer/Roger Häußling (Hg.): Handbuch Netzwerkforschung, Wiesbaden: VS, 21–28.
Scott, John 2000: Social Network Analysis; Second Edition, London: Sage.
2 Eine ausführlichere Betrachtung der Entwicklung der Netzwerkforschung – auch mit einer Betrachtung der frühen Wurzeln – findet sich bei Linton Freeman (2004).
3 In der Zeitschrift schlugen Elaine Forsyth und Leo Katz 1946 erstmals vor, Morenos Soziogramme in der Form von ➔Matrizen zu repräsentieren und zu untersuchen. Moreno selbst stand diesem Vorschlag kritisch gegenüber.