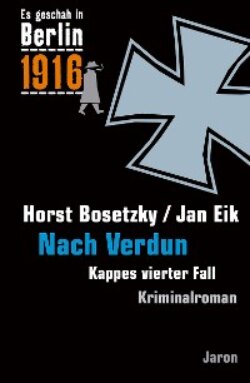Читать книгу Nach Verdun - Jan Eik, Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 8
VIER
ОглавлениеIN BERLIN herrschte zwar Ende April 1916 noch keine Anarchie, aber zunehmend das, was mit einem Begriff des französischen Soziologen Émile Durkheim als Anomie bezeichnet wird, das heißt, die deutsche Gesellschaft zeigte sich in einem Zustand, in dem die traditionellen Werte keine Autorität mehr besaßen, neue Ideale, Ziele und Normen aber noch nicht an ihre Stelle getreten waren. Eine für alle verbindliche Ordnung existierte nicht mehr, wenn sie denn seit 1848 je existiert hatte.
Am 23. Februar 1915 war im Bereich der «Brotkartengemeinschaft für Groß-Berlin» die tägliche Ration auf 225 Gramm Mehl festgelegt worden, und die Ernährungslage wurde immer schlechter. Schon wurde die Einrichtung von Großküchen erwogen. Kein Wunder, dass unter diesen Umständen erst das Essen kam und dann die Moral - und ein Mann wie der Handgranatenmörder überall Unterschlupf finden konnte. Wer im Verdacht stand, einen Schmarotzer wie Erich Röddelin aus dem Verkehr gezogen zu haben, konnte mit der klammheimlichen Freude vieler rechnen.
So waren bereits über sechs Wochen vergangen, ohne dass die Mordermittler in der Sache Röddelin irgendein Ergebnis vorweisen konnten. Nach dem Anarchisten Ernst Bergmann, dem mutmaßlichen Täter, war vergeblich gefahndet worden. Sein Vorstrafenregister war beachtlich. Zumeist hatte er wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt gesessen, aber auch, weil er in die Fabriken und Villen von Unternehmern eingedrungen war und dort einigen Schaden angerichtet hatte. Einen Fabrikanten hatte er so verprügelt, dass der mit einer Gehirnerschütterung und mehreren Rippenbrüchen ins Krankenhaus gekommen war. Der Richter hatte Bergmann eine Neigung zum Jähzorn und zum blinden Hass unterstellt.
Zuletzt war Bergmann in der Holteistraße polizeilich gemeldet gewesen, also ganz in der Nähe des Röddelinschen Kolonialwarenladens, dort aber am 29. Februar ausgezogen, ohne sich anderswo wieder anzumelden. Seiner Wirtin hatte Bergmann gesagt, er würde zu einem Freund in eine Laube ziehen. Da es unmöglich war, jede der zig Berliner Laubenkolonien zu durchkämmen, waren sie in der Mordkommission am Alexanderplatz gezwungen, abzuwarten und zu hoffen, dass der Mann nicht ein zweites Mal zuschlug. Blieb nur der zynische Trost, wie ihn Galgenberg formulierte: «Wer in Verdun einen anderen mit ’ner Handgranate ins Jenseits geschickt hat, der wird ja auch nie zur Verantwortung gezogen werden.»
«Und kriegt sogar noch ’n Orden umgehängt», fügte Kappe hinzu.
Galgenberg hatte das Berliner Tageblatt vor sich ausgebreitet und referierte, was sich an den verschiedenen Fronten getan hatte.
« Tag und Nacht Artilleriekämpfe um Verdun. Französische Gräben links der Maas genommen. Ein englisches U-Boot versenkt. Ein russisches Linienschiff mit Bomben belegt. Nichts Neues an den k. u. k.-Fronten. »
In diesem Moment erschien Waldemar von Canow in der Tür, er hatte die letzten Worte mitbekommen.
«Das ist ja wie bei Ihnen, meine Herren: Nichts Neues an der Front, was den Handgranatenmörder betrifft!», rief er.
«Manchmal ist eben jede Kunst vergeblich», sagte Kappe. «Bei Röddelin war es die ärztliche, bei uns ist es die kriminologische. Bergmann ist und bleibt abgetaucht. In Wendisch Rietz wäre er ja aufzustöbern, nicht aber in Berlin. Zumal wir immer weniger Männer haben.»
«Das weiß ich selber!», fauchte von Canow ihn an. «Aber ein guter Kriminaler hat eben überall seine Informanten.»
«Die habe ich auch», sagte Galgenberg. «Aber von denen ist noch nichts gekommen. Man müsste mal eine kleine Belohnung aussetzen: zwei Brote und ein Pfund Butter. Dafür tut doch heute jeder alles.»
«Galgenberg, unterlassen Sie Bemerkungen wie diese!» Galgenberg nickte und stand auf, um sich zur Toilette zu begeben. «Jut, dann muss ick ebent wat anderet unter mir lassen.» Galgenberg konnte sich einen solchen Ton erlauben, denn sein Wissen um die Dinge, erworben in langen Dienstjahren, machte ihn unangreifbar. Außerdem war er kein Sozi, sondern hing deutschnationalen und monarchistischen Werten an und hatte deshalb in der Polizeiführung genügend Leute, die ihn deckten. Man wusste auch, dass von Canow nicht gerade der Hellste war und ohne Pragmatiker wie Galgenberg gescheitert wäre.
Wie auch immer, Galgenberg zog, kaum war er von der Toilette zurück, das gemeinsame Telefon zu sich herüber und begann alle anzurufen, die er sozusagen als private V-Leute auf seiner Liste stehen hatte. Meist waren es kleine Ganoven und zwielichtige Geschäftsmänner, aber auch Frauen aus dem horizontalen Gewerbe, denen er irgendwann einmal geholfen hatte. Meist dadurch, dass er beide Augen zugedrückt hatte. So etwas zahlte sich meistens aus. So auch im Fall Ernst Bergmann. Jemand flüsterte Galgenberg ins Ohr, dass er den mutmaßlichen Handgranatenmörder in einem Lokal in der Nostizstraße 16 gesehen habe.
Sie beschafften sich einen weiteren Vorrat an Dienstfahrscheinen und machten sich auf den Weg nach Kreuzberg.
«Ich werde mal bei von Canow einen Antrag stellen, dass sie für uns einen Straßenbahnwagen als rollendes Büro anmieten», sagte Kappe. «Bei der Zeit, die wir unterwegs sind.»
Galgenberg war begeistert von dieser Idee. «Da stehe ick dann aba selba an da Kurbel. Det war schon imma mein Traum.»
«Meiner aber auch», bekannte Kappe.
Diesmal brauchten sie nicht lange nach der optimalen Verbindung zu suchen, denn mit der Linie 3, dem Großen Ring, kamen sie ohne Mühe vom Alexanderplatz zur Gneisenaustraße. Die Kreuzung Nostizstraße war schnell erreicht.
Galgenberg zeigte nach Süden. «Da hinten ham se unsam Handgranatenmörder schon ’n Denkmal gesetzt.»
«Wieso das?» Auch nach sechs Jahren gemeinsamen Dienstes wollte es Kappe nicht gelingen, sofort zu verstehen, was Galgenberg meinte.
«Na, weil da die Bergmannstraße liegt!»
«Ah ja.»
Kappe hätte das eigentlich wissen müssen, denn ganz in der Nähe hatte er bei den Grenadieren gedient. Dafür wusste er, dass die Nostizstraße eine Hochburg der Roten war, der SPD, aber vor allem derer, die links von ihr standen. Deren Kreise zu stören rief bei ihm ein gehöriges Unbehagen hervor, doch Mörder war Mörder, und er hätte seinen eigenen Bruder, ohne zu zögern, der Justiz übergeben, wenn der einen anderen Menschen mit einer Handgranate getötet hätte.
«Hat es denn Sinn», fragte er Galgenberg, «wenn wir beide ins Lokal gehen und nach Bergmann fragen? Uns sieht doch jeder an, wer wir sind …»
Der Kollege lachte. «Nach Bergmann muss man nicht fragen, den erkennt man auf den ersten Blick: Er sieht wie ein Neandertaler aus.»
So gingen sie hinein, bestellten sich je ein Bier, konnten aber Bergmann nicht entdecken. Von allen Gästen erkannt und durchschaut wurden sie auch nicht, nur der Zapfer, der ihnen ihr Bier an den Tisch brachte, wusste, wer Kappe war. Man kannte sich vom Fußball her.
«Na, Hermann, tust de wat für deine Form, nächsten Sonntag gegen 95, den 1. FC Neukölln?»
«Irrtum, auf dem Exer gegen Alemannia 90. Aber meinste denn, wir kriegen elf Mann zusammen?»
«Ick bringe meine beeden Söhne mit.»
«Die sind doch erst vierzehn», wandte Kappe ein.
«Meinste denn, die in Verdun geben Schulle, Spinne und Murkel det Wochenende frei?»
«Nee, aber …» Kappe sah sich um, ob auch niemand mithörte.
«Und wie ist es mit Ernst Bergmann, kann der nicht …?»
«Nee, der kann nich. Aber frag mal bei dem Liebknecht nach, in dem sein Büro. Oder bei Stiller.»
Sie gaben dem Mann reichlich Trinkgeld, obwohl nicht sicher war, ob von Canow das als Spesen akzeptieren würde, und gingen zum Postamt am Halleschen Tor, um im Telefonbuch nachzusehen, wo das Anwaltsbüro Karl Liebknechts zu finden war.
«Chausseestraße 121.»
Dort, das wusste Kappe von seinem Freund Theodor Trampe, hatte die «Gruppe Internationale» am 1. Januar 1916 ihre erste Reichskonferenz abgehalten. Den Namen hatte sie sich gegeben, weil Rosa Luxemburg ihren alles entscheidenden Satz «Am 4. August 1914 hat die deutsche Sozialdemokratie politisch abgedankt» in der Zeitschrift Die Internationale veröffentlicht hatte.
«Chausseestraße», wiederholte Galgenberg. «Det is ja det nächste Ende von hier. Und wat is mit diesem Stiller, is dit der Schuhfritze?»
«Carl Stiller? Wohl nicht.» Kappe überlegte. «Irgendwann hat mir Trampe auch mal was von einem Stiller erzählt, und der hieß …» Er brauchte ein paar Sekunden, bis er es hatte: «Alfred.»
Laut Adressbuch gab es einen Maler namens Alfred Stiller mit einem Atelier am Blücherplatz 2, und da es von der Nostizstraße bis dorthin nur ein Katzensprung war, beschlossen sie, zuerst ihn nach Bergmann zu fragen.
Als sie die Wohnung Alfred Stillers betraten, war auf einen Blick zu erkennen, wo dieser politisch stand, denn überall lagen Entwürfe mit roten Fahnen herum, dazu Plakate und Flugblätter, auf denen dazu aufgerufen wurde, am 1. Mai um acht Uhr abends auf dem Potsdamer Platz zu erscheinen:
Auf zur Maifeier! Am 1. Mai reichen wir über alle Grenzsperren und Schlachtfelder hinweg die Bruderhand dem Volke in Frankreich, in Belgien, in Rußland, in England, in Serbien, in der ganzen Welt! Am 1. Mai rufen wir vieltausendstimmig: Fort mit den ruchlosen Verbrechern des Völkermordes! Nieder mit den verantwortlichen Machern, Hetzern und Nutznießern! Unsere Feinde sind nicht das französische, russische oder englische Volk, das sind deutsche Junker, deutsche Kapitalisten und ihr geschäftsführender Ausschuß: die deutsche Regierung!
Kappe teilte grundsätzlich diese Meinung, wenn er es auch als Beamter mit starker Neigung zur Sozialdemokratie nie so krass formuliert hätte, während Galgenberg die Galle hochkam, wenn er so etwas las. Die Obrigkeit war von Gott, so wie es im Paulus-Brief an die Römer stand und wie er es bei den Konfirmanden gelernt hatte:
Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung; die aber widerstreben, werden ein Urteil über sich empfangen.
Kappe wartete, bis Alfred Stiller, der gerade über eine Lithographie gebeugt stand, zu ihm aufsah. «Entschuldigen Sie bitte … Wir suchen den Genossen Bergmann, Ernst Bergmann.»
«Den könnt ihr lange suchen. Raus hier!»
Zu einer Hausdurchsuchung reichten die Fakten nicht, und so blieb ihnen nichts weiter übrig, als abzuziehen und es bei Karl Liebknecht zu versuchen. Am schnellsten wären sie mit der neuen UBahn, der sogenannten Nord-Süd-Bahn, am Ziel gewesen. Doch die fuhr noch nicht. Zwar hatte man schon am 2. Dezember 1912 mit dem Bau begonnen, aber auch hier waren die Bauarbeiten kurz nach Beginn des Krieges wieder eingestellt worden. Also blieb ihnen wieder nur die langsam durch die Stadt zuckelnde Straßenbahn. Galgenberg als Berliner Urgestein hatte zwar die Linienpläne der vielen konkurrierenden Straßenbahngesellschaften weitgehend im Kopf, brauchte aber bei deren Durcheinander doch einige Zeit, ehe er herausgefunden hatte, wie sie am besten vom Halleschen Tor zur Chausseestraße kamen.
«Ganz einfach: Mit der Hochbahn zum Kottbusser Tor und dort umsteigen in die 28.»
Karl Liebknecht war, nachdem er seine Doktorarbeit an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg mit einem magna cum laude abgeschlossen hatte, nach Berlin gekommen und hatte hier 1899 zusammen mit Oskar Cohn und seinem Bruder Theodor ein Anwaltsbureau eröffnet.
Als Kappe und Galgenberg dort eintraten und frohgemut nach Ernst Bergmann fragten, schlug ihnen dieselbe eisige Ablehnung entgegen wie schon bei Alfred Stiller. Ein Anwaltsgehilfe gab ihnen einen höhnischen Rat mit auf den Weg: «Kommen Sie doch am 1. Mai auf den Potsdamer Platz, da finden Sie ihn ganz bestimmt.»
Galgenberg lüftete seinen Hut. «Danke sehr, der Herr, machen wir.»
Der 1. Mai fiel im Jahre 1916 auf einen Montag, und Kappe nutzte den Sonntag davor, um auf andere Gedanken zu kommen. Das gelang ihm am besten, wenn er Fußball spielte. Schon lange war er ja Mitglied bei Viktoria 89. Vor dem Krieg hatte es bei ihm nie zur ersten Mannschaft gereicht, dazu erschien er den Übungsleitern doch zu ungelenk und schläfrig, aber nun, da die besten Kicker alle im Felde standen, war man froh, mit ihm die Mannschaft auffüllen zu können, und stellte ihn auf. Wenn auch nur als Linksaußen, weil er dort am wenigsten Schaden anrichten konnte.
Auf dem «Gelände an der einsamen Pappel» an der Schönholzer Allee, einem ehemaligen Exerzierplatz und darum im Volksmund «Exer» genannt, ging es gegen Alemannia 90, im selben Jahr wie Viktoria als «Jugendlust» gegründet.
Es dauerte eine Weile, bis sie herausbekamen, auf welchem der vielen Plätze sie heute spielen sollten. Als sie es erfahren hatten, bemerkten sie, dass im Vorspiel die Latte zerbrochen war. Nach einigen Mühen war aber ein Zimmermann gefunden, der das gute Stück reparierte.
Die beiden Mannschaften nahmen Aufstellung. Vor dem Torwart gab es den rechten und den linken Verteidiger, dann kamen die Läufer: rechter Läufer, Mittelläufer und linker Läufer, vor ihnen die Stürmer: der Halbrechte und der Halblinke sowie Rechtsaußen, Mittelstürmer und Linksaußen. Das größte Prestige hatten der Mittelläufer und der Mittelstürmer sowie der Spielmacher auf halbrechts oder halblinks, immer balltechnisch beschlagen und mit dem strategischen Überblick eines Feldherrn.
Anpfiff. Als der ertönte, musste Kappe unwillkürlich an Galgenberg denken, der sofort gerufen hätte: «Nicht doch, Anpfiffe kriege ick schon im Dienst jenuch!»
Es war schwer, einmal abzuschalten. Schon gar nicht gelang ihm dies, als ihr Mittelstürmer einen gewaltigen Schuss aufs Tor abgefeuert hatte.
«Mann, war det ’ne Granate!», rief einer der Zuschauer. Kappe zuckte zusammen, denn er hatte sofort wieder ihren Misserfolg bei der Ergreifung des Handgranatenmörders vor Augen.
Noch mehr erschrak er aber, als er Klara unter den Zuschauern erblickte. Das konnte nichts Gutes bedeuten. Sie trat an die Barriere und winkte ihn heran. Er ließ sich Zeit.
Neben ihm schrie ihr Halblinker auf. Er hatte einen Schuss in den Unterleib abbekommen und wand sich am Boden.
«Mach hier nicht den sterbenden Schwan!», kam es von den Rängen. «Wir sind nich vor Verdun!»
«Mann, hab da nich so!», schrie ein anderer. «Det war nur ’n Ball und keen Schrapnell!»
Ein Dritter gab sich als Sanitäter. «Reib dir den Sack, aber kräftig - und gleich pinkeln gehen, sonst kriegste keene Kinda mehr.» Kappe nutzte die Spielunterbrechung, um zu Klara zu gehen und sie mit einem kurzen Kuss auf die Wange zu begrüßen.
«Das ist ja lieb von dir, dass du dich mal sehen lässt, wenn ich spiele …»
«Wir müssen nachher unbedingt noch über unsere Hochzeit reden.»
Kappe überlegte lange, wie er dem entgehen konnte. Eine Gelegenheit dazu bot sich erst kurz vor dem Halbzeitpfiff. Da stieg er zu einem Kopfball hoch und stieß dabei so unglücklich mit einem Gegenspieler zusammen, dass seine Augenbraue aufplatzte. Das war nicht schlimm, er blutete aber, so sollte es der Schiedsrichter später im Spielbericht vermerken, wie ein angestochenes Schwein und musste ins Krankenhaus, um genäht zu werden.
Als das erledigt war, sah er den Arzt so treuherzig an, wie er eben konnte. «Ob Sie meiner Braut nicht sagen können, ich hätte eine Gehirnerschütterung und müsste noch zur Beobachtung hierbleiben? Sie möge aber bitte schon nach Hause gehen.»
«Muss Liebe schön sein», murmelte der Doktor und tat ihm den Gefallen.
Am nächsten Nachmittag war alles vergessen, nur ein dickes Pflaster klebte noch auf seiner rechten Augenbraue. Kappe hatte sich mit Theodor Trampe in der Waldemarstraße vor der Haustür getroffen, um mit ihm zur großen Maikundgebung auf dem Potsdamer Platz zu fahren. Galgenberg stieß am Kottbusser Tor zu ihnen.
«Wohl dem, der eine Gehirnerschütterung hat», sagte Galgenberg, als er von Kappes Malheur erfuhr. «Weeß man wenichstens, det da wat is, wat erschüttert werden kann. Bei manch eenem Zeitjenossen wär ick mir da nich so sicher.»
Während Trampe rein privat zum Potsdamer Platz fuhr, um Karl Liebknecht zu lauschen, waren Kappe und Galgenberg dienstlich unterwegs, wobei Kappe gern das Private mit dem Nützlichen verband, Galgenberg hingegen linke Sozis wie Karl Liebknecht nicht ausstehen konnte.
«Klar, die Welt muss vabessert werden, aba nich von Knallköppen, wie der eena is.»
«Na, hören Sie mal!», rief Trampe.
«Nee, kann ick nicht», entgegnete Galgenberg. «Ick bin ja schließlich nich mein Nachbar.»
«Was hat denn das mit Ihrem Nachbarn zu tun?», wollte Trampe wissen.
«Na, der heißt Völker und hört immer die Signale - die, von denen Sie imma singen.»
Theodor Trampe unterließ es, den Agitator zu spielen. Einem Mann wie Galgenberg konnte man nicht böse sein. Ohne Gemütsathleten wie ihn wäre das Leben kaum zu ertragen gewesen.
Obwohl Kappe eng mit Trampe befreundet war, hatte er ihm nicht verraten, was sein eigentlicher Grund war, zum Potsdamer Platz zu fahren, denn dass er darauf aus war, Ernst Bergmann zu verhaften, hätte Trampe gar nicht gefallen. Kappe konnte sich nicht entscheiden, was er hoffen sollte: dass sie Bergmann trafen oder dass sie Bergmann nicht trafen.
Wie er aussah, wussten er und Galgenberg ziemlich genau, denn bei der Politischen Polizei gab es ein paar Photos von ihm. Und da hatte die Röddelin gar nicht mal so unrecht, denn Bergmann sah wirklich aus wie ein Neandertaler. Aber dass ihnen dieser Neandertaler bei einer Massenkundgebung in die Arme lief, war praktisch ausgeschlossen, es sei denn, man vertraute Galgenbergs Welterkenntnis Nummer eins, die da lautete: «Haste Glück, machste dick.»
«Janz schön wat los hier», sagte Galgenberg, als sie am Potsdamer Platz aus der U-Bahn stiegen. «Wenn die mir alle ’ne Mark schenken würden, hätte ick für den Rest meines Lebens ausjesorgt.» Alles drängte in Richtung Rednertribüne. Man lief Ellenbogen an Ellenbogen, und teilweise war die Drängelei so groß wie auf dem Bahnsteig Alexanderplatz beim Entern eines gerade eingefahrenen Stadtbahnzuges. Unter den Arbeitern bemerkte Kappe auffällig viele Frauen und Jugendliche. Die ersten Scharmützel mit der Polizei ließen nicht lange auf sich warten. Einige Arbeiter hatten unten an ihren Spazierstöcken Nadeln angebracht, und pikte man mit denen in die breiten Hinterteile der Polizeipferde, bäumten die sich auf, gingen durch und verhinderten so eine befohlene Attacke.
Als es einer ausprobierte, ließ der Effekt nicht lange auf sich warten: Die Blauen und ihre Offiziere wurden nervös und fingen an, die Masse mit Fäusten hin und her zu stoßen.
Kappe hatte Mühe, nicht in Panik zu verfallen. Hier zerquetscht zu werden war auch kein schöner Tod. Wäre er doch bloß Wachtmeister in Wendisch Rietz und Storkow geblieben! Welcher Teufel hatte ihn nur geritten, ausgerechnet hier nach dem Handgranatenmörder zu suchen?
Sie waren zu weit von der Rednertribüne entfernt, um sein Gesicht deutlich erkennen zu können, sie hörten aber deutlich die sonore Stimme Karl Liebknechts: «Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung!»
«Bravo!», rief Trampe.
«Pfui!», schrie Galgenberg.
Kappe lag mit seiner Meinung irgendwo dazwischen und wusste nicht so recht, wie er seine Gefühle in Worte fassen sollte. Außerdem … Er rammte Galgenberg den Ellenbogen in die Seite.
«Mensch, da ist der Bergmann!»
Richtig, der Mann, der da etwa zehn Meter von ihnen entfernt an einem Laternenpfahl lehnte, musste es sein. Stichwort: Neandertaler.
Nun ging alles ganz schnell. In dem Moment, als sie sich durch die Menge drängeln wollten, um Ernst Bergmann zu verhaften, wurde Karl Liebknecht, der kurz zuvor festgenommen worden war, inmitten eines Knäuels von Polizisten zur Wache abgeführt.
«Hoch, Liebknecht!», rief Theodor Trampe.
Sofort waren zwei Polizisten zur Stelle, um auch ihn zu arretieren.
Kappe zögerte keinen Augenblick, den Freund herauszuhauen, und zückte seine Marke.
«Das ist meiner, den habe ich schon festgenommen, der hat mir eins aufs Auge gegeben.»
Da unter dem Pflaster auf der Augenbraue noch alles blau war, zog dieses Argument, und man ließ Trampe los.
Als sich Kappe wieder auf Bergmann konzentrieren wollte, war der verschwunden. Nein, Galgenberg war ihm noch dicht auf den Fersen …
Doch auch Galgenberg hatte keinen Erfolg, denn die Berittenen hatten inzwischen blankgezogen, und ein Hieb mit der flachen Seite eines Säbels warf ihn nieder.