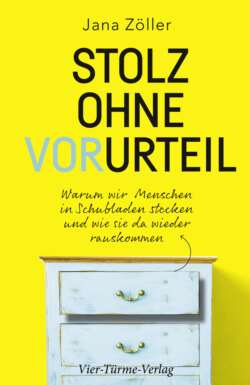Читать книгу Stolz ohne Vorurteil - Jana Zöller - Страница 5
Оглавление1. Kapitel Die Kanaken – Oder: Warum nicht nur der Döner zu Deutschland gehört, sondern auch der Dönermann
Weißt du, was ein Kanake ist? Na klar, ein Schimpfwort für Türken. Steht sogar im Duden. Allerdings ist die Verwendung als Schimpfwort nur an zweiter Stelle genannt, denn zuerst steht die eigentliche Bedeutung, die eine ganz harmlose ist: Ein Kanake ist ein Ureinwohner der Südseeinseln. Das Wort entstammt vermutlich dem Hawaiianischen. Es wurde zunächst in verschiedenen europäischen Regionen positiv zweckentfremdet als Begriff für alle ausländisch aussehende Menschen und in Deutschland erst mit dem Anwerbeabkommen in den Siebzigerjahren im negativen Sinn für Gastarbeiter benutzt. So wie ein harmloses Wort zu einem Schimpfwort werden kann, kann ein friedvoller Mensch zu einer Projektionsfläche für Vorurteile und Ängste werden.
Wir beurteilen Menschen auf den ersten Blick danach, wie sie aussehen. Wie eingangs beschrieben, ist das soweit normal. Schwierig ist dennoch für »anders« beziehungsweise »fremd« aussehende Menschen, was diese Ausgrenzung mit ihnen macht: Sie gehören von vornherein nicht dazu. Sie werden nicht als Deutsche wahrgenommen, ob sie hier geboren sind oder nicht. Nur in zwei Dingen sind sie für unsere Gesellschaft selbstverständlich: Wenn sie günstig ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen oder zum Wohlbefinden der restlichen Bevölkerung beitragen. Denn ihre Dienstleistungen werden gern in Anspruch genommen: Italiener sind gut genug, um uns eine leckere Pizza zu backen, Russen, um unseren Kindern Klavierunterricht zu geben, Chinesen, um uns Akupunkturnadeln zu setzen, Thailänder, um uns den Rücken zu kneten, Polen, um unsere Alten zu pflegen, Bulgaren, um unser Obst zu ernten, und Türken, um uns billig die Waschmaschine zu reparieren und selbstverständlich den geliebten Döner zu servieren. Wir brauchen sie, um unsere Gesellschaft am Laufen zu halten – und besonders oft brauchen wir sie, um die weniger schönen Aufgaben erledigen zu lassen oder möglichst günstig an Dinge zu kommen, für die ein »Deutscher« mehr Geld verlangen würde. Sie sind jedoch alle nicht gut genug, um losgelöst von ihrer Herkunft als gleichberechtigter Teil unserer Gesellschaft wahrgenommen zu werden. Ob es ein türkischer, russischer oder italienischer Nachname ist: Er erschwert seinem Träger die Ausbildungs-, Arbeits- oder Wohnungssuche bereits, bevor das Gegenüber ihn überhaupt kennengelernt hat. Der Stempel »nicht deutsch« ist innerhalb von Sekunden aufgedrückt, aber nur extrem mühsam wieder zu entfernen.
Jede Gruppe von Menschen, die nach Deutschland eingewandert ist, ebenso wie jeder Einzelne, hat eine ganz persönliche Einwanderungsgeschichte. Beispielhaft für die vielen verschiedenen Nationen möchte ich in diesem Kapitel besonders auf Menschen mit türkischstämmigem Hintergrund eingehen, da ich mich während eines Auslandssemesters in der Türkei sowie in den Jahren davor und danach besonders damit beschäftigt habe. Darüber hinaus sind viele von ihnen Muslime, und das führt in Deutschland ganz besonders zu Ausgrenzung und Vorurteilen.
In der Bundesrepublik leben drei Millionen Türken (beziehungsweise Türkischstämmige), doch wenn über sie gesprochen wird, dann fallen vielen zuerst die Unterdrückung der Frau (»Die müssen alle Kopftuch tragen«) und die radikalen Islamisten ein (»Die sprengen uns noch alle in die Luft«). Die deutsche Rechnung lautet schnell: Türken = Muslime = Islamisten = Gefahr für Deutschland. Darüber hinaus werden sie für ungebildet und rückständig gehalten. Aber woher kommen diese Vorurteile?
Warum haben türkischstämmige Menschen hier einen so schlechten Stand?
Wir vergessen gerne, dass es Menschen aus der Arbeiterschicht waren, die beim Anwerbeabkommen in den Sechziger- und Siebzigerjahren nach Deutschland geholt wurden. Damals sind Türken und Italiener nicht von allein gekommen, die Deutschen wollten sie haben. Die hiesige Wirtschaft boomte, und es gab nicht genug Deutsche, die in den Fabriken arbeiten konnten oder wollten. Also holte man Türken und Italiener hierher. Angefordert wurden aber nicht die Studierten, sondern jene, die für wenig Geld viel wegschaffen konnten. Wichtigstes Kriterium war dabei, dass die sogenannten »Gastarbeiter« (überwiegend männlich) gesund und kräftig waren. Dass sie bereits eine Ausbildung hatten, war ausdrücklich nicht erwünscht, sodass einige Türken auf der Istanbuler Verbindungsstelle lieber verschwiegen, wenn sie doch eine Ausbildung hatten. Die meisten waren tatsächlich aber nicht besonders gebildet. Die Deutschen wollten damals billige Arbeitskräfte, die keine Fragen stellen, und heute werden als Migranten gut ausgebildete Menschen erwartet, die sich in die Gesellschaft einfügen, als wären sie schon immer Deutsche gewesen. Das lässt sich nur schwer damit rechtfertigen, dass die Gastarbeiter nach ein paar Jahren, wenn sie Deutschland genug zu Reichtum verholfen hatten, wieder nach Hause zurückkehren sollten. Die Hälfte von ihnen ging tatsächlich zurück, die andere Hälfte blieb – aber nicht nur, weil sie das unbedingt wollten, sondern auch, weil ihre Arbeitskraft weiter benötigt wurde. So etwas wie Integrationskonzepte gab es trotzdem weiterhin nicht. Integration musste also quasi von selbst laufen; die Ungebildeten mussten sich vielerorts allein um Bildung und Anschluss bemühen.
Eine der größten Schwierigkeiten bei der Integration war für Türkischstämmige mit Sicherheit die deutsche Sprache. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Türkisch ist so schwer! Deutsch und Türkisch sind vom Aufbau der Sprachen sehr unterschiedlich. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum du möglicherweise nicht besonders viele Wörter auf Türkisch kennst. Wie viele »Deutsche« gehen in eine italienische Pizzeria und begrüßen mit einem »Ciao« oder »Buon Giorno« und bedanken sich mit einem »Grazie«? Und selbst wenn sie das nicht tun, wüssten sie vermutlich wenigstens, wie das geht. Aber obwohl Türkischstämmige mit Abstand den größten Anteil der Migranten in Deutschland darstellen und obwohl viele von uns zumindest hin und wieder einen Döner essen, wissen die meisten nicht, was guten Tag (iyi günler) oder danke (teşekkürler) heißt. Das liegt zumindest zum Teil sicher auch daran, dass die türkische Sprache für uns einfach nicht eingängig ist. Versuche mal, dir zu ergründen, was yakışıklı (gutaussehend) oder çilek (Erdbeere) heißt. Da kommt man ohne Wörterbuch nicht weit. Im Englischen, Französischen, Italienischen oder Spanischen können wir uns viele Wörter irgendwie herleiten, im Türkischen geht das nur selten.
Umgekehrt geht es vielen Türken, die versuchen, Deutsch zu lernen. Im Türkischen werden alle möglichen Wörter, Fälle oder Pronomen nicht etwa als eigenes Wort in einen Satz gebaut, sondern als Endung an ein Wort drangehängt. So kann es zum Beispiel sein, dass ein deutscher Satz plus Nebensatz im Türkischen nur durch ein einziges Wort ausgedrückt wird. Das längste Wort der Welt ist übrigens ein Türkisches – es hat 75 Zeichen:
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesinesiniz.
Übersetzt heißt das so viel wie: »Sie scheinen einer dieser Menschen zu sein, die wir nicht in jemanden verwandeln können, der jemanden erfolglos macht« – was auch immer das im übertragenen Sinne heißen mag; der Satz stammt aus einer fiktiven Geschichte. Weil man sich türkische Sätze eher zusammenpuzzelt als einfach Vokabeln zu lernen, kam es mir immer so vor, als würde ich Mathe anstatt einer Sprache lernen. Für Türken wiederum ist es schwer, dass sie sich viel mehr Begriffe merken müssen. Während die türkische Sprache über 150 000 Wörter verfügt, gibt es in der deutschen über 500 000. Hinzu kommt, dass Türken Wörter lernen müssen für Dinge, die es in ihrer Sprache überhaupt nicht gibt. Kein Wunder, dass sie Probleme haben, den richtigen Artikel zu benutzen, wenn es im Türkischen gar keine Artikel gibt und auch Verben deutlich sparsamer verwendet werden. »Die Mutter ist krank« heißt »Anne hasta«. Punkt. Vor dem Hintergrund muss ich sagen, dass ich schon gleich viel mehr Respekt vor den Türken habe, die überhaupt Deutsch können.
Was passieren kann, wenn man die deutsche Sprache nicht richtig lernt, möchte ich dir anhand der Geschichte von Mehmet erzählen. Ich habe ihn während meiner Arbeit in einem Internationalen Begegnungszentrum kennengelernt. Mehmet war das, was ich als »Checker-Typ« bezeichnen würde. So »Ey jo, voll cool drauf und so«. Netter Typ, etwas zu lässig, aber im Herzen eine gute Seele. Seine Rechtschreibung und auch der korrekte deutsche Sprachgebrauch ließen ehrlich gesagt sehr zu wünschen übrig, was ihm in seinem Studium der Sozialen Arbeit manches Mal im Weg stand. Dass er es aber überhaupt geschafft hat, ein Studium zu beginnen, war ein hartes Stück Arbeit.
Zu Hause hat Mehmet mit seiner Mutter immer nur Türkisch gesprochen. Sein Vater hat sich bemüht, Deutsch mit ihm zu reden, aber leider war das Deutsch des Vaters auch nicht sehr gut. Die Folge: Mehmet hat schlechtes Deutsch gelernt. Mein Türkischlehrer an der Uni (selbst türkischstämmig) hat mir einmal gesagt, dass Kleinkinder lieber gar kein Deutsch lernen sollten als schlechtes Deutsch. Er hielt es für schlauer, ihnen zuerst die türkische Sprache richtig beizubringen, damit sie ein Gefühl für Sprache entwickeln und wenigstens ein Sprachsystem fehlerfrei beherrschen. Wenn sie eine Sprache können, dann lernen sie danach auch leichter eine andere. Denn was man einmal falsch gelernt hat, lässt sich später nur schwer wieder vergessen oder durch Richtiges ersetzen.
So ist die sprachliche Barriere auch Mehmet zum Verhängnis geworden. Da die Familie in einem Brennpunkt von Köln wohnte, war er überwiegend mit anderen Migrantenkindern im Kindergarten, die alle entweder ihre Muttersprache oder schlechtes Deutsch sprachen. In der Grundschule wurde es nicht besser. Mehmet hatte Probleme, beim Unterrichtsstoff mitzukommen, weil er oft gar nicht richtig verstand, worum es ging. Auch wenn er schon als kleines Kind mit Onkel Emre in seinem Laden Gemüse gezählt hatte, scheiterte er daran, die Textaufgaben im Matheunterricht zu verstehen. Seine Lehrerin schaute leider nicht genau genug hin und sah deswegen nicht, dass Mehmet nicht dumm war, sondern nur sprachliche Probleme hatte. Deswegen bekam er von ihr nach der Grundschule eine Empfehlung für die Hauptschule. Mehmets Vater wusste, dass sein Sohn dadurch in Deutschland keine besonders guten Karrierechancen haben würde und sprach mit der Lehrerin. Doch die bügelte ihn ab: Er könne froh sein, dass Mehmet keine Förderschulempfehlung bekommen habe.
Also ging Mehmet zur Hauptschule. Als er in der sechsten Klasse war, lernte er in einem Jugendzentrum den Sozialarbeiter Jan kennen. Mehmet und Jan verstanden sich sofort, und Jan entdeckte, dass in Mehmet viel mehr steckte als der »begriffsstutzige kleine Türkenjunge«. Also übte er mit ihm bis zum Umfallen deutsche Vokabeln und Grammatik. Durch Jans Einsatz wechselte Mehmet nach der Erprobungsstufe auf eine Gesamtschule und schaffte dort sogar später sein Abitur. Nach seinem großen Vorbild Jan wollte auch Mehmet Sozialarbeiter werden, da er selbst erfahren hatte, wie viel man im Leben Einzelner bewegen kann.
So wie Mehmet geht es vielen jungen Menschen mit Migrationshintergrund. Die erste Generation, die nach Deutschland gekommen ist, hat sich mit der Sprache schwergetan, und die folgenden Generationen haben einen falschen Sprachgebrauch übernommen. Die Väter in der ersten Generation lernten oft auf der Arbeit noch mehr oder weniger gut Deutsch, aber die Frauen, die zu Hause blieben und damit erste Ansprechpersonen für die Kinder waren, lernten es kaum. Sie blieben im fremden Land in einer Community mit anderen türkischstämmigen Frauen und konnten dort auch sehr gut ohne Deutschkenntnisse zurechtkommen. Das mögen wir vielleicht verwerflich finden, weil das nach außen deutlich macht: »Ich möchte mich nicht integrieren.« Ich halte es persönlich auch für schwierig, wenn einige bis heute nicht mal zielsicher »Hallo«, »Bitte«, »Danke« und »Auf Wiedersehen« sagen können. So viel sollte nach teilweise fünfzig Jahren in Deutschland schon drin sein. Aber das Ganze ist keine typisch türkische Eigenschaft: Auf Mallorca leben zum Beispiel etwa 30 000 gemeldete Deutsche, und es wird geschätzt, dass es noch einmal so viele gibt, die sich aus steuerlichen Gründen dort nicht gemeldet haben. Damit sind Deutsche die größte ausländische Bevölkerungsgruppe auf Mallorca. Sie werden von Mallorquinern geduldet, aber vielerorts nicht sehr gern gesehen. Mal ganz abgesehen davon, dass die deutschen Hippies in den Siebzigerjahren nicht viel mehr als Müll dort hinterlassen haben, sehen es auch heute noch viele deutsche Inselbewohner nicht ein, die Sprache ihrer Wahlheimat zu lernen. Die ist in diesem Fall übrigens nicht Spanisch, sondern Mallorquinisch, was kein spanischer, sondern ein katalanischer Dialekt ist. Aber ob Spanisch oder Mallorquinisch: Durch die vielen deutschen Touristen kommen deutsche Inselbewohner auch mit ihrer Muttersprache zurecht und müssen daher für ihr eigenes Überleben weder Spanisch noch Mallorquinisch lernen.
Durch kulturelle Unterschiede entstehen schnell Missverständnisse
Auch ich habe selbstverständlich neben vielen positiven Erfahrungen mit Türken und türkischstämmigen Menschen überaus mäßige Erlebnisse gehabt, die durch die teilweise großen Unterschiede in den Kulturen zustande gekommen sind. Eine solche Erfahrung war zum Beispiel das Busfahren: Ich stehe als Erste an einer Bushaltestelle und warte auf den Bus. Eine Gruppe Türkischstämmiger mit zwei erwachsenen Frauen, vier Kindern und mindestens dreimal so vielen Plastiktüten kommt hinzu. Der Bus hält an, die Familie drängt mich beim Einstieg regelrecht zur Seite, betritt vor mir den Bus und setzt sich auf die einzigen noch freien Plätze. Eine absolute Unverschämtheit! Das habe ich damals so gesehen und finde es auch heute noch unmöglich. Aber ich verstehe jetzt zumindest ein bisschen, wo das Drängeln herkommt. Als ich für ein halbes Jahr in Istanbul gelebt habe, musste ich schnell einsehen, dass man mit höflichem Anstehen nicht sehr weit kommt. Wer an einem Bus (der schon bei der Ankunft fünfmal voller ist als ein Bus, den wir in Deutschland als voll bezeichnen würden) höflich ansteht, der fährt nicht mit – so einfach ist das. Wer es schafft, sich als Erstes hineinzuquetschen, der bekommt noch einen der letzten eigentlich schon nicht mehr vorhandenen Plätze. Genauso ist es auf dem Amt: Wer sich in eine Warteschlange stellt, der wird erleben, dass sich so viele andere vordrängeln, bis einem selbst gesagt wird, dass das Amt jetzt leider schließt und man nächste Woche wiederkommen solle. Oder übernächste. Das Vordrängeln mag eine für Deutsche höchst irritierende Art und Weise sein, aber in einer übervollen Stadt wie Istanbul ist das so lange gewachsen, dass es aus den Menschen nicht mehr herauszubekommen ist – selbst, wenn sie in Deutschland leben und im Bus nicht mehr kämpfen müssen.
Unangenehm stößt mir zudem nach wie vor auf, wenn sich türkischstämmige Menschen in gewissen Situationen nicht so oft bedanken, wie ich das sonst gewohnt bin. Aber auch an dieser Stelle ist mir der Grund dafür beim offenbar höchst kulturell aufschlussreichen Busfahren in der Türkei klar geworden. Selbst in den vollgestopften Bussen herrscht eine ganz klare Hierarchie bei der Vergabe der Sitzplätze: erst alte Frauen und Schwangere, dann alte Männer und Kinder, dann die übrigen Frauen und erst dann (was vermutlich in den immer vollen Bussen niemals vorkommt) die restlichen Männer. Einer alten Frau den Sitzplatz anzubieten, hat in der Türkei nichts mit Höflichkeit zu tun, sondern ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Daher bedankt sich die alte Frau auch nicht dafür, dass man ihr Platz macht, sondern sie weiß einfach: Dieser Platz gehört mir, weil das hier so ist. Mittlerweile weiß ich also, dass es nichts mit Unhöflichkeit zu tun hat, wenn sich niemand aus diesem Kulturkreis bei mir bedankt, wenn ich nach einem harten Arbeitstag meinen Sitzplatz im Bus räume. Tatsächlich gilt es in der Türkei sogar als unhöflich, wenn man als nächster in der Sitzplatz-Reihenfolge das Angebot nicht annimmt. Das habe ich am eigenen Leib erfahren, als einmal ein Platz entgegen der Fahrtrichtung frei wurde. Ich bekomme beim Fahrstil der türkischen Busfahrer sowieso schon beinahe einen Herzinfarkt und noch dazu wird mir – auch in Deutschland – beim Fahren entgegen der Fahrtrichtung schlecht. Also habe ich den angebotenen Platz mit einem »Nein, danke« abgelehnt, weil mein Türkisch für »Vielen lieben Dank, aber mir wird beim Fahren entgegen der Fahrtrichtung übel« nicht reichte. Dafür habe ich richtig böse Blicke geerntet, und man hat vehement darauf beharrt, dass ich mich setze. Habe ich natürlich gemacht – du kannst dir vorstellen, wie das ausgegangen ist. Kulturelle Unterschiede sind manchmal schwer zu überbrücken oder erfordern, wie in meinem Fall, schon mal eine mehr oder weniger große Opferbereitschaft. Ich denke, in manchen Bereichen kann man das trotzdem von Menschen erwarten, die sich für ein Leben in einem anderen Land entschieden haben. In anderen Fällen tun beide Seiten gut daran, aufeinander zuzugehen und zu akzeptieren, dass nicht alle Unterschiede überwundern werden können und auch nicht müssen.
Man kann auch nicht behaupten, dass sich türkischstämmige Menschen gar nicht anpassen. Ich wähle mal ein ganz banales Beispiel: den Döner. So, wie wir ihn in Deutschland kennen, existiert er in der Türkei nicht. Wer in der Türkei einen Döner bestellt, bekommt nicht etwa ein gefülltes Fladenbrot, sondern ein Tellergericht serviert. Es besteht in der Regel aus dem Döner Kebab (»sich drehendes Grillfleisch«), einer Beilage wie Pommes oder Reis und Salat. In Deutschland wurde das Gericht den Geschmäckern und der Mitnehmkultur angepasst. Das Fladenbrot in seiner Ursprungsform gibt es in der Türkei nicht mal ganzjährig zu kaufen. Es ist nämlich das »Ramazan Pidesi« (Ramadan-Brot), und daher wird es in der Türkei nur in der Zeit des Fastenmonates flächendeckend in den Bäckereien angeboten. In Deutschland ist das Fladenbrot ganzjährig zu kaufen.
Wie der Glaube an Gott die Integration erschweren kann
Der dritte große und aus meiner Sicht besonders einflussreiche Grund für Differenzen zwischen Türkischstämmigen und »Deutschen« ist die Religion. Wenn man es einmal herunterbricht, ist das schon traurig: Einem Menschen, der an Gott glaubt (eine für ihn gute, friedliche, höhere Macht), wird deutlich vermittelt, dass er aufgrund seines Glaubens eine Gefahr für die deutsche Gesellschaft ist. Natürlich kommt diese Angst der »Deutschen« nicht von ungefähr. Jenseits von Rechtsradikalen haben sich die flächendeckenderen Vorbehalte gegen Muslime in Deutschland vor allem nach dem Terroranschlag am 11. September 2001 in den USA ausgebreitet. Die Attentäter von New York haben, wie sie sagten, im Auftrag von Allah tausende Menschen umgebracht. Und das mitten in einer zivilisierten, modernen Gesellschaft. Danach war klar: Das kann uns in Deutschland auch passieren. Und wenn Muslime so etwas tun, dann sind sie gefährlich.
Islamismus ist auch in Deutschland ein echtes Problem. Das lässt sich nicht kleinreden. Aber es ist wichtig, zwischen Islam und Islamismus zu unterscheiden. Im Vergleich zum islamischen Glauben ist Islamismus eine Form des politischen Extremismus. Muslime, die keine Islamisten sind – und das ist die absolut größte Mehrheit –, kritisieren diese genauso scharf wie andere Menschen auch. Und diese Muslime leiden am meisten unter den Islamisten: Sie können nicht nur genauso zu Opfern ihrer Gewalt werden, sondern es wird auch ihr Ansehen auf der ganzen Welt beschädigt. Ein Islamist ist aus der Sicht »normaler« Muslime kein Moslem, sondern jemand, der den Islam missbraucht, um seine politischen Ziele durchzusetzen. Das ist ein bisschen so wie im Fußball: Es gibt eine große Anzahl von »Ultras«, die vom Spiel selbst nichts mitbekommen, sondern die Sportveranstaltung nur dazu nutzen, Gewalt auszuleben. Aber niemand käme deswegen auf die Idee zu sagen, dass alle Fußballfans Schlägertypen sind.
Gewalttätige Menschen mit verqueren Ansichten gibt es überall. Dabei ist es egal, welche Gruppe sich radikalisiert. Denn ob es jetzt Islamisten, rechts- oder linksradikale Deutsche sind: Radikale Menschen sind gefährlich für unsere Gesellschaft, und dagegen muss etwas unternommen werden. Aber alle Menschen islamischen Glaubens über einen Kamm zu scheren und davon auszugehen, dass ihr Glaube sie grundsätzlich zu Gotteskriegern macht, ist in etwa so zutreffend, wie alle Katholiken als Kreuzritter zu bezeichnen, nur weil im 13. Jahrhundert zahlreiche Katholiken zahlreiche Araber umgebracht haben.
Sind Muslime eine Gefahr für die deutsche Kultur?
Ich glaube, die größte Angst vieler »Deutscher« ist, dass irgendwann von der eigenen Kultur (die stark durch christliche Werte geprägt ist) nichts mehr übrigbleibt und »der Islam« übernimmt. Mal ganz abgesehen davon, dass viele christliche und muslimische Werte gleich sind – zum Beispiel ein respektvoller Umgang miteinander oder Solidarität mit Ärmeren: Wie realistisch ist es, dass sich der Islam weiter in Deutschland ausbreitet? Fakt ist: Die Zahl der Muslime in Deutschland wird in den kommenden Jahren deutlich steigen. Das liegt zum einen daran, dass viele Flüchtlinge, die derzeit nach Deutschland kommen, Muslime sind. Zum anderen ist die Geburtenrate bei hier lebenden Muslimen viel höher. Das kommt wiederum auch daher, dass Familie bei den meisten praktizierenden Gläubigen (völlig egal, ob Christen oder Muslime) noch einen höheren Stellenwert einnimmt und Familien mit mehr als einem Kind eher üblich als ungewöhnlich sind. Außerdem ist das Rollenbild »Die Frau kümmert sich um die Familie, der Mann arbeitet« in vielen muslimischen Familien noch präsenter und lebendiger.
In Bezug auf die Angst, dass Deutschland fest in muslimische Hände geraten könnte, wirkt aus meiner Sicht auf viele Nicht-Muslime einschüchternd, mit welcher Selbstverständlichkeit der Islam gelebt wird. Während die christlichen Kirchen in Deutschland zunehmend um ihre Mitglieder fürchten müssen und sich gerade junge Leute immer weniger von der Kirche angesprochen fühlen, ist der Glaube für viele Muslime – ob jung oder alt – fester Bestandteil ihres Alltags.
Die Frage ist aber, wie »schlimm« das ist, dass diese Menschen nun mal einen muslimischen Glauben haben. Denn wirklich gefährlich wird ja nur, wer sich radikalisiert oder versucht, einen andersgläubigen Menschen mit Nachdruck zu bekehren. Natürlich gibt es diese Gläubigen auch, aber nicht jeder will uns dazu zwingen, Moslem zu werden oder eine Moschee mit zehn Minaretten vor die Tür setzen (zwei bis vier reichen sicher auch). Genauso wenig, wie alle Christen in Deutschland Missionare sind (auch nicht die streng katholischen), sind alle Moslems davon besessen, Andersgläubigen den Islam überzustülpen.
Ich habe einmal mit einer Freundin die türkische Stadt Bursa besucht. Wir blieben beim Ruf des Muezzins zum Gebet vor einer großen Moschee stehen und wurden von einer Frau mittleren Alters angesprochen. Sie fragte uns, ob wir mit in die Moschee kommen wollten, um uns das einmal anzusehen. Wir hatten angenommen (warum auch immer), dass Muslime beim Gebet unter sich sein wollen. Da wir noch nie bei einem Gebet dabei waren, freuten wir uns über das Angebot. Die Frau nahm uns mit in die Waschräume, zeigte uns genau, wie man sich vor dem Gebet zu waschen hatte. Als wir in die Moschee kamen, waren wir erst einmal sehr überrascht, dass Männer und Frauen zusammen in dem großen Raum beteten. Wir kannten bisher nur das Klischee, dass Frauen in einen gesonderten Bereich »abgeschoben« werden würden. Doch hier standen alle zusammen. Danach unterhielten wir uns noch kurz mit der Frau, aber sie hat nicht mit einem Satz versucht, uns irgendwie zu bekehren. Sie war einfach stolz, uns zeigen zu können, woran sie glaubt.
Was das Getrenntbeten angeht, ist es natürlich trotzdem in vielen Moscheen so, dass Männer im Hauptraum beten und Frauen entweder auf einer höheren Etage oder hinter einer Abtrennung. Dass aber auch das nicht alle muslimischen Frauen als Unterdrückung empfinden, hat mir eine Muslima in der Kölner Zentralmoschee erzählt. Im Islam wird sehr körperbetont gebetet – wie ich beim Gebet in der Moschee in Bursa selbst erfahren habe. Da macht man mehr Sport als in manchem YouTube-Yoga-Tutorial. Das heißt, die Gläubigen gehen dabei zum Beispiel auf die Knie und legen den Oberkörper ab, bis der Kopf die Knie berührt. Dabei strecken sie, so gesehen, manchmal ihrem Hintermann den Allerwertesten ins Gesicht. Die Muslima in Köln sagte mir, dass viele Frauen es deswegen angenehmer fänden, an einem getrennten Ort zu beten.
Frauen mit Kopftuch sind nicht gleich unterdrückt
Noch ein anderes großes Thema beschäftigt »die Deutschen« sehr: das Kopftuch. Es gilt für viele als Symbol der Unterdrückung muslimischer Frauen, denn sie können sich nicht vorstellen, warum sich jemand freiwillig zu einer so starken optischen Veränderung entscheidet. Dabei habe ich drei Frauen kennengelernt, die sich ganz bewusst und ohne, dass jemand es ihnen vorgeschrieben hätte, dafür entschieden haben.
Eine von ihnen ist Betül. Ich habe sie im Türkischsprachkurs kennengelernt. Ihre Eltern sind Kurden, und die Familie ist aus der Türkei nach Deutschland geflohen, als Betül noch ein kleines Kind war. Zu Beginn des Sprachkurses konnte Betül bereits fließend Türkisch, wollte aber ihre schriftlichen Sprachkenntnisse auffrischen und vermutlich auch auf einfachem Weg an einen Leistungsnachweis kommen. Die junge Frau hat mir erzählt, dass ihre Mutter zwar ein Kopftuch trägt, aber immer sehr dagegen war, dass Betül ebenfalls ihren Kopf bedeckt, denn sie wusste um die schlechteren Aufstiegschancen ihrer Tochter mit Kopftuch. Bis zum Beginn ihres Studiums trug Betül tatsächlich auch keines. Aber dann lernte sie ihren Freund und später Verlobten kennen. Auch er hat Betül nie darum gebeten, ein Kopftuch zu tragen. Sie selbst hat sich aber dafür entschieden, »ihre ganze Schönheit« nur ihrem Mann zu zeigen. Ich stelle mir das so vor wie bei Frauen, die keinen Sex vor der Ehe haben wollen. Das ist zwar in beiden Fällen eine sehr besondere Entscheidung, aber zumindest im Fall von Betül eine, die ihr nicht von außen aufgedrängt wurde, sondern zu der sie sich selbst bewusst entschieden hat. Und sie hatte den Vergleich, da sie schließlich ihre ganze Jugend ohne Kopftuch gelebt hat.
Die zweite Frau ist Ayşe. Sie hat mich besonders beeindruckt, weil ich im Gespräch mit ihr innerhalb von wenigen Minuten viele meiner eigenen Vorurteile über Bord werfen konnte. Ich habe Ayşe im Transferbus vom Istanbuler Flughafen in die Stadt kennengelernt, als ich gerade mein Auslandssemester begonnen hatte. Sie setzte sich neben mich und lächelte mir freundlich zu – das haben zumindest ihre Augen verraten, denn mehr konnte ich von ihrem Gesicht nicht sehen. Sie trug einen Niqab, war also komplett bis auf die Augen in schwarz verschleiert. Als ich sie in meinem bröckeligen Türkisch fragte, wie viel die Busfahrt kosten würde, antwortete sie mir in perfektem Deutsch mit einem stark österreichischen Akzent. Ich will gar nicht wissen, wie entgeistert ich sie in dem Moment angesehen habe. Entgegen meiner eigenen Vorurteile war diese junge Frau aus Österreich sehr aufgeschlossen. Sie war erst achtzehn Jahre alt und vor drei Jahre aus Österreich weggegangen, um in Istanbul eine Ausbildung zur Arabischlehrerin zu machen. Sie sagte, sie sei mit Minirock und Piercing gekommen und habe sich dann aber in der Schule irgendwann komplett verschleiert – freiwillig. Sie meinte, sie hätte sich damit einfach wohler gefühlt. Im Minirock sei es immer so viel um Optisches gegangen und darum, auf sich aufmerksam zu machen. Wenn sie jetzt Männer wie Frauen kennenlernt, würden sich Gespräche auf einer anderen Ebene abspielen und es ginge mehr um die inneren Werte.
Die dritte Frau ist Nadja. Ich habe sie während eines Drehs für ein Filmprojekt kennengelernt. Sie hat mir erzählt, dass sie das Kopftuch trägt, um ihren Glauben nach außen zu zeigen – so wie viele Christen eine Kette mit einem Kreuz um den Hals tragen. Neben Frauen wie Nadja, die das Kopftuch ganz bewusst als Zeichen ihrer Religion tragen, gibt es auch viele, die diesen Brauch erstmal gar nicht hinterfragen. Sie machen es, weil man das als Muslima halt so macht, das gehört einfach dazu. Das ist vergleichbar damit, dass viele Christen gar nicht mehr wissen, weshalb Weihnachten gefeiert wird. Sie gehen dann trotzdem in die Kirche, weil man das eben so macht. Ähnliches gilt für die Hochzeit in Weiß oder andere Feiertage: Obwohl vermutlich ein Großteil der Deutschen nicht weiß, was der Hintergrund von Pfingsten oder Fronleichnam ist, schaffen wir diese Feiertage nicht ab. Klar, ein Kopftuch zu tragen, ist eine Entscheidung, die den Alltag und auch das eigene Aussehen verändert. Aber ich finde es erstaunlich, dass sich die Deutschen so sehr über das Tragen von Kopftüchern bei Musliminnen aufregen, aber es niemanden zu stören scheint, dass auch Nonnen Kopfbedeckungen tragen. Bei Letzteren ist das ein Zeichen, um ihre Zugehörigkeit zu einer Ordensgemeinschaft zu signalisieren und deutlich zu machen, dass ihre Individualität nicht so bedeutend ist wie die Gemeinschaft. Eine Nonne würde jeder Deutsche als harmlosen, ja sogar besonders friedlichen Menschen bezeichnen. Eine muslimische Frau mit Kopftuch ist hingegen bedrohlich oder mindestens unterdrückt.
Es gibt mit Sicherheit zahlreiche unterdrückte Musliminnen, bestimmt auch in Deutschland. Aber sich anzumaßen, aufgrund von Kopftüchern oder getrennt sitzenden Gläubigen in der Moschee ein Urteil darüber fällen zu können, ob türkische Frauen und Männer eine gleichberechtigte Beziehung führen, ist absolut unangemessen. Die meisten türkischstämmigen Frauen in Deutschland sind keine unmündigen Wesen, die sich von ihren Männern unterdrücken lassen. Im Gegenteil: Ich habe schon oft mitbekommen, dass sie es sind, die zu Hause »die Hosen« anhaben. Besonders die hier geborenen Frauen wissen, dass sie in Deutschland auch eine andere Wahl hätten, selbst wenn sie sich manchmal durch familiäre Strukturen unter Druck gesetzt fühlen. Und ganz ehrlich: Wie viel Gleichberechtigung gibt es denn in den christlichen Kirchen? Besonders die katholische ist davon meilenweit entfernt. Tatsächlich saßen vor gar nicht allzu langer Zeit auch hier noch Männer und Frauen getrennt voneinander in der Kirche. Mein Vater hat das noch erlebt.
Gleichberechtigung ist nicht nur in der deutschen Gesellschaft ein wichtiger und erstrebenswerter Zustand. Und die religiösen Gemeinschaften, egal welcher Ausprägung, müssen sich zwangsläufig damit auseinandersetzen. Das machen sie auch. Aber so wie Rom nicht an einem Tag erbaut wurde, lassen sich diese über Jahrhunderte gewachsenen Strukturen nicht einfach umwerfen. Die Mühlen mahlen langsam, sicher auch zu langsam, aber das hat mehr mit den Strukturen innerhalb der Religionen zu tun als mit dem Glauben an sich.
Es ist so viel zielführender, sich neben den vorhandenen Unterschieden vor Augen zu führen, wie viele Gemeinsamkeiten es in den Religionen gibt. Denn auch die sind definitiv vorhanden. So wissen viele Christen zum Beispiel nicht, dass Jesus auch im Islam eine wichtige Rolle spielt. Jesus von Nazaret wird im Koran »Isa ibn Maryam«, also der »Sohn der Maria« genannt. Hier wird er als einer der fünf Gesandten Allahs verstanden und ihm werden genau wie in der Bibel besondere Fähigkeiten wie das Heilen von Menschen zugesprochen. Allerdings halten Muslime Jesus nicht für den Sohn Gottes und sie glauben auch nicht daran, dass er gekreuzigt wurde. Für sie ist es ebenso befremdlich, dass »ihr« Prophet im Christentum am Kreuz endet oder dass Christen »seinen Leib essen« wie für Christen, dass Muslime auf Schweinefleisch verzichten und Frauen ein Kopftuch tragen.
Auch türkischstämmige Menschen schätzen Deutschland
Türkischstämmige Menschen werden sehr schnell mit dem Islam in Verbindung gebracht, dabei ist längst nicht jeder türkischstämmige in Deutschland gläubig. Eine groß angelegte Studie der Uni Münster hat ergeben, dass nur 28 Prozent der Türkischstämmigen regelmäßig eine Moschee besuchen und nur 45 Prozent regelmäßig beten.
Und selbst unter den Gläubigen ist der Glaube ja bei Weitem nicht alles, was einen türkischstämmigen Menschen ausmacht. Viele von ihnen fühlen sich zwar zwischen der türkischen und deutschen Kultur zerrissen, aber sie wollen auch nicht (zurück) in die Türkei gehen. Und das hat nicht nur etwas damit zu tun, dass wir hier so einen tollen Sozialstaat haben und angeblich jeder die Hand aufhalten darf, sondern auch damit, dass viele Türkischstämmige Deutschland wegen seiner Kultur und Struktur schätzen. Ob es das Schulsystem und die Bildungschancen sind, die Meinungsfreiheit, die Zuverlässigkeit oder Ordnung. Im Kleingartenverein bei uns um die Ecke hat eine türkische Pächterfamilie einen »englischeren« Rasen als jeder Deutsche. Für das, was ihnen an der deutschen Kultur gefällt, kämpfen Türkischstämmige genauso wie Menschen ohne Migrationshintergrund. Kulturen wachsen doch zusammen, und nur weil die türkische Kultur in Deutschland mit einfließt, ist die deutsche, die über Generationen auch an Menschen mit ursprünglich anderer Herkunft weitergegeben wurde, nicht einfach verschwunden. Wem Deutschland nicht Türkisch genug ist, der geht in der Regel in die Türkei zurück: Im Jahr 2006 wanderten erstmals nach dem Anwerbeabkommen mehr Menschen von Deutschland in die Türkei aus als umgekehrt.
Wir sollten uns auch gar nicht wünschen, dass keine Muslime mehr zuwandern. Die »Deutschen« bekommen zu wenige Kinder, und dadurch wird die Gesellschaft immer älter. Nach einer Studie des Institutes Pew Research Center in Washington wird die europäische Population ohne muslimischen Hintergrund im Jahr 2050 von 521 auf 482 Millionen sinken. Das bedeutet: Wenn nicht entweder mehr Menschen zuwandern oder die Deutschen in Zukunft deutlich mehr Kinder bekommen, können wir unser Sozial- und Rentensystem nicht aufrechterhalten. Die Rentenzahlungen sind Gelder, die von allen arbeitenden Steuerpflichtigen eingezahlt werden – also in Deutschland auch von den zahlreichen steuerpflichtigen Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn das Verhältnis von Rentnern zur arbeitenden Bevölkerung nicht stimmt, kann auch niemand die Rente bezahlen. Also sind wir darauf angewiesen, dass die deutsche Bevölkerungsentwicklung mindestens stagniert, sonst wird es im Alter eng. Da es unwahrscheinlich ist, dass »deutsche« Frauen auf einmal deutlich mehr als ihre durchschnittlichen anderthalb Kinder bekommen, sollten wir einen Weg finden, alle in Deutschland Lebenden als wichtigen Teil des Systems zu sehen. Es gibt Türkischstämmige, die sich (zu) wenig Mühe geben, sich in bestimmten Punkten an das Land, in dem sie leben, anzupassen. Genauso gibt es Deutsche, die türkischstämmigen Menschen keine Chance geben, sich als gleichwertiger Teil der Gesellschaft zu empfinden. Ohne Dialog geht das nicht. Denn wenn ich das mal überspitze: Ist es so viel besser, wenn eine rechtsradikale Partei die Regierung übernimmt, als wenn Deutschland islamisiert wird? Ich für meinen Teil möchte beides nicht und hoffe darauf, dass mehr für das gegenseitige Verständnis getan wird. Reden hilft – ist so!