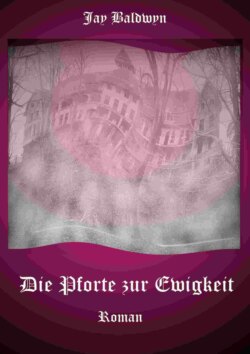Читать книгу Die Pforte zur Ewigkeit - Jay Baldwyn - Страница 5
3.
ОглавлениеSally betrat das Zimmer einer Patientin, die starken Stimmungsschwankungen unterlag. Von hysterischem Dauerlachen, bis zu tiefster, teilnahmsloser Verzweiflung, war bei ihr alles drin. Man wusste nie, in welcher Verfassung man sie antreffen würde. Josephin Arthur war Tochter aus reichem Hause. Böse Zungen behaupteten sie sei das typische Beispiel für Kinder, die mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden. Kapriziös, aufsässig, verwöhnt und hochnäsig. Das mochte in Ansätzen alles für sie gegolten haben, aber ihre Krankheit hatte eine starke Wesensveränderung bei ihr bewirkt. Jetzt entsprach sie ganz und gar dem Krankheitsbild der manischen Depression – himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. An ihren hellen Tagen kleidete sie sich verführerisch und huldigte den Avancen der männlichen Patienten, an den dunklen verließ sie selten das Zimmer, und wenn doch, nahm sie niemanden wahr.
An diesem Tag fand Sally Josephin im Bett liegend vor, blass und kraftlos mit geschlossenen Augen. Das Zimmer war weitgehend durch die schweren Vorhänge verdunkelt und die Tür zur Sonnenterrasse nur einen Spalt geöffnet.
»Sie haben doch nicht etwa wieder geraucht, Ms. Arthur?«, fragte Sally streng. Eine überflüssige Frage, denn die bläulichen Fäden und der Geruch im Zimmer waren eindeutig.
»Wen interessiert das? Wenn das Rauchen meinen Tod beschleunigt, soll es mir nur recht sein.«
»Sie wissen, dass man Sie dafür vorzeitig entlassen kann«, sagte Sally etwas milder und nicht auf die depressive Bemerkung eingehend, »öffnen Sie doch wenigstens weit die Fenster, damit man Ihnen nicht so schnell draufkommt.«
Josephin antwortete nicht.
»Wollen Sie nicht mit herunter kommen? Es gibt einen wunderbaren Lunch, der keine Wünsche offen lässt.«
»Pah, den Wunsch, endlich sterben zu können, schon. Indem man uns fünfmal am Tag mit Essen voll stopft wird die Sache doch nur verzögert.«
»Mr. Lonsdale wäre bestimmt sehr traurig, wenn er Sie so reden hörte. Ich glaube, er war gerade auf dem Weg zu Ihnen. Er wird abwarten, bis ich wieder aus dem Zimmer bin.«
»Was? Robert ist auf dem Flur?« Josephins Augen bekamen einen fiebrigen Glanz, und von einer Minute zur anderen war sie wie ausgewechselt. »Schnell, helfen Sie mir hoch. Und ziehen Sie diese Vorhänge auf, die mich mehr und mehr an Leichentücher erinnern. Ich will auf den Balkon. Aber vorher muss ich noch meine Haare bürsten. Robert soll mich nicht so sehen.«
Sallys Gesicht bekam einen zufriedenen Ausdruck. Der alte Trick hatte wieder einmal geklappt. Schwindsüchtigen wurde mitunter ein gesteigertes erotisches Interesse nachgesagt, und Josephin war das beste Beispiel dafür. Es wurde nicht so gerne gesehen, wenn die Patienten sich untereinander in den Zimmern besuchten, besonders, wenn sie unterschiedlichen Geschlechts waren, aber man schaute schon mal weg, wenn es dem Heilungsprozess dienlich war. Und selbst, wenn es keine Hoffnung gab, wer wollte den Kranken die schönste Sache der Welt verwehren, wenn sie an der Schwelle des Todes standen?
Josephin ließ sich von Sally in den seidenen Morgenmantel helfen und zum Frisiertisch bringen. Dort bürstete sie ihr langes, welliges Haar und legte etwas Lippenrot und Rouge auf. Beides erzielte in dem fast durchscheinenden Gesicht eine beinahe groteske Wirkung, aber Männer ließen sich gerne über den Zustand der Geliebten täuschen, das wusste Josephin allzu gut. Und wenn sie an Roberts eingefallene Wangen und seine dunklen Augenringe dachte, kamen ihr fast die Tränen vor Rührung und Mitleid, denn er konnte nicht auf kosmetische Hilfsmittel zurückgreifen.
»Ich werde Ihnen etwas Leckeres nach oben bringen«, sagte Sally, nachdem sie Josephin in einen bequemen Korbsessel auf die Terrasse gesetzt und sie mit einer weichen Wolldecke zugedeckt hatte, »Sie werden sehen, der Appetit kommt beim Essen.«
»Ja, danke, aber danach ziehen Sie sich bitte diskret zurück, ja?«
Sally nickte wissend. Und als sie das Zimmer verließ und in einiger Entfernung Robert Lonsdales dunklen Haarschopf um die Ecke lugen sah, erkannte sie, dass ihre Vermutung richtig gewesen war. Da konnte ein Kavalier es kaum abwarten, seiner Liebsten seine Aufwartung zu machen.
Mit gemischten Gefühlen machte Sally anschließend in der Küche ein Tablett mit Köstlichkeiten für die zwei fertig. Sie wusste, dass bei Robert Lonsdale für die nächsten Tage eine Behandlung bevorstand, die nicht unumstritten war.
Es handelte sich um die sogenannte Pneumothorax-Therapie bzw. -Technik, bei der mittels eines Ballons ein betroffener Lungenflügel künstlich zum Kollabieren gebracht wurde. Damit brachte man die Lunge zum Stillstand, um die Ausheilung der Veränderungen zu veranlassen. Diese Technik war aber von geringem Nutzen, wie sich im Laufe der Jahre zeigte, und wegen ihrer Gefährlichkeit umstritten.
Pneumothorax - „Luft im Brustraum“ bezeichnet genaugenommen ein eigenes Krankheitsbild. Lungenfell und Brustfell, beide aufeinander liegend, trennt ein gleitender Flüssigkeitsfilm - der Pleura-Spalt, und ist normalerweise luftleer. Eindringende Luft kann die Lungenflügel vollständig zusammenfallen lassen. Bei einem Spannungspneumothorax, bei dem beide Lungen und die Herz-Kreislauf-Funktion drastisch eingeschränkt sein können, kann durch ein geplatztes Lungenbläschen Luft in den Pleuraspalt eindringen, die durch den Verschluss der Öffnung nicht mehr entweichen kann. Der stetig ansteigende Druck im Pleura-Spalt lässt den betroffenen Lungenflügel zusammenfallen und für die Atmung unbrauchbar werden, und drängt das Mittelfell und das Herz zur anderen Seite, wodurch auch der gegenüberliegende Lungenflügel zusammengedrängt wird. Somit kann ein akut lebensbedrohlicher Zustand entstehen.
Diese medizinischen Details standen Sally freilich nicht zur Verfügung, da sie nicht im OP-Bereich arbeitete, aber sie bekam hin und wieder die Folgen mit, wenn sich das Befinden der Patienten drastisch verschlechterte oder sie gar plötzlich verschwanden. Sally fragte sich, ob die bevorstehende Behandlung ein Thema zwischen Josephin und Robert sein würde, oder ob sie ihre Ängste und Befürchtungen mit romantischen Schwüren und Liebesbeteuerungen überdecken würden. Als Sally ihnen das Essen auf der Terrasse servierte, sah es nach der zweiten Version aus, denn Josephin lächelte selig, und Roberts Augen glühten vor Verlangen.
Auch Minnie hatte Besuch von ihrem kleinen Freund Leander. Anders als Erwachsene, die sich manchmal gerne selbst betrügen, sahen die beiden Kinder der Realität ins Auge. Minnie wusste, dass sie bald sterben musste, denn ihr Zustand hatte sich in der letzten Zeit drastisch verschlechtert. Sie hatte oft hohes Fieber und wurde von Hustenanfällen gequält, die sie Blut spucken ließen. Leander hatte keine Hemmungen, über seine Ängste mit Minnie zu sprechen.
»Wie wird das sein, wenn du tot bist? Wirst du dann alles vergessen haben und nicht mehr an mich denken?«
Minnie schüttelte den Kopf.
»Wirst du da drüben auf mich warten, bis ich nachkomme?«
Minnie nickte heftig und griff nach ihrem weichen Plüschhasen. »Der ist für dich.«
»Danke, aber noch lieber hätte ich den Teddybär.«
»Den möchte ich noch eine Weile behalten, aber später bekommst du ihn.«
»Willst du ihn nicht mitnehmen?«
»Nein, ich nehme Lucy mit. Das ist meine Lieblingspuppe. Aber Jungen spielen ja nicht mit Puppen.«
»Du bist lieb. Danke, dass ich den Teddy haben darf.«
Leander kletterte zu Minnie ins Bett und legte sich neben sie. Dabei lag der Teddy zwischen ihnen, und seine spiegelnden Glasaugen leuchteten noch etwas mehr als gewöhnlich.
Mildred war in der Kantine ein Pfleger aufgefallen, von dem sie meinte, er arbeite auf der Kinderstation, denn sie hatte ihn in diese Richtung gehen sehen. Den jungen Mann umgab eine Aura, die man beinahe als engelhaft bezeichnen konnte, und Mildred konnte sich gut vorstellen, dass die Kinder ihn auf Anhieb in ihr Herz geschlossen hatten wie Mildred auch. Sein Name sei Anthony Tubman, hatte er sich ihr vorgestellt, als er unerwartet mit der Frage an ihren Tisch getreten war, ob er sich zu ihr setzen dürfe. Seine blauen Augen strahlten, wenn er sie ansah, und Mildred hatte sich schon mehrmals dabei erwischt, wie sie vor dem Einschlafen an ihn dachte. Sein schönes, ebenmäßiges Gesicht spiegelte sein gütiges und liebevolles Wesen wider. Mildred hatte noch nie so schöne, feingliedrige Hände bei einem Mann gesehen und fragte sich insgeheim, was er wohl an ihr finden konnte, denn sie selbst empfand sich nicht als besonders hübsch. Eine Betrachtungsweise, die bei Anthony schärfsten Protest hervorgerufen hätte, wenn ihm ihre Gedanken bekannt gewesen wären.
Als Mildred Minnie mehrere Tage hintereinander nicht gesehen hatte, machte sie sich große Sorgen und wollte das Mädchen in seinem Zimmer aufsuchen, aber Minnies Bett war leer, und auf dem Balkon saß ein anderes kleines Mädchen, das Mildred mit großen, glanzlosen Augen ansah.
Die Kinderkrankenschwester antwortete ausweichend auf Mildreds Frage. »Minnie ist verlegt worden«, hieß es einsilbig.
»Ja, wohin denn? Und warum hat man ihr Zimmer bereits anderweitig vergeben?«
»Da müssen Sie in der Verwaltung nachfragen.«
Mildred stürmte aus der Schwesternstation und wäre fast mit Anthony zusammengestoßen.
»Niemand anderen hätte ich in diesem Moment lieber getroffen als dich«, sagte sie erleichtert.
»Danke, das hört man gerne, noch dazu von so einer reizenden jungen Dame.«
»Ach, hör auf, ich weiß, dass ich nichts Besonderes bin.«
»Das liegt ganz im Auge des Betrachters, aber ich kann dir versichern, dass ich mich selten irre.«
Mildred errötete und senkte schamhaft den Blick. »Man sagt mir, die kleine Minnie sei verlegt worden. Weißt du wohin?«
»Es heißt, ihr Zustand habe sich derart verschlimmert, dass man sie in die Intensivstation bringen musste.«
»Danke, dann werde ich dort einmal nachsehen«, sagte Mildred und lief zum Fahrstuhl.
»Wenn du mit dem Nachsehen fertig bist, könntest du darüber nachdenken, ob wir heute Abend einen Spaziergang auf dem Gelände machen wollen«, rief ihr Anthony hinterher.
»Versprochen«, antwortete Mildred, bevor sich die Fahrstuhltür hinter ihr schloss.
Frauen, dachte Anthony. Heißt das nun, sie denkt darüber nach, oder sind wir jetzt fest verabredet? Auf jeden Fall würde er am Abend vor dem Schwesternwohnheim warten, nahm er sich vor.
Mildred klingelte an der Tür zur Intensivstation, und wenig später wurde ihr geöffnet.
»Hallo, ich bin Mildred Taft, arbeite unten auf der Etage und wollte mich nach der kleinen Minnie erkundigen. Hat sich ihr Zustand etwas gebessert?«
»Eine Minnie Wie-auch-immer haben wir hier nicht«, sagte die Schwester wenig freundlich.
»Ja, so etwas habe ich mir schon gedacht«, antwortete Mildred und drehte sich auf dem Absatz um. Lieber Himmel, lass sie nicht schon unten in der Leichenhalle sein, betete Mildred. Dorthin brachten sie nämlich keine zehn Pferde. Aber es gab noch eine andere Möglichkeit, keine viel bessere, nur dort würde sich Mildred wenigstens von dem kleinen Mädchen verabschieden können.
Unten in der ersten Etage lief Mildred beherzt auf die bewusste Tür zu. Das Schild: „Eintritt verboten“ hielt sie nicht ab, sondern bestärkte sie in ihrem Verdacht. Und tatsächlich gab die Klinke nach, und als Mildred hineingeschlüpft war, sah sie Minnie mehr tot als lebendig in dem schrecklichen Raum, der nur notdürftig beleuchtet war und nicht einmal ein Fenster besaß, in einem einfachen Bett liegen. Mildred kamen augenblicklich die Tränen, als sie begriff, dass man das Mädchen wie ein Bündel gebrauchter Wäsche in das Sterbezimmer abgeschoben hatte.
Minnie schlug die Augen auf, als sie die Anwesenheit von Mildred spürte. »Du brauchst nicht zu weinen«, sagte das Kind mit rasselndem Atem. »Die schöne Dame, die mich besucht hat, meinte, dass sie mich bald mitnehmen würde. An einen wunderschönen Ort, wo ich keine Schmerzen mehr haben werde.«
Mildred setzte sich vorsichtig auf Minnies Bett und ergriff das kleine, eiskalte Händchen. »Ist es eine Schwester? Kenne ich sie?«
»Ja, sie trägt eine ähnliche Tracht wie du, aber ich habe sie vorher noch nie gesehen. Sie kommt auch nicht durch die Tür, weißt du? Dort vorne in der Ecke, fast unter der Decke, wird es zuerst ganz hell, bevor sie kommt. Sie hat wunderschöne rote Haare, die in dem hellen Schein leuchten. Ich kann es gar nicht erwarten, dass sie mich in das herrliche Licht mitnimmt. Es strömt so viel Liebe und Geborgenheit aus.«
Mildred wusste nicht, was sie sagen sollte. Meinte Millie in ihrem Fieberwahn die Mutter Gottes zu sehen? Aber nie zuvor hatte sie gehört, dass sich die heilige Jungfrau Maria in einer Schwesterntracht gezeigt hatte. Womöglich geschah das nur, um dem Kind keine Angst zu machen.
Minnie bewegte ihr kleines Händchen in Mildreds Hand.
»Versprich mir, dass Leander meinen Teddy bekommt. Der ist das Einzige, was man mir gelassen hat, aber ich muss ihn nicht mitnehmen, wenn er Leander noch Freude bereiten kann.«
»Ist das der kleine, hübsche Junge mit den schwarzen Locken, mit dem ich dich öfter gesehen habe?«
»Ja, am besten du nimmst den Teddy gleich mit. Ich glaube, man holt mich jetzt.«
Minnies Augen bekamen einen seligen Ausdruck, und sie stieß einen letzten tiefen Seufzer aus.
Mildred schloss dem Mädchen die Augen und nahm den Teddy an sich. Sie wagte nicht, in die bewusste Ecke zu sehen, kam es ihr doch ohnehin plötzlich viel heller und wärmer in dem kargen Raum vor. Mit Gänsehaut am ganzen Körper lief sie schaudernd mit letzter Kraft nach draußen. In Tränen aufgelöst, erreichte sie kurz darauf ihre Station, den Teddy fest an ihre Brust gepresst. Die Oberschwester gab ihr eine Beruhigungstablette und wollte wissen, was Mildred so aus der Fassung gebracht hatte, aber Mildred schwieg beharrlich. Sicher, sie hätte melden müssen, dass soeben ein Kind gestorben war, aber früher oder später würde man es gewiss finden. Und was sie in dem schaurigen Raum erlebt hatte, würde ihr ohnehin niemand glauben, dachte Mildred.
Am Abend schaute Sally Mildred verwundert an. »Du gehst noch mal weg? Hat dir der anstrengende Tag nicht gereicht? Also, ich bin froh, wenn ich mich ausstrecken kann.«
»Ich mache nur noch einen kleinen Spaziergang über das Gelände. Ein wenig frische Luft wird mir gut tun, um den Kopf frei zu bekommen.«
„Du hast aber nicht zufällig ein Rendezvous mit unser aller Personalchef? Sei vorsichtig, hinter den Bäumen könnte seine eifersüchtige Gattin mit einer Flinte warten.«
»Wie damals bei Ellen?«
Der Schuss vor den Bug saß bei Sally tief.
»Wie kommst du da drauf?«, fragte sie verdattert, »Ellen ist nicht erschossen worden.«
»Ich weiß. Sag mal, habt ihr eigentlich die gleiche Haarfarbe gehabt, Ellen und du?«
»Nein, Ellen war nicht brünett. Sie hatte leuchtend rote Haare.«
»Ah ja, so etwas Ähnliches habe ich mir gedacht.«
»Was soll das nun wieder heißen?«
»Nichts, vergiss es. Und was Mr. Wright angeht, kann ich dich beruhigen. Ich treffe mich nicht mit ihm. Ich will Hetty nicht ins Gehege kommen, der falschen Schlange.«
»Ich weiß zwar nicht, was du meinst, aber scheinbar hast du schnell herausgefunden, dass man der nicht trauen kann.«
»Nein, nicht schnell, es hat eine Weile gedauert. Zuerst hat sie mich mit allerlei Klatsch versorgt und einen auf Freundschaft gemacht, indem sie mich ebenso eindringlich vor Jasper Wright gewarnt hat wie du, aber dann habe ich sie in einer ziemlich eindeutigen Situation mit ihm gesehen. Da wurde mir klar, dass sie nur keine Nebenbuhlerin haben wollte.«
»Scharf erkannt. Wenn die ihren Mund aufmacht, kommen meistens Lügen heraus.«
»Dann stimmt es also nicht, dass Ellen sich damals mit Jasper Wright eingelassen hat?«
»Das habe ich nicht gesagt. Nur aus Hettys Mund klingt das so dreckig. In Wahrheit hat Ellen diesen Kerl wirklich geliebt, und er hat ihr vorgemacht, dass er sich früher oder später von seiner Frau trennen wird, weil ihre Ehe am Ende war. Wie du siehst, sind sie immer noch zusammen.«
»Ja, und Ellen ist tot, auch wenn du das nicht zugeben willst.«
»Es gibt keinen Beweis dafür. Ich habe dir doch gesagt, dass du nicht alles glauben sollst, was hier erzählt wird.«
Mildred war nahe dran, Sally von ihrem Erlebnis in dem Sterbezimmer zu erzählen, denn es lag nahe, dass die geheimnisvolle Frau, die Minnie ins Licht führen wollte, Ellen war, zumal sie sich in diesem Raum das Leben genommen haben sollte, aber Mildred wurde langsam vorsichtig. Der Umstand, dass Sally sich mit ihr das Zimmer teilte, genügte Mildred nicht, ihr auch zu vertrauen. Überhaupt wusste sie bald nicht mehr, wem sie in diesem seltsamen Haus trauen konnte. Jeder schien hier etwas verbergen zu wollen und es mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen. Nur Anthony schien die rühmliche Ausnahme zu sein, mit Einschränkungen, denn er hatte nichts von dem Sterbezimmer verlauten lassen. Sollte er wirklich nichts davon wissen? Genau das wollte Mildred ihn fragen, und zwar gleich.
»Also, bis später. Ich werde mich bemühen, leise zu sein, falls du schon schlafen solltest.«
»Nicht nötig, meinen Schlaf stört so schnell nichts. Da kann man neben meinem Bett einen Schuss abfeuern.«
»Aus der Flinte von Fidelia Wright?«
»Ich glaube, vor dir muss man sich in Acht nehmen. Die Madonnengestalt trügt.«
»Wenn du meinst ...«
Vor dem Schwesternwohnheim wartete Anthony Tubman schon ungeduldig. Als er Mildred herauskommen sah, atmete er erleichtert auf.
»Was ist dir denn über die Leber gelaufen?«, fragte er sofort, »hat es Ärger gegeben?«
Mildred winkte ab. »Ich hatte keinen sehr erfreulichen Tag, und das Gespräch mit meiner Mitbewohnerin hat meine Stimmung auch nicht gerade aufgehellt.«
»Das tut mir leid. Ich dachte schon, es hängt mit deinem Besuch in der Intensivstation zusammen.«
»Ja, das tut es. Nur hat man Minnie nicht dahin verlegt, sondern in dieses schreckliche Sterbezimmer, in dem es offensichtlich nicht geheuer ist. Willst du mir wirklich weismachen, nichts davon gewusst zu haben?“
Anthony war ehrlich betroffen. »Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wo soll dieser Raum sein?«
»Auf unserer Etage. Offiziell heißt es, dass man darin Putzutensilien lagert. Nur ist nicht einzusehen, warum dann ein Schild den Eintritt verbietet.«
»Ach, den Raum meinst du. Dafür hat nur die Oberschwester einen Schlüssel. Wie kommst du darauf, dass es eine Art Sterbezimmer ist?«
»Ich war selbst drin. Und dort ist die kleine Minnie quasi in meinen Armen gestorben.«
»Was denn, Minnie ist tot? Davon weiß ich ja gar nichts.«
Mildred konnte ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Noch einmal sah sie das Erlebte innerlich vor sich. Anthony nahm sie tröstend in die Arme.
»Komm mal her. Es war doch bestimmt nicht der erste Mensch, dessen Tod du beigewohnt hast?«
»Nein, aber das erste Kind. Und in solch erbarmungswürdiger Umgebung. Man sollte es herausschreien, damit alle Welt davon erfährt. Sie konnten nicht einmal abwarten, bis Minnie tot war, um ihr Zimmer neu zu belegen.«
»Sieh mal Schatz, letztendlich macht es keinen Unterschied, ob das Mädchen in ihrem Zimmer oder woanders gestorben ist. Das hohe Fieber wird es seine Umgebung nicht haben wahrnehmen lassen. Und du warst bei ihm, besser hätte es doch nicht kommen können.«
Mildred lächelte schwach, aber dann kam wieder der Zorn in ihr hoch. »Und wenn ich sie nicht gefunden hätte? Dann wäre sie einsam und verlassen in diesem Loch gestorben.«
»Du warst aber da. Gott hat deine Schritte gelenkt, oder eine glückliche Fügung, wenn du so willst.«
»Was soll das für ein Gott sein, der einem jungen Menschen, der noch gar nicht richtig gelebt hat, so viel Leid und ein so schreckliches Ende zumutet?«
»Wir können uns noch so sehr bemühen und werden doch nie alles verstehen. Für den Sinn dahinter reicht unser Verstand nicht aus. Bestimmt ist das Mädchen sanft hinübergeleitet worden und jetzt sehr glücklich, wo auch immer es hingeführt wurde.«
»Seltsam, dass du das sagst. Minnies letzte Worte waren ganz ähnlich.«
»Es ist eine altbekannte Tatsache, dass Menschen bei ihrem Tod von lieben Angehörigen oder einem liebevollen Wesen abgeholt werden.«
»Ja, ich weiß, aber es ist etwas anderes, wenn man selbst als Unbeteiligter Zeuge davon wird.«
Anthony fragte nicht nach, was Mildred damit meinte, aber er konnte sich vorstellen, dass eine sensible Seele wie sie mehr spürte oder erlebte als viele andere Menschen.
»Dabei fällt mir ein, ich habe noch eine Aufgabe zu erfüllen. Sozusagen der letzte Wunsch von Minnie. Ich muss ihrem kleinen Freund ihr liebstes Kuscheltier übergeben«, sagte Mildred.
»Tu das. Für mich ein Beweis, dass du nicht zufällig dabei warst.«
»Trotzdem kann ich nicht begreifen, dass man mit dem Zimmer nicht warten konnte …«
»Schau mal, Minnie hat für ein anderes, unglückseliges Kind Platz gemacht. Eines, das zu Hause vielleicht viel schneller gestorben wäre, ohne vorher die Fürsorge und die Annehmlichkeiten dieses Ortes erleben zu dürfen. Wo es vielleicht sogar die Chance bekommt, zu gesunden. Sieh es einmal von dieser Warte. Und dieses Haus ist zwar dem Allgemeinwohl sehr dienlich und äußerst sozial geleitet, aber ohne die finanziellen Mittel der zahlungskräftigen Patienten wäre es bald am Ende. Eine Familie, die es sich leisten kann, ihr Kind derart luxuriös unterzubringen, wird entsprechend dafür zahlen müssen. Und das kommt letztendlich allen hier zugute. Auch, wenn unsere kleine Florence Nightingale hier das manchmal vergisst.«
»Nein, das tue ich nicht. Ich bin mir voll bewusst, was diese Frau für unseren Berufsstand getan hat, gerade, weil sie auch die Ansicht vertrat, dass es neben dem ärztlichen Wissen ein eigenständiges pflegerisches Wissen geben sollte. Ihre Ausführungen gelten als Gründungsschriften der Pflegetheorie, aber darin steht bestimmt nicht, dass man Sterbende wegsperrt, weil sie im Weg oder unbequem sind.«
»Du hast ja Recht. Aber was erwartest du? Das ganze System hier funktioniert nur, weil man peinlich darauf bedacht ist, die Kranken nicht zu beunruhigen. Deshalb werden auch die Verstorbenen heimlich aus dem Haus gebracht. Und du siehst, auch vor Schwestern und Pflegern wird so manches verborgen, damit die durchhalten und nicht irgendwann das Handtuch werfen. So, und jetzt lass uns die Abendluft genießen und die trüben Gedanken vertreiben. Es ist niemandem geholfen, wenn du deine Kraft und deinen Enthusiasmus verlierst, den Patienten am allerwenigsten.«
Am nächsten Tag nahm Mildred den Teddy, den sie in ihrem Spind in Sicherheit gebracht hatte, und machte sich auf die Suche nach dem kleinen Leander. Dabei begegneten ihr zwei kleine Mädchen, Zwillinge, die sich kaum voneinander unterschieden, nur ihre Kleider und die passende Haarschleife waren von unterschiedlicher Farbe. Eines der Mädchen weinte bitterlich, während das andere einen nagelneuen Ball mit modernem Muster fest umklammert hielt. Mildred drehte es fast das Herz um, als sie erkennen musste, dass die Krankheit selbst vor Zwillingen nicht Halt machte. Wie schrecklich für die Eltern, womöglich gleich beide Töchter zu verlieren, dachte sie. Dabei übersah sie völlig, dass gerade der Zwillingsstatus der Mädchen dem Krankheitserreger leichtes Spiel ermöglicht hatte. Fürsorglich bückte sich Mildred zu dem weinenden Mädchen hinunter und wischte ihm mit einem Taschentuch die Tränen ab.
»Was hast du denn, mein Schatz? Geht es dir nicht gut?«
Ein neuer Tränenstrom war die Antwort.
»Sie hat ihren Ball verloren«, sagte das andere Mädchen, »wir hatten nämlich beide den gleichen.«
»Gar nicht verloren, man hat ihn gestohlen …«
»Deshalb musst du doch nicht weinen. Ihr habt ja noch einen. Und Ballspielen ist doch zu zweit viel schöner als alleine.«
Die Miene des weinenden Mädchens hellte sich etwas auf. Mildreds weiche Stimme und ihre Zuwendung taten augenblicklich ihre Wirkung.
»Siehst du, habe ich doch gleich gesagt. Der andere Ball war eigentlich überflüssig.«
»Du hast ja noch deinen. Der mir gehört hat, ist weg.«
»Dann gehört dieser eben jetzt uns beiden, okay?«
Das Mädchen nickte, und die Tränen versiegten.
»Wenn ich den Ball irgendwo finde, bringe ich ihn dir wieder, einverstanden?«, sagte Mildred und erhielt einen dankbaren Blick. »So, und jetzt geht nach draußen in die Sonne, die wird euch gut tun.«
Die Mädchen waren kaum weg, als ein Junge um die Ecke kam, der geschickt mit seinen Füßen einen bunten Ball in Schach hielt, der Mildred sehr bekannt vorkam.
»Hallo, junger Mann, hier auf dem Gang wird nicht ballgespielt. Oder gehst du nur deshalb nicht nach draußen, weil dir der Ball nicht gehört?«
»Woher wissen Sie das?«, stotterte der Junge verlegen.
»Weil ich eben genau den gleichen bei den Zwillingen gesehen habe. Das eine Mädchen hat sehr geweint.«
»Die soll sich nicht so haben. Die besitzen doch sowieso alles doppelt. Das grenzt schon an Verschwendung.«
»Du hast wohl kein eigenes Spielzeug zu Hause?«
Der Junge schüttelte den Kopf. »Ich muss mir alles mit meinen Brüdern teilen, weil meine Eltern nicht viel Geld haben. Deshalb habe ich auch kein eigenes Zimmer hier bekommen wie die Zwillinge, sondern muss mit neun anderen Jungen in einem schlafen.«
»Verstehe«, sagte Mildred gerührt. »So ist das nun mal auf der Welt, weißt du. Manche Menschen haben alles im Überfluss, und andere haben fast gar nichts. Mir ging es ebenso wie dir, ich musste auch alles mit meinen Geschwistern teilen. Aber man darf nicht neidisch sein. Die Mädchen hätten dir bestimmt einen der Bälle geborgt, wenn du sie darum gebeten hättest. Weißt du was, du gehst sie jetzt suchen und gibst ihnen den Ball zurück. Du sagst einfach, du hättest den Ball gefunden. Das ist eine Notlüge, die darf man in seltenen Fällen gebrauchen. Dabei fragst du sie gleich, ob du mit ihnen gemeinsam spielen darfst. Das macht doch viel mehr Spaß als alleine.«
Der Junge nickte mit schuldbewusstem Gesicht. Leider hielt seine Reue nur so lange an, bis Mildred außer Sichtweite war.
Später fand sie Leander auf dem Sonnenbalkon inmitten anderer Kinder.
»Schau mal, Minnie hat mich gebeten, dir den zu geben.«
»Danke, aber das hätte sie doch selber tun können …«
»Minnie war schon sehr schwach, bevor sie … hinübergegangen ist.«
»Was meinst du mit „hinübergegangen“? Sie ist doch noch hier, vorhin hat sie uns alle hier draußen besucht.«
Die anderen Kinder stimmten zu, indem sie heftig nickten.
»Aber ihr müsst euch irren. Minnie ist gestern ganz ruhig eingeschlafen. Da, wo sie jetzt ist, geht es ihr bestimmt besser.«
»Wenn ich doch sage, dass sie mich besucht hat«, protestierte Leander, »sie will in meiner Nähe bleiben, hat sie gesagt. Wir werden uns weiterhin jeden Tag sehen und zusammen spielen. Aber den Teddy darf ich trotzdem behalten, wenn du ihn mir bringst, weil sie ihn nicht mehr braucht.«
Mildred wusste nicht, was sie antworten sollte. Sie hatte ja schon davon gehört, dass Leute ihre verstorbenen Angehörigen weiterhin in ihrer Nähe sahen, manche Kinder ganz besonders, weil sie einen Sinn für übernatürliche Phänomene haben, der erst langsam mit dem Erwachsenwerden schwindet, aber dass gleich mehrere Kinder behaupteten, Minnie gesehen zu haben, überforderte Mildred etwas. Und überhaupt, woher wusste Leander, dass Minnie Mildred gebeten hatte, den Teddy zu übergeben, und nicht eine der Kinderschwestern? Das hörte sich geradezu so an, als hätte Minnie es ihm gesagt. Ob Leander das Zimmer auch gefunden und das Mädchen noch kurz vor ihrem Tod besucht hatte? Ja, so musste es gewesen sein, beruhigte sich Mildred selbst. Dabei vergaß sie völlig, dass Minnie schon tot gewesen war, als Mildred das Zimmer verlassen hatte. Sie konnte also Leander gar nicht mehr gesagt haben, wer den Teddy an sich genommen hatte. Aber Mildred wollte solche Gedanken nicht zulassen. Die Vorstellung, dass verstorbene Patienten weiterhin durchs Haus geisterten, war ihr dann doch zu unheimlich. Blieb nur noch die Frage, warum die anderen Kinder sagten, Minnie auch gesehen zu haben? Ob sie sich von Leanders Schilderung hatten anstecken lassen, weil diese so plastisch gewesen war, dass alle meinten, sie leibhaftig gesehen zu haben? Irgendwo dazwischen musste die Wahrheit liegen, beschloss Mildred zu glauben. Das fehlte ihr noch, annehmen zu müssen, an einem Ort gelandet zu sein, an dem es spukte. Schneller als sie ahnen konnte, sollte Mildred darüber Gewissheit bekommen.
»So nachdenklich?«, fragte Mildred am Abend Sally, die sie kaum wahrzunehmen schien.
»Was? Ja, mir geht da so Verschiedenes durch den Kopf«, sagte Sally.
»Du, ich möchte da etwas klarstellen. Ich habe nichts gegen dich. Vielleicht war ich etwas beleidigt, dass du mich in Bezug auf Ellen im Unklaren gelassen hast. Aber schließlich ist es dein gutes Recht, über Dinge, die dir wehtun, nicht zu sprechen.«
»Das ist es ja nicht. Ich weiß, es war blöd von mir. Du musstest ja denken, ich hätte etwas zu verbergen. Aber ich kann nur wiederholen, wirklich nicht zu wissen, was mit Ellen geschehen ist. Den Quatsch, sie habe sich aufgehängt, glaube ich jedenfalls nicht. Andererseits finde ich es höchst merkwürdig, dass Ellen einfach so gegangen ist, ohne sich von mir zu verabschieden, und nie wieder etwas von sich hören lassen hat.«
»Vielleicht konnte sie es nicht, weil ihr wirklich etwas zugestoßen ist. Hat denn die Polizei den Fall nicht untersucht?«
»Doch, aber weißt du, wie viele Frauen in Amerika täglich spurlos verschwinden? Da heißt es gleich, sie ist mit irgendeinem Kerl durchgebrannt. Ihre Sachen hat man ja auch nicht gefunden. Irgendwann wird die Akte geschlossen worden sein. Ich bin dir nicht böse, wenn du an alles Mögliche denkst, denn ich verstehe es ja selbst nicht.«
»Wenn du mir nicht böse bist, was ist es dann, das dich bedrückt? Oder ist es zu privat? Möchtest du darüber nicht reden?«
»Nein, es ist nichts Privates. Du kennst vielleicht diese zarte Schönheit mit den auffälligen Stimmungswechseln. Josephin Arthur heißt sie und ist eine meiner Patientinnen.«
Mildred nickte bejahend. Wohl keinem war diese junge Frau entgangen, die allein durch ihr Auftreten alle Blicke auf sich zog.
»Also Josephin poussiert mit Robert Lonsdale. Ohne ihn und seine Liebesbeweise hätte sie sich wohl schon aufgegeben. Das Letzte, was Josephin von ihm gehört hat, war, dass er sich dem Pneumothorax-Verfahren unterziehen sollte. Du weißt, diese scheußliche Sache, bei der man einen Lungenflügel zum Kollabieren bringt, um die Selbstheilungskräfte anzukurbeln. Nicht ganz ungefährlich, und immer wieder kommt es dabei zu Todesfällen. Lange Rede, kurzer Sinn, Robert Lonsdale ist seitdem verschwunden. Er ist nicht in seinem Zimmer, und auch nicht auf der Intensiv. Und Josephin ist kurz vor dem Durchdrehen, weil sie glaubt, man habe ihn in eine andere Klinik verlegt. Darüber gibt es aber keinerlei Unterlagen, das habe ich selbst herausgefunden.«
»Ich hätte da eine Idee«, sagte Mildred, »wenn du Mut hast, dann zieh dich an und lass uns rüber ins Haus gehen.«
Sally ließ sich nicht lange bitten und folgte Mildred in das Sanatoriumsgebäude. Wie zwei Diebinnen schlichen sie über die Gänge. Ängstlich darauf bedacht, kein Geräusch zu verursachen und nicht von einer der Nachtschwestern entdeckt zu werden. Vor dem Sterbezimmer machte Mildred Halt.
»Was willst du in der Putzkammer?«, flüsterte Sally, »da drin wird er bestimmt nicht sein.«
»Abwarten«, sagte Mildred und drückte die Klinke herunter, die auch tatsächlich nachgab, aber die Tür ließ sich trotzdem nicht öffnen.
»Gib mir mal eine deiner Haarnadeln«, sagte Mildred.
Sally, die ihr Haar an diesem Tag aufgesteckt trug, löste zwei Nadeln aus ihrer Frisur. Mildred hatte gleich mit der ersten Glück, da es sich um ein relativ einfaches Schloss handelte. Es war stockdunkel in der Kammer, aber als Mildred den Lichtschalter fand und sich die spärliche Beleuchtung einschaltete, fanden sie nur ein leeres Bett mit nackten Matratzen.
»Was ist das denn?«, fragte Sally, nachdem sie die Tür leise geschlossen hatte, »die Ausnüchterungszelle, oder was?«
»Du hast wirklich keine Ahnung, nicht? Das ist das sogenannte Sterbezimmer, von dem wohl die Wenigsten etwas wissen. Ich habe es zufällig entdeckt, und die kleine Minnie ist gestern hier in meinen Armen gestorben.«
»Sag das noch mal, sie haben das Kind hierhin abgeschoben? Ach deshalb warst du so verstört. Warum hast du nichts gesagt?«
»Ich war wohl ebenso sprachlos wie du, wenn es um Ellen geht. Anthony hat mich seelisch aufgefangen. Hinterher ging es mir etwas besser.«
»Du meinst doch nicht etwa Anthony Tubman, den engelsgleichen Pfleger? Respekt, ich sag ja, vor dir muss man sich in Acht nehmen.«
»Hast du selbst ein Auge auf ihn geworfen?«
»Nein, keine Sorge, ich mag mehr die Harten als die Zarten, das ist ja das Unglück. Von deinem Anthony dürfte so manche Schwester träumen. Er hingegen scheint auf dich gewartet zu haben.«
Die beiden Frauen grinsten sich an und umarmten sich.
»Komm, lass uns gehen, bevor uns noch jemand erwischt«, meinte Mildred. »Oberschwester Rhonda zum Beispiel. Wenn keiner von dem Zweck des Zimmers weiß, die bestimmt.«
»Davon kannst du ausgehen. Aber, wo wir schon mal hier sind, sollten wir zwei Etagen tiefer nachsehen«, schlug Sally vor. »Vielleicht liegt Robert Lonsdale schon auf Eis.«
»Nein, ohne mich. Da kriegen mich keine zehn Pferde hin!«, rief Mildred entsetzt aus.
»Jetzt sei kein Hasenfuß. Vorhin hast du mich noch gefragt, ob ich Mut habe. Ich bin ja bei dir. Die Toten sind weitaus ungefährlicher als die Lebenden, das kann ich dir garantieren.«
Im Kellergeschoss warfen die beiden Frauen ihre Mäntel in einen Nebenraum, um in ihrer Schwesterntracht weniger aufzufallen. Sie waren überrascht, die Leichenkammer unverschlossen vorzufinden. Aber wer sollte sich auch dort hinverirren, der dort nichts zu suchen hatte, oder gar eine Leiche stehlen? Dieser Ort bereitete den meisten starkes Unbehagen, es sei denn, man war den Umgang mit Leichen gewohnt.
Als Sally das Licht einschaltete, wurde der Raum in einen blau-violetten Schein getaucht, der die unheimliche Atmosphäre noch verstärkte. Mildred schauderte, und das lag am wenigsten an der kühlen Raumtemperatur. Am liebsten hätte sie augenblicklich wieder den Rückzug angetreten, aber sie war voller Bewunderung für den Mut der Kollegin, die keine Hemmungen hatte, die Laken zu heben, um erkennen zu können, ob sich Robert Lonsdale unter den fünf aufgebahrten Toten befand.
Sally lüftete gerade das dritte Tuch, als Mildred ihren Mund zu einem stummen Schrei öffnete. Sie wurde stocksteif und ihre Augen quollen förmlich aus den Höhlen. Der vierte Leichnam hinter Sallys Rücken begann sich gerade langsam aufzurichten, und Mildred hatte nur einen Gedanken, dass sich bitte nicht das Laken über seinem Kopf lösen würde, damit sie nicht in die gebrochenen Augen schauen musste. Mit letzter Kraft streckte sie den Arm aus und deutete mit dem Finger auf das schaurige Geschehen. Sally drehte sich um und lachte.
»Da musst du dir nichts bei denken. Das sind nur die Gase in dem Körper. Die chemischen Prozesse gehen nämlich noch eine Weile weiter«, sagte sie trocken, »wusstest du, dass bei Toten die Haare und die Fingernägel weiter wachsen?«
Mildred hatte genug gesehen und gehört. Sie löste sich aus ihrer Starre und rannte einfach los. Dabei vergaß sie sogar ihren Mantel, weil sie nur einen Gedanken kannte, so schnell wie möglich zurück ins Schwesternwohnheim und in ihr Zimmer zu gelangen.
Dort fand Sally sie später wie Espenlaub zitternd auf dem Bett sitzend vor.
»Die Nervenstärkste bist du nicht gerade«, schmunzelte Sally, »hier, ich habe dir deinen Mantel mitgebracht.«
Mildred war kaum ansprechbar.
»Ich glaube, du brauchst einen Schnaps. Wie gut, dass ich für solche Fälle einen Flachmann parat habe.«
Sally flößte der sich heftig sträubenden Mildred den Whiskey ein. Heftig hustend und prustend kam Mildred nach einer Weile wieder zu Atem und hörte tatsächlich auf, zu zittern.
»Das war ohne Übertreibung das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe«, sagte sie leise, »und dabei war noch alles umsonst.«
»Ja leider, Robert Lonsdale war nicht unter den Leichen. Entweder haben sie ihn schon abtransportiert oder er ist wirklich in eine andere Klinik verlegt worden.«
»Daran glaubst du doch selbst nicht. Dann würde es doch irgendwelche Unterlagen darüber geben.«
»Weißt du, was wir vergessen haben?«, fragte Sally. »Wir hätten in der Kapelle nachsehen sollen. Vielleicht liegt der gute Robert da festlich aufgebahrt. Früher haben sie das so gemacht. Da hat es aber auch weniger Sterbefälle gegeben.«
»Eben, wir haben allein fünf unten liegen gesehen. Das würde in eine Massenveranstaltung in der Kapelle ausarten. Und Josephin Arthur hat da bestimmt schon nachgesehen. In ihrer Verfassung lässt die nichts aus.«
»Ich mache mir Sorgen um das arme Ding«, meinte Sally. »Hoffentlich tut sie sich nichts an, um ihrem Robert zu folgen.«