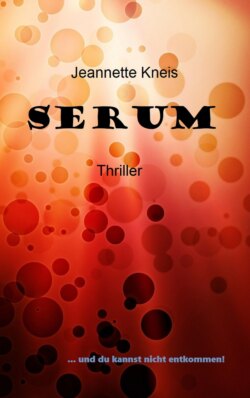Читать книгу SERUM - Jeannette Kneis - Страница 5
Heimischer Alptraum Heimischer Alptraum
ОглавлениеNach einer leicht holperigen Fahrt auf dem viel genutzten Asphalt des Flughafens, parkte der Pilot einwandfrei am Hauptgebäude ein. Die schubstarken Turbinen verstummten und ein geschäftiges Treiben begann im Inneren. Neben der Lufthansa-Maschine standen bereits Flugzeuge anderer Linien. Das Drehkreuz Halle-Leipzig war ausnahmslos begehrt für jegliche Art von Luftfracht. Ein strategisch sehr günstiger Punkt. Die DHL führte hier einen gewaltigen Umschlagplatz, der zukünftig noch größer werden sollte, und auch die Bundeswehr nutzte den Airport gerne für ihre Zwecke. Abgesehen von den Millionen jährlicher Passagiere, die von hier aus ihren Urlaubszielen entgegenflogen. Das Gateway wurde präzisionsgenau herangefahren und die Luke von dem einzig männlichen Flugbegleiter geöffnet. Danach strömte Dr. Kurz wie auf einer Welle mit den anderen erschöpften und übernächtigten Passagieren hinaus. Über mehrere, gläserne Gänge, in recht zügigem Marschschritt und ohne viele Worte zu verlieren, erreichte die Gruppe die Ankunftshalle mit den Gepäckausgaben. Beamte der Flughafenpolizei und des Zolls standen bereit. Die wenigen Gepäckbänder surrten. Im Hintergrund polterte es besorgniserregend. Die übermüdeten Fluggäste scharten sich eilig um die schwarzen Fließbänder mit den sich überlappenden Lamellen. Jeder wollte selbstverständlich zuerst seinen Koffer an sich reißen. Doch es dauerte. Und nicht nur Madeleine wurde unruhig. Sie wollte nach Hause. Sie sehnte sich nach der Sicherheit und Geborgenheit ihrer vier Wände. So schnell es nur ging. Nach einer träge vorbeiziehenden, viertel Stunde gesellten sich weitere Fluggäste hinzu. Plötzlich blieben die Gepäckbänder stehen. Ein Murren ging durch die Menge. Dann erschienen auf den Anzeigetafeln über den Ausgaben die jeweiligen Herkunftsflughäfen und die Bänder setzten sich abermals in Gang. Ein Drängeln begann. Jeder wollte der Erste sein. Madeleine Kurz stand glücklicherweise richtig und brauchte nur noch zuzugreifen, wenn ihr Koffer auf sie zukam. Doch sie musste ihre ganze Körperkraft aufwenden, um nicht in die zweite Reihe gedrängt zu werden. Menschen konnten echt rücksichtslos sein. Nach einer weiteren viertel Stunde erschien ihr Koffer. Mit etwas Mühe bugsierte sie diesen vom Fließband. Kein Mensch half ihr dabei, aber sie schaffte es. Ohne Probleme passierte sie anschließend den Zoll. So schnell, wie ihre schweren Beine sie trugen, durchschritt sie die weitreichende, moderne Empfangshalle, in der etliche, müde aussehende Besucher ungeduldig, immer wieder die Ankunft Anzeigetafeln studierend, auf ihre reisenden Angehörigen und Freunde warteten. Freudig strebte die junge Frau dem Ausgang entgegen. Eine der gläsernen Drehtüren nahm sie auf und bugsierte sie kleinschrittig nach draußen. Mit einer unbeschreiblichen Genugtuung setzte Doktor Madeleine Kurz ihren Fuß auf Leipziger Boden. Erleichtert, mit geschlossenen Augen, inhalierte sie die, zwar eiskalte, aber erfrischende Leipziger Luft wie eine Droge. Es roch nach Heimat. Wie lange hatte sie sich danach gesehnt. Es war wie ein Traum. Ein Traum, der in Erfüllung ging, denn vor zu nicht allzu langer Zeit hatte sie kaum noch gewagt zu hoffen, dass sie es bis hier her schaffte. Die Messestadt Leipzig lag unter einer hauchzarten Schneedecke. Einzelne Flöckchen tanzten im langsamen Walzer herab. Fasziniert schaute sie den von Mutter Natur unterschiedlich geformten Eiskristallen zu, die lautlos und majestätisch vom hell erleuchteten Himmel auf ihren Mantel herabschwebten. Verträumt genoss sie den beruhigenden Anblick und vergaß überdies gänzlich ihre Umwelt. Sie merkte nicht einmal, dass ihre Finger kalt zu werden begannen. Ihr Glücksmoment wurde jäh unterbrochen, als hätte sie es nicht anders verdient. Eine widerwärtige Übelkeit stieg auf und drängte sich hartnäckig in ihr Bewusstsein. Auf Höhe ihres Zwerchfells breitete sich ein schmerzhaftes Kribbeln aus. Madeleine krümmte sich. Was geschah mit ihr? Welchen Grund gab es für diese verwirrenden, gesundheitlichen Probleme? Auf jeden Fall war das keine Hypoglykämie. Sie versuchte sich zu beherrschen, was ihr sehr schwer gelang. Der Schmerz zeigte sich von seiner fiesesten Seite. Es musste komisch aussehen, wie sie nach vorn gebeugt an der hohen Bordsteinkante stand, mit weit aufgerissenen Augen und eine Hand auf den Oberbauch gepresst, während sie sich mit der anderen auf ihrem Gepäck abstützte. Immer wieder hielt sie für einige Sekunden die Luft an, um den Schmerz dadurch erträglicher zu machen. Wollte sie irgendjemand oder irgendetwas von innen erstechen? Madeleine war den Tränen nahe. Mit einer erneuten Schmerzattacke brachen sie aus ihr heraus und ergossen sich auf den Schnee, der an diesen Stellen sofort von den warmen Tränen kreisrund schmolzen. Warum half ihr niemand? Musste sie denn erst um Hilfe schreien? War der Flughafen denn plötzlich menschenleer geworden? Madeleine spürte Angst in sich keimen und konnte es nicht verhindern.
„Hallo, junge Frau! Brauchen Sie ein Taxi?“ schmetterte ihr unverhofft ein Tenor entgegen.
Die Angesprochene, mit den Symptomen ihrer unerklärlichen Erkrankung beschäftigt, bemerkte die Anwesenheit des Taxifahrers in den ersten Sekunden nicht. Erst als er mit seinem umfangreichen, von einem in Grau und Grün gestrickten Pullover bedeckten Bauch direkt neben ihr stand, blickte sie mühevoll auf. Eine Kappe im englischen Stil wärmte seinen offenbar kahlen Kopf. Kalter Zigarettenrauch und der Geruch von Pfefferminzbonbon umgaben ihn. Über dem altmodischen Pullover trug er eine abgewetzte, braune Lederjacke. Kein anderer schien sich offensichtlich für ihre sonderbare Körperhaltung zu interessieren.
„Sie sehen nicht besonders gesund aus. Der Flug ist Ihnen wohl nicht bekommen. Soll ich Sie nach Hause fahren?“ Hinter dem warmherzigen Mitleid des Taxifahrers stand natürlich auch der Gedanke an einen guten Verdienst.
Madeleine zwang sich zu einem Lächeln, das sie dem stark untersetzten Ende Fünfziger schenkte. „Das“, sie holte tief Luft, „wäre ganz in meinem Interesse.“
Der hilfsbereite Mann nahm den roten Hartschalenkoffer und verstaute ihn schwungvoll im Kofferraum seines Fahrzeuges, das nur ein paar Meter entfernt am Straßenrand, auf den für Taxen gekennzeichneten Flächen stand. Danach wälzte er seine vollschlanke Figur auf den Fahrersitz. Sein Fahrgast hatte sich derweil die wenigen Meter zum Taxi geschleppt und es sich auf einem der hinteren Plätze erleichtert eingerichtet. Endlich sitzen! Nur mit Mühe gelang es ihr sich anzuschnallen. Der Schmerz. Die eiskalten Finger. Die Gedanken abwegig.
Der Taxifahrer drehte sich noch einmal um, soweit es sein kugelrunder Leib zuließ. Er sah sichtlich besorgt aus. „Sie schauen nicht gut aus“, stellte er fest, während er an einem neuen Pfefferminzbonbon lutschte. „Soll ich Sie lieber in ein Krankenhaus bringen? Die Helios-Klinik in Schkeuditz wäre das nächstgelegene.“
„Nein, kein Krankenhaus“, polterten die Worte überraschend klar aus der Angesprochenen heraus. „Nur nach Hause.“ Gleich darauf stöhnte Madeleine schon wieder vor Schmerz und Übelkeit. Die Augenlider schließend lehnte sie sich zurück. Die Aktentasche lehnte an ihrer Seite, aber sie nahm diese kaum wahr.
Der Taxifahrer gab sich widerwillig mit der Antwort zufrieden. Seinen kranken Fahrgast in ärztliche Obhut zu geben, wäre ihm weitaus lieber gewesen. Die junge Frau lehnte medizinische Versorgung jedoch ab. So fügte er sich notgedrungen und wünschte, dass die Fahrt problemlos verlief.
Ich muss es schaffen! Ich muss … Ich muss es schaffen! Warum … bin ich nur … immer … auf mich allein … gestellt? Madeleine stöhnte gequält. Diese heftige Attacke aus dem Inneren ihres Körpers griff sie brutal und rücksichtslos an. Obwohl es noch ein weiter Weg bis nach Hause war, hoffte sie dennoch schnell ihr Ziel zu erreichen. Schließlich gab es in der Nacht weniger Verkehr und die Hauptstraßen waren meist geräumt und gestreut. Die Hälfte der Ampeln blieb aus, um Strom zu sparen.
„Entschuldigen Sie, junge Frau! Wenn Sie mir noch sagen, wohin die Fahrt gehen soll!“
Frau Dr. Kurz gab ihre Adresse bekannt, der Fahrer tippte das Ziel ins Navi ein und das Taxi setzte sich ohne weiteren Verzug in Bewegung. Sie verließen über eine von Räumfahrzeugen präparierte, komplizierte Straßenführung das attraktiv angelegte Areal des Leipziger Flughafens.
„Wenn Sie sich übergeben müssen, sagen Sie mir bitte Bescheid! Dann halte ich am Straßenrand an!“ bat der Fahrer. Er hatte keine Lust darauf, dass die Frau ihm den Innenraum seines E-Klasse Dienst-Mercedes voll reiherte. Die Sauerei wieder zu entfernen wäre die reinste Sauerei. Sein Chef würde nicht begeistert sein.
„Ja - in - Ordnung!“ erwiderte sein Fahrgast mit kraftloser Stimme.
Sie fuhren in der Dunkelheit eines eiskalten Novembers endlos wirkende Landstraßen entlang. Das helle Scheinwerferlicht kroch gierig voraus. Manchmal tauchten zwischen den Bäumen gespenstische Schatten auf. Das Radio dudelte leise vor sich hin und das Taxameter meldete rote Zahlen, dessen Betrag sich kontinuierlich erhöhte. Die Wärme der Klimaanlage lullte die beiden Insassen ein. Der Taxifahrer blickte immer wieder mit nervösem Ausdruck durch den Innenrückspiegel in den Fond des Mercedes, um nach seinem kranken Passagier zu schauen, während er hin und wieder einen Schluck eines erkalteten Kaffee to go trank und sein Bonbon geräuscharm im Mund hin und her wälzte. Offensichtlich schlief sein Fahrgast, wobei er jedoch so wehleidig stöhnte, dass einem das Blut in den Adern gefrieren konnte. Sollte er die junge Frau lieber doch in das nächstgelegene Krankenhaus fahren? Auch ohne ihre Einwilligung? Wer weiß, was sie sich während ihrer Reise an Krankheitserregern eingefangen hatte. Er wusste nicht recht, wie er sich entscheiden sollte und fuhr deshalb einfach weiter. Je schneller er sie ans Ziel brachte, umso schneller war er die problematische Passagierin wieder los. Na ja, besser die kranke Frau im Fond, als ein Verrückter mit einer Knarre an seinem Kopf, dachte er mit dem nächsten Atemzug.
Irgendwann erreichte das Taxi seinen Bestimmungsort. Nur jede zweite Straßenlaterne spendete Licht, so dass einige Häuser im Dunkeln lagen. Doktor Kurz' Haus wurde gerade noch von dem Restlicht einer entfernt stehenden, hoch aufragenden Lampe berührt.
„He! Junge Frau! Wir sind da!“ Der Tenor des Taxifahrers erfüllte den Innenraum des Fahrzeugs.
Madeleine schreckte mit einem ängstlichen, hohen Laut auf. Benommen blickte sie sich um, erkannte ihre Situation und schielte dann zum Seitenfenster hinaus, um sich zu vergewissern, dass sie vor ihrem Haus standen. Zwischen zwei verschwommen Blicken hindurch erkannte sie ihr Eigenheim. Ihr bedenklicher Gesundheitszustand ließ es schwerlich zu, dass sie sich erleichtert fühlen konnte. Dann glitten ihre Augen zum Taxameter. Eine undeutliche, vierstellige Summe blickte sie mahnend an. „Klein' Moment“, das t verschluckte sie halb, „ich such das Geld 'raus.“ Für das heraus fehlte ihr schon die Kraft zum Sprechen. Nicht mehr ganz bei Sinnen wühlte sie in ihrer Tasche, bis sie das Portemonnaie endlich erfühlte. Sie holte den einzigen Schein, von dem sie noch halbwegs wusste, dass es ein 50 Euro-Schein war, daraus hervor und reichte diesen zitternd und verhalten keuchend dem Taxifahrer. „Stimm so!“ beschied sie matt. Sie befand sich kaum in der Lage die Augenlider zu heben. Ihr Bewusstsein taumelte plötzlich irgendwo zwischen Wachsein und Bewusstlosigkeit. Ein Teil in ihr kämpfte gegen den Untergang an, während der andere bereits aufgegeben hatte. Wahllos warf sie ihre Geldbörse zurück in die Tasche und wollte aussteigen, hatte sich jedoch weder abgeschnallt, noch fand sie den Türgriff. Ihre Fingernägel kratzten unrhythmisch an der Innenverkleidung.
Was … was is nur … mid mir … los …? Schon wiedr … ne … Hy-po?
„Danke!“ erwiderte der Mann verblüfft. So großzügiges Trinkgeld war ausgesprochen selten. Er blickte zu seinem Fahrgast zurück. Mitleid und Sorge übermannte ihn. Unter seiner Haut breitete sich Unwohlsein aus. Er musste ihr unbedingt helfen. Als ehrlicher Mann blieb ihm nichts anderes übrig. „Warten Sie, ich helfe Ihnen!“ rief er sie an, als er die Frau erschrocken beobachtete, wie diese mit der hinteren rechten Autotür kämpfte … und verlor. Eilig steckte er den Schein weg, um seinem kranken Passagier zu helfen. Wie er feststellten musste, konnte sich die Frau kaum noch auf den Beinen halten, nachdem er sie aus dem Fond gezogen hatte. Die Tasche, die ihr aus der Hand zu rutschen drohte, nahm er reflexartig an sich. Er legte sich ihren linken Arm über seine breiten Schultern und griff mit seiner rechten Hand um ihre Hüfte und hoffte auf diese Art vorwärts zu kommen. Doch die Frau klebte wie ein nasser Sack an ihm, kaum noch imstande selbst ein paar Schritte zu gehen. Er musste sie zum Hauseingang halb schleifen, halb tragen, so schwer hing sie an seiner Seite. Kaum zu glauben bei ihrer zierlichen Statur. Sein gewaltiger Bauch trug noch zu zusätzlichen Unannehmlichkeiten bei dem Transfer seines Fahrgastes bei. Schnaufend und völlig durchgeschwitzt schaffte er es mit ihr durch das Gartentor und bis zum Eingang des Bungalows. Glücklicherweise bescherte ihm die über einen Sensor eingeschaltete Außenbeleuchtung ausreichend Helligkeit.
„Wo ist der Haustürschlüssel? Junge Frau? Der Haustürschlüssel?“ Er konnte sie kaum noch halten. Seine Kräfte verließen ihn merklich. Er verfügte kaum über die geeignete Kondition schwere Lasten zu bewegen. Sie blieb ihm eine Antwort schuldig. Also kramte er, wenn auch widerstrebend, umständlich in der Aktentasche danach. Schnell fand er ihn in einer innen liegenden Seitentasche. Eilig öffnete er die Haustür. Die Frau begann ihm aus den Händen zu gleiten. Mehrmals musste er nachfassen. Er machte Licht und hievte die Frau zu einer einladenden, großzügigen Couch, wo er sie halb liegend, halb sitzend, ablud. Erschöpft und erleichtert atmete der Taxifahrer auf. Und ehe er sich fragen konnte, was er als Nächstes tun sollte, nahm die Hausbesitzerin ihm unerwartet die Entscheidung ab.
„Traumsucker!“ flüsterte Madeleine mit fadendünner Stimme „Trau-bn-sucka!“
„Was? Was haben Sie gesagt?“ Instinktiv hatte er es wohl doch verstanden. Er wühlte nochmals, dieses Mal mit weniger Widerwillen, eher mit dem Drang, der Frau das Leben zu retten, in der Tasche und nahm eine kleine Packung mit Dextrose Tabs heraus. Im Gegenzug ließ er die Hausschlüssel hineinfallen. Er führte eines der kleinen, weißen Täfelchen direkt an ihre Lippen und sagte deutlich: „Traubenzucker.“ Reflexartig öffnete sich Madeleines Mund. Langsam zerging ihr das lebenserhaltende Tab auf der Zunge. Drei weitere Tabs folgten. Der Taxifahrer beruhigte sich nun auch zunehmend. Er hatte alles richtig gemacht. Die junge Frau war Diabetikerin und stark unterzuckert. Kein Wunder, dass es ihr so schlecht ging. Für einen kurzen Moment verließ ihr Lebensretter das Haus, um das restliche Gepäck aus dem Taxi zu holen, welches er im Flur abstellte. Anschließend führte ihn sein Weg nochmals in das Wohnzimmer. Er wollte nicht einfach gehen, bevor er sich nicht vergewissert hatte, dass es seinem Fahrgast tatsächlich besser ging. Er setzte sich behutsam auf einen der weißen Sessel und wartete, die Unterarme auf den Oberschenkeln ruhend. Fünf Minuten. Zehn Minuten. Zwölf Minuten. Sollte er die nassen Schuhspuren im Haus schnell mit einem Lappen aus seinem Taxi entfernen? - Nee. Wozu der Aufwand. Wenn es der Frau besser ging, würde sie die Angelegenheit selbst in die Hand nehmen. Vielleicht hatte sie ja auch 'ne Putze. Fünfzehn Minuten. Für fast das Doppelte an Trinkgeld, konnte er noch einen kleinen Moment warten. Dabei begutachtete er abwechselnd den Gesichtsausdruck der Frau und die offensichtlich teure und sehr moderne Einrichtung ihrer Wohnstube.
Endlich schlug Doktor Kurz die Augen auf. Zu Beginn noch unklar, schärfte sich ihr Blick nach mehrmaligem Augenzwinkern, und sie schaute in das runde Pfannkuchengesicht mit den kleinen Schweinsäuglein ihres hilfsbereiten Taxifahrers. Ein prächtiger, gepflegter Schnauzer zierte noch immer seine Oberlippe. Unter seiner englischen Kappe drückten sich vereinzelt Schweißperlen hervor, die sich in den hochgezogenen Augenbrauen verfingen. An seinem Doppelkinn sprossen die ersten Barthaare.
„Meine Tasche?“ war Kurz' erster Satz, der ein wenig hysterisch klang. Unter ihrer Kleidung stieg die Anspannung. Ihre Gesichtszüge versteinerten. Noch fehlte ihr die Kraft sich aufzurichten. Also blieb sie liegen, wie sie lag – halb sitzend und halb liegend.
„Liegt direkt neben Ihnen. Rechts. Es ist noch alles drin. Hab' nur den Schlüssel benutzt. Musste ja irgendwie hier rein.“
„Gott sei Dank!“ nuschelte Madeleine und entspannte ihr Nervenkostüm. „Bin ich zu Hause?!“ Es klang wie Frage und Feststellung zugleich.
Die Gesichtszüge des korpulenten Mannes entspannten sich sichtlich. „Ja. Ich hab' Sie in Ihr Haus getragen, weil Sie kaum noch bei Bewusstsein waren. Geht es Ihnen jetzt besser?“
Zwar waren die Symptome der Unterzuckerung abgeklungen, doch die Übelkeit und der Schmerz in ihrem Inneren wollten einfach nicht weichen. Wenigsten zeigten sie ein wenig Mitleid mit der gebeutelten Wissenschaftlerin und marterten sie im Moment nicht all zu heftig. Gerade noch an der Grenze, um Haltung zu bewahren. „Danke! Ich denke, ich komme jetzt wieder allein zurecht. Ich ruhe mich nur noch ein klein wenig aus. Sie haben mir sehr geholfen.“ Madeleine hoffte überzeugend genug geklungen zu haben.
Er nickte und erhob sich vom Sessel. Das Polster hinterließ eine tiefe Senke.
„Habe ich Ihnen ausreichend Trinkgeld gegeben?“
Der Mann schmunzelte, ohne auf den Betrag näher einzugehen. „Ja, allerdings.“
„Gut. Gut. Vielen Dank für Ihre Mühe!“ Sie zwang sich dazu, ihrem Helfer ein dankbares Lächeln zu schenken. „Sie verzeihen, wenn ich Sie nicht zur Tür begleite.“
„Kein Problem! Gute Besserung!“ wünschte der Taxifahrer leicht verlegen und verschwand dann eiligen Schrittes, kaum dass ihm die letzte Silbe über die Lippen kam, aus dem exklusiven Einfamilienhaus seines weiblichen Fahrgastes, ehe noch unvorhergesehene Dinge auf ihn zukamen, die nichts mit Personenbeförderung zu tun hatten. Er fuhr allerdings nur ein paar Straßen weiter, stieg dort wieder aus und zündete sich mit zitternden Händen eine Zigarette an.
Madeleine hörte die Haustür geräuschvoll ins Schloss fallen. Die schmutzigen Schuhspuren ignorierte sie fürs Erste. Mehr als erleichtert seufzte sie auf und flüsterte dann leise: „Endlich allein. Endlich!“ Diese Ruhe! Die Geborgenheit der eigenen vier Wände. Himmlisch! Was für ein unschätzbarer Genuss. Ich könnte ewig hier liegen und nichts tun. Sie runzelte die Stirn. Womit habe ich all das nur verdient? Womit? Darauf wird mir wohl niemand eine Antwort geben können. Sie seufzte lauter. Ich muss so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen und meine Mission beenden. Meine Mühen sollen nicht umsonst gewesen sein. Für einen allzu köstlichen Moment blieb sie noch auf der viel zu gemütlichen Couch liegen, bevor sie sich mühsam und abgeschlagen erhob. Mit der Zeit würden ihre Kräfte zurückkehren. Mit der derzeit zu ertragenden Symptomatik konnte sie aus-kommen. Sie wusste genau, dass sie kein Analgetikum und Antiemetika im Haus aufbewahrte. Hatte sie auch nie gebraucht. In der Not konnte sie immer noch den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst oder, wenn es lebensbedrohlich für sie werden würde, gar die 112 anrufen. Zwei Schritte Richtung Badezimmer und ein erneuter brennender Schmerz durchzuckte ihren Körper. Die Marter begann von Neuem. Leise aufschreiend und sich aus purer Verzweiflung auf die Unterlippe beißend, krümmte sich die junge Frau tief. Tränen traten ihr blitzartig in die Augen und ergossen sich kurz darauf über ihre Wangen. Übelkeit. Schmerz. Unerträglicher Juckreiz. Als würden kleine Tiere wie am Fließband durch ihren Körper wandern. Ein eiskalter Schauer verdrängte diesen widerlichen Gedanken. Ihre Muskulatur spannte sich schmerzhaft an. Mühsam und stöhnend schleppte sie sich ins Bad. Sie zitterte vor Angst und Unsicherheit. Da half ihr auch nicht der Wintermantel, den sie immer noch trug. Das Licht schaltete sich automatisch über Sensoren ein. Ein lindgrünes Zugrollo mit Blattmotiv versperrte die Aussicht nach draußen. Der Heizkörper sendete keinerlei Wärme aus, da die Besitzerin von niemandem erwartet worden war. Auch die Fußbodenheizung blieb kalt. Mit einem Dreh war das kleine Problem behoben. Das starke Rauschen in der Sprossenheizung bekundete ihr, dass es bald angenehm warm im Bad sein würde. Madeleine Kurz entledigte sich all ihrer Bekleidung, die sie auf einem aus hellem Rattan meisterlich geflochtenen Hocker eher gleichgültig ablegte. Die Winterstiefel schleuderte sie lustlos daneben, was gar nicht ihrer Art entsprach. Nur Slip und BH behielt sie am Leib. Dann wagte sie, was ihr auch jetzt schon genug Furcht und Schrecken einflößte. Der Blick in den Spiegel. Sehr langsam brachte sie ihren Körper vor ihm in Position, bis ihr der volle Anblick nicht mehr erspart blieb. Und der bescherte ihr einen immensen Schock. Ihr wurde heiß und kalt zugleich. Jeder Muskel, jede Faser ihres Körpers zitterte sichtbar und die Knie wollten ihr den Dienst versagen. Doch setzen wollte sie sich nicht. Sie musste sehen, was mit ihr geschah. Ihre Gesichtsfarbe verlor sich in einem Weißgrau. Die Haut, die sich über Brust und Bauch spannte und die wie Feuer brannte, zeigte vermehrt rot und heiß glühende, nässende Flecken auf einem Grund extrem trockener, spannender Haut. Wie kleine Vulkane, die kurz vor dem Ausbruch standen. Und da! Da …! Äh! Sie musste mehrmals hinschauen und auch mehrmals den Kopf schütteln, bevor sie kreischend und nach Luft ringend einige Schritte zurückging. Denn was ihr Spiegelbild zeigte, glich einer Szene aus einem Horrorfilm. „Nein! Nein!!“ Sie würgte den Kloß hinunter, der sich drohend in ihrem Hals festzusetzen gedachte. Ihre Atmung beschleunigte sich, dass sie fast hyperventilierte. Etwas krabbelte dicht unter ihrer Haut entlang. Ihre vor wahnsinniger Angst glühenden Augen, aus denen heiße Tränen platzten, saugten sich unwillkürlich an der bizarren Bewegung fest. Aaah! Ein Schauer von frostklirrender Polarkälte jagte über ihren Rücken und hinterließ ein unangenehmes, zwiebelndes Echo. Nein! Nein! Sie träumte! Ganz sicher träumte sie nur. Einen äußerst realistischen Traum. Jeden Moment würde sie erwachen … Ganz bestimmt. Sekundenlang verharrte sie in einer Starre. Oder doch nicht? … Madeleines Puls raste mit geschätzten 200 Sachen durch ihren Körper und ließ Ihr Herz kräftiger pumpen als je zuvor, dass es schmerzte. Das Adrenalin, welches ihre Nieren dabei produzierten, überschwemmte gewissenlos ihren gestressten Körper. Statt Blut floss Adrenalin in ihren Adern. „Das … das darf nicht wahr sein!“ Angstschweiß lief ihr am Gesicht hinab. Ihr Teint sah totenbleich aus, der Lidschatten von Tränen verwischt und die dunklen Ringe unter ihren Augen traten nun deutlich hervor. Sie sah aus wie ein Zombie mit Perücke. Eine lebende Tote.
„Das ist es aber!“
Madeleine fuhr erschrocken herum. Riss dabei instinktiv einen seidenen Morgenmantel von zartem Rosa von einem Haken neben der sich erwärmenden Sprossenheizung, um ihre Blöße zu bedecken.
Ein älterer und äußerst attraktiver Herr mit silbergrauem Haar, eingehüllt in eine Aura aus männlicher Anziehungskraft und einem herb riechenden Eau de toilette, stand lässig und die gesamte Türbreite ausfüllend am Eingang zu ihrem Bad und blickte ihr aus seinen strahlend himmelblauen Augen triumphierend entgegen. Er trug einen langen, schwarzen Mantel, elegante Schuhe, der kalten Jahreszeit entsprechend, und schwarze Lederhandschuhe von allerfeinster Qualität.
„Sie?“ fragte die Hausbesitzerin langgezogen voller Unverständnis und ihre Augen weiteten sich auf die Größe von Tennisbällen, ihr Unterkiefer sank herab. Sie stand stocksteif, mit beiden Beinen fest auf dem gefliesten Boden. „Was … was wollen Sie hier? Ich … ich dachte … Sie … sie sagten, sie fliegen nach München. Wie kommen Sie in mein Haus?“ Ihre Stimme überschlug sich.
Bernhardt Jackson grinste höhnisch und zeigte dabei seine ganze Abscheu. „Wie leicht Sie doch zu beeinflussen sind, Frau Doktor.“ Er genoss sichtbar seinen unerwartet nächtlichen Auftritt.
„Was wollen Sie? Was hat Ihr Erscheinen zu bedeuten?“ Doktor Kurz gab sich nach außen selbstsicher. In ihrem Inneren bebte es mit einer Stärke von 7,5 auf der Richterskala.
„Lassen Sie Ihre Intelligenz arbeiten!“
„Brauchen Sie Geld? Wollen Sie mich vergewaltigen?“ Spontan waren dies die ersten Gedanken, die ihr durch den Kopf fuhren.
Ein finsteres, amüsiertes Lächeln umspielte seine Mundwinkel. „Oh, nichts dergleichen, meine liebe Madeleine“, säuselte er trügerisch.“ Angewidert fuhr er mit seinen Augen über ihre kümmerliche Gestalt. „Seien Sie nicht so stupide. Schließlich haben Sie studiert und sind eine angesehene Wissenschaftlerin dieses Planeten.“
„Ich rufe die Polizei, wenn Sie nicht umgehend mein Haus verlassen!“ erhob sie ihre Stimme, obwohl sie sich ziemlich sicher war, ihr Smartphone im Handgepäck gelassen zu haben. Verdammt, meine Tasche! Die Disc! Ihr Gesichtsausdruck sollte ihre ganze Wut und Entschlusskraft widerspiegeln, doch mit der verlaufenen Schminke sah es einfach nur … lächerlich aus.
„Dazu sind Sie wohl kaum in der Lage“, stellte er zu ihrem weiteren Unwillen fest. „Also, wozu bin ich Ihnen wohl gefolgt, Frau Doktor Kurz?“ Er klang beinah wie der Moderator in einer Quizshow.
Die junge Wissenschaftlerin, in ständiger Angst und Sorge, dass sie jemand verfolgen und töten könnte, weil sie … Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ihr stockte der Atem. Die unverblümte Erkenntnis traf sie wie ein messerscharfes Fallbeil. Er hat mich kaltherzig hinters Licht geführt. Mich die ganze Zeit angelogen! Lügner! Madeleines Knie wurden wieder weich, ihre Gesichtszüge schmolzen. Sie trat instinktiv einen Schritt zurück.
Ihr Gegenüber folgte ihr wie selbstverständlich. „Nanana, wie kommen Sie nur darauf, ich wolle Sie umbringen. Das ist nun gar nicht meine Absicht. Für Ihr Ableben werden“, er hob vielsagend die Augenbrauen „andere sorgen, meine Liebe. Ich will nur die Daten-Disc.“
„Was?“ Im ersten Moment stutzte sie. „Woher wissen Sie …? Wie können Sie wissen …“ Madeleine schüttelte ahnungslos ihren Kopf, bis sie einige Sekunden darauf die pure Ernüchterung überschwemmte und ohne Gegenwehr mit sich riss. In ihr zog sich alles zusammen und Hass flammte auf wie eine Fackel. „Sie arbeiten für ihn!“
„Das haben Sie auch getan“, entgegnete ihr Gesprächspartner ruhig. „Und nun werde ich mir die Daten-Disc einfach aus dem Versteck ihres präparierten Handspiegels nehmen und Sie ihrem verdienten Schicksal überlassen.“
Ihre Kinnlade und Schultern sanken verdutzt nach unten. Madeleine war so perplex, dass sie für Momente nicht reagieren konnte. Erst als Bernhardt, der sich hoch erhobenen Hauptes umdrehte – sich in Sicherheit wiegend, dass von der Kurz keine Gefahr ausging – um ins Wohnzimmer zu marschieren, wo ihre Aktentasche mit ihrem wertvollen Inhalt lag, kam sie wieder zu sich. Adrenalin schoss erneut durch ihren Körper und mobilisierte sie. Na warte, das werde ich dir heimzahlen. Hinterhältiger Schuft! Sie sammelte all ihre Kräfte, griff sich eine hölzerne Duschbürste mit langem Stil von einem der Wandhaken, die sie mit beiden Händen fest umklammerte, dass die Knöchel weiß hervortraten, und rannte auf nackten Sohlen hinter ihrem einen halben Kopf größeren Feind her. Kraftvoll drosch sie mit der Bürste auf ihn ein. Ein paar Mal erwischt sie ihn am Kopf, wo kurz darauf dünne Rinnsale von leuchtend rotem Blut sich mit dem silbergrauen Haar vermischten, doch alles, was Bernhardt tat, war sich umzudrehen, die nächsten Schläge geschickt mit Händen und Armen abzufangen und die wütende Frau mit einem überaus kräftigen Schub ins Bad zurückzuwerfen. Madeleine stolperte haltlos rückwärts mit weit aufgerissenen Augen, knallte mit dem Hinterkopf gegen das rechteckige Porzellanwaschbecken und fiel anschließend bewusstlos zu Boden. Die hellgrünen, hochflorigen Badteppiche milderten den Aufprall für einige Körperregionen glücklicherweise ein wenig ab. Aber half ihr das zu überleben?
„Schlampe!“ knurrte Jackson angewidert und tupfte sich mit einem der beliebigen Handtücher, die im Badezimmer verteilt lagen oder hingen das Blut von Kopf und Haar. Dabei fluchte er noch einige Male über das Miststück, dass ihn dermaßen verunstaltete. Wenigstens traf die Wissenschaftlerin nicht sein Gesicht oder brach ihm gar die Nase. Dann wäre er für immer gezeichnet gewesen. Und das bei seinem hohen Grad an Attraktivität und der immensen Anziehungskraft auf das weibliche Geschlecht. Die Wunde hörte für seinen Geschmack nicht schnell genug auf zu bluten, deshalb kramte er in den diversen, geschlossenen Badmöbeln nach einem Blutstiller-Stick, den er auch kurz darauf fand. Damit brachte er die Blutung schnell unter Kontrolle. Zum Schluss säuberte er penibel sein von silbergrauem Haar bekränztes Haupt von den Blutresten. Ein abschließender Blick in den Spiegel sagte ihm, dass er wieder unter die Leute treten konnte. Achtlos schleuderte er das benutzte, mit seinem Blut versehene Handtuch in die Mulde des Waschbeckens. Schicken Sie mir die Rechnung, Lady! Jackson warf einen letzten, verächtlichen Blick auf die immer noch bewusstlos auf dem Boden liegende Frau. Erste Hilfe zu leisten wäre das Allerletzte, was er hier tun würde. „Verräterin!“ zischte er herablassend und ging lockeren Schrittes hinüber ins geräumige Wohnzimmer. Zielsicher schritt er auf die braune Businessaktentasche zu, die noch immer auf der schneeweißen, unberührt wirkenden Couchlandschaft lag, öffnete diese, schüttete vorsichtig deren Inhalt aus und griff nach dem gesuchten Handspiegel, der sich darunter befand, öffnete ihn mit einer Klinge seines Taschenmessers, nahm die darin befindliche Daten-MiniDisc erfreut grinsend heraus und steckte diese in eine Disc-Hülle aus seiner Manteltasche. Anschließend verschwand er, überaus zufrieden grinsend, aus Madeleine Kurz' Haus auf Nimmerwiedersehen.
Madeleine kam erst Minuten nach Jacksons Verschwinden wieder zu sich. Blinzelnd starrte sie gegen die weiße Decke mit der dreistrahligen Lampe und wunderte sich, dass sie in ihrem Badezimmer am Boden lag. Sofort kamen jedoch die üblen Erinnerungen in ihr hoch, die sie etwas schwerfällig, aber wütend hochfahren ließ. Verdammter hinterhältiger, verlogener Schuft! Wie konnte ich nur so dumm sein? Ihr Kopf brummte und schmerzte. Sie fühlte vorsichtig nach der Stelle am Hinterkopf. Eine Beule hatte sich gebildet. Sie zog die Finger zurück. Es klebte kein Blut daran. Der Ausschlag auf ihrer Haut brannte dafür weiterhin wie ein alles verzehrendes Feuer und sie erinnerte sich, dass sie auch etwas unter ihrer Haut hatte krabbeln sehen. Der Gedanke daran ließ sie erneut heftig frösteln und überschattete für einen kleinen Moment jeglichen Schmerz. Wenn dies doch alles nur ein schlechter Traum wäre …? Sie blickte in den großen, erleuchteten Kristallspiegel, sah ihr von Erschöpfung, Schmerz und verwischten Make-up gekennzeichnetes Gesicht und … aaaah!! Ein langanhaltender Schmerz explodierte in ihrem Körper und schien sämtliche Fasern mit besonders qualvollem Genuss auf höchstem Niveau zerreißen zu wollen. Sie fiel auf die Knie, die Arme schützend vor dem Bauch, den Kopf auf dem Badteppich abgelegt, als könne sie die Qual so besser ertragen. Höllisch scharf und unglaublich heiß stachen Nadeln in ihr Fleisch und betäubten es. Immer und immer wieder. Nach einer endlosen Ewigkeit von Sekunden ebbte der bizarre, unmenschlich erscheinende Schmerz ab, dass er einigermaßen zu ertragen war. Erschöpft und schwer atmend zog sie sich wieder nach oben. Sie blickte erneut in den Spiegel und schluckte ungeheuer schwer. … krabbelnde Bewegungen unter ihrer Haut. Nein!! D-da! Zwischen ihren Brüsten und weiter abwärts Richtung Oberbauch! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie eklig!!! Händen und Füßen entfloh jegliche Wärme. Es … es war tatsächlich wahr! Oh nein! Oh Gott! Madeleine zitterte so heftig am ganzen Leib, als unterliege er nicht mehr ihrer Kontrolle. Ihr Wille, sich zu beruhigen, erwies sich als zu schwach. Für ein bis zwei Sekunden wurde ihr schwarz vor Augen und kleine gelbe Sternchen tanzten um sie herum. Dann klärte sich der Blick wieder. Das Bild blieb unverändert. Die Angst vor dem, was unvermeidlich auf sie zukam, sog ihr förmlich die Kraft aus dem Leib. Sie versuchte sich zu beruhigen, was sich unter den gegebenen Umständen als äußerst schwierig erwies. Die krabbelnden Bewegungen unter ihrer Haut fühlten sich wie Durchblutungsstörungen an. Minutenlang starrte sie wie geistesabwesend ihr Spiegelbild an, bis sie allmählich Ruhe in Körper und Geist brachte. Ihre wissenschaftliche Neugier überwog. Sie zählte hastig. Mindestens ein halbes Dutzend Bewegungen! Und das war sicherlich nur eine lächerliche Dunkelzahl. Die Wissenschaftlerin schüttelte sich vor Ekel und hielt sich die zitternden Hände vor den Mund, um den hysterischen Aufschrei zu unterdrücken, der sich zu bilden drohte. Weitere Tränen platzten prall aus ihren Augen.
Wenn das ihre Eltern wüssten. Sie würden sich im Grab – wo immer es sich auch befand – herumdrehen.
Und plötzlich wusste sie nur zu genau, wem sie diese Abartigkeit zu verdanken hatte. Dieser eine verwunschene Gedanke drängte sich mit einer Macht auf, der sie nichts entgegenbringen konnte. „Graham!“ zischte sie voll leidenschaftlicher Wut. Er kam als einziger in Frage. Nur er! Damals, vor etwa drei Jahren, als sie das überaus großzügige Angebot für einen Arbeitsplatz in der Forschung in den Vereinigten Staaten bekam, war sie unglaublich stolz und überglücklich, für einen bedeutenden Konzern wie Messerschmidt-Hancock Enterprises zukünftig arbeiten zu dürfen, die nicht scheuten Gelder auszugeben, um ihre Mitarbeiter mit den neuesten medizinischen Geräten auszurüsten, um in der Forschung erfolgreich zu sein. Ihre Eltern, wenn sie noch gelebt hätten, wären unglaublich stolz auf ihre Tochter gewesen. Doch bereits an ihrem ersten Arbeitstag wurde sie dermaßen tief enttäuscht. Radikal getäuscht. Ihr amerikanischer Arbeitgeber drohte ihr ohne Umschweife sie zu töten, wenn sie mit anderen, nicht an dem Projekt beteiligten Leuten, über das sprach, an was sie und ihre aus aller Welt eingesammelten Kollegen arbeiteten. Zuerst glaubte sie, der CEO würde scherzen. Bei der eingehenden Einweisung in ihren neuen Arbeitsplatz und ihrem zukünftigen Aufgabengebiet wurde ihr Irrtum schnell zunichte gemacht. Der Schock, den sie dabei erlitt, ging tief und fraß sich gleich einem widerlichen Schmarotzer durch Eingeweide und Gemüt. Doktor Madeleine Kurz war unfreiwillig Mitwirkende an einem Projekt, dass sich mit illegalen und höchst grausamen Experimenten an Menschen jeder Altersgruppe und beider Geschlechter beschäftigte. Für einen lebenden Ausstieg aus dem verhängnisvollen Arbeitsvertrag war es zu spät. Also fügte sie sich vorerst in ihr hartes Schicksal. Sie fühlte sich bei der Arbeit wie eine Marionette an Fäden. Wie ferngesteuert. Bis zu dem Tag, an dem sie sich beherzt schwor, die unmenschlichen Machen-schaften ihres skrupellosen Chefs und seiner gehorsamen Anhänger an die Öffentlichkeit zu bringen. Etliche Monate waren seit ihrem Schwur vergangen. Lieber Herrgott, was ist nur aus mir geworden? Ich war eine taffe, selbstbewusste Frau und obendrein erfolgreiche Wissenschaftlerin. Und jetzt? Sieh dich doch nur an! Dem Tod geweiht. Das hätte ich mir niemals träumen lassen. Das Leben … mein Leben schien so perfekt. So ausgefüllt. - Jack!! Ich will nicht sterben! Madeleine schloss die Augen, um die aufkommenden Tränen, die sich automatisch zu bilden drohten, unter Kontrolle zu halten. Was mit ihr geschah, bedeutete für sie nichts anderes als den sicheren Tod. Auf eine äußerst raffinierte und sehr grausame Art und Weise. Wie konnte es nur möglich gewesen sein, sich mit dem lebensgefährlichen Experiment zu infizieren? Sie durchforstete ihre Erinnerungen nach Erklärungen, fand jedoch keine einzige plausible. Sämtliche Abläufe während der Arbeitszeit erfolgten strikt nach den vorgegebenen Standards. Geschah die Infizierung ungesehen und unbemerkt im Labor, vielleicht während sie des nachts im Bett ihres Penthouses schlief oder möglicherweise bei den halbjährlichen Gesundheitschecks für das Personal der geheimen Forschungslaboratorien? Für sie schien jede Variante im Bereich des Möglichen zu liegen. Wichtig wäre auch zu wissen, wann die Infizierung geschah. Lag diese bereits länger zurück – Wochen oder gar Monate – eine schlafende Gefahr im Inneren ihres Körpers, die durch etwas bestimmtes ausgelöst wurde, als sie sich auf der Flucht nach Deutschland befand, um sie zu töten, ehe sie die geheimen Informationen an Dritte weitergeben konnte, oder wurde ihr Schicksal kurzfristig besiegelt – vielleicht nur einige Tage oder Stunden, bevor sie New York verließ? Auch hier gaben ihr die möglichen Übertragungswege Rätsel auf, die sie nicht beantworten konnte. Ergebnislos suchte sie nach Antworten. Sie – als Biologin – war es gewohnt, der Sache bis zum Grundbaustein des Lebens auf den Grund zu gehen und auch Resultate zu präsentieren. Diese außergewöhnliche Situation … Sie musste passen … missmutig seufzte sie auf. Eines stand jedoch unmissverständlich fest: Graham wusste, was sie getan hatte und ließ sie jetzt dafür bitter büßen! Überdies gelang es ihm herauszufinden, wo sie ihren tatsächlichen Wohnort hatte. Sie scholt sich blauäugig, eine Närrin, als sich erneut eine Unterzuckerung anmeldete. Angewidert von sich selbst, mit Schmerzen, die auf der Haut brannten wie das Höllenfeuer höchstpersönlich, und immer noch zitternd wie Espenlaub, band sie ihren Morgenmantel mit dem herabhängenden Gürtel zusammen und schleppte sich keuchend in die Küche, wobei sie theoretisierte, dass ihre ständige Unterzuckerung garantiert etwas mit ihrer schlechten körperliche Verfassung und den Schmarotzern? in ihrem Inneren zu tun hatte. Was würde also geschehen, wenn ihr Blutzuckerwert viel schneller sank, als sie ihn mit Kohlenhydraten hochschrauben konnte? Insulin würde sie wohl keines mehr brauchen. Sie würde unweigerlich sterben! Eine unsichtbare Nadel stach erbarmungslos mitten durch ihr Herz und peinigte es gewissenlos. Von welcher Seite sie auch die Situation betrachtete: Am Ende stand immer ihr Tod. Nein! Nein! Ich will nicht sterben! Ich … ich will leben! Leben! O Jack! Jack! Was soll ich nur tun? Wer kann mir helfen? In der Küche riss sie einen ihrer Hängeschränke auf und griff zitternd nach einer mit dem Wort Traubenzucker beschrifteten Dose mit orangefarbenem Deckel. Daneben lagen etliche, leckere Schokoriegel verschiedener Marken, die sie sich gerne mal schmecken ließ, wenn ihr danach war. Jetzt sah sie diese ausschließlich als ungewollte Lebensretter an. Aus einem anderen Schrank nahm sie mit bebender Hand ein Glas, füllte es halb mit lauwarmen Leitungswasser und gab einen großen Schwung Traubenzuckerpulver hinzu. Nachdem sie mit einem langstieligen Löffel kräftig klappernd umgerührt hatte, leerte sie das viel zu süße Getränk angewidert mit einem Mal. Anschließend griff sie nach den Schokoriegeln und verschlang einem nach dem anderen, bis es ihr davon so übel wurde, dass sie eine Esspause einlegen musste. Die Blutzuckermessung sowie ihre Insulinspritzen vernachlässigte sie absichtlich. Diesen Aktionen gab sie keinen Sinn mehr, da ihr Blutzuckerspiegel sowieso in kurzer Zeit wieder gefährlich absinken würde. Höchstwahrscheinlich basierend auf den abartigen Vorgängen in ihrem Körper. Also, was soll's! dachte sie resigniert. Erschöpft, von Übelkeit und aufkommenden Sodbrennen geplagt, setzte sich Madeleine an den ovalen, gläsernen Küchentisch. Die Dinger in ihr krabbelten unermüdlich weiter. Sie musste es ertragen. Es sei denn … es sei denn, sie nahm sich ein Messer und schnitt sich die verdammten Viecher eigenhändig raus. Nein. Die Ernüchterung folgte postwendend. Sie seufzte erneut. Dazu besaß sie nicht genug Mut. Nicht genug Mut! Außerdem war sie doch nicht psychisch krank. Scheiße! Scheiße! Wahrscheinlich … Nein, sie würde verbluten. Oder … Ach, egal … Also, wie lange würde sie wohl ihren Tod hinauszögern können? Eine halbe Stunde? Eine Stunde? Länger? Alles schien ohne Sinn. Und immer noch zitterte sie. Sie ließ es gewähren. Bot die ununterbrochene Esserei von zuckerhaltigen Lebens-mitteln überhaupt eine Lösung? Eine Chance zu überleben? Sie würde all ihre Vorräte aufessen müssen, um am Leben zu bleiben. Und was dann? Ihre Überlebenschance sank wieder rapide nach unten. Wie spät war es überhaupt? Sie schaute auf die leise tickende Küchenuhr. Schon 4.35 Uhr. Wie die Zeit verging. Unfassbar! Und sie saß hier immer noch untätig herum! Wie konnte sie ihr Verhalten nur verantworten? Sollte sie sich noch heute einem Arzt anvertrauen? Sie dachte an die befreundete Medizinerin. Oder lieber gleich die 112 informieren? Medizinisches Personal konnte ihr in hohen Dosen und obendrein intravenös Glucose verabreichen, vermutlich würde sie in ein künstliches Koma versetzt werden, bis – ja, bis wann denn überhaupt? Bis sie doch tot war aufgrund von absolutem Kohlenhydratemangel und der zerstörerischen Lebensweise der in ihr befindlichen Biester, die ihre Organe sicher durch-löcherten wie ein Schweizer Käse, oder irgendjemand irgendwann die pathologische Veränderung ihres gemarterten Körpers begriff und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen konnte, wenn es denn welche gab? Madeleine schüttelte automatisch den Kopf. Ooh nein! Graham würde alle unliebsamen Mitwisser töten lassen. Das war so sicher wie das Amen in der Kirche. Sie durfte auf gar keinen Fall zulassen, dass weiter Unschuldige starben. Doch wenn sie jetzt das Zeitliche segnete, wer sorgte dann dafür, dass die Öffentlichkeit von Graham und seinem widerwärtigen Projekt erfuhr? Unter Schmerzen und erschöpft schleppte sie sich in ihr Wohnzimmer. Auf der Couch lagen noch immer die Dinge aus ihrer Tasche verstreut. Ohne Bedeutung. Sie griff sich ihr Smartphone und schleppte sich zurück in die Küche. Die Stuhlbeine schabten über die Fliesen, als sie sich auf die Sitzfläche fallen ließ. Sie seufzte und wählte eine Nummer aus dem Telefonbuch. Es klingelte endlos. Niemand hob am anderen Ende der Leitung ab. Verdammt! Sie versuchte es mit einer anderen Nummer, doch da ging nur der Anrufbeantworter ran. Kein Glück. Aus dem Kopf heraus wählte sie die nächste Nummer. Alle Leitungen waren belegt. Wartezeit betrug etwa zwanzig Minuten. Das konnte doch nicht wahr sein! Verärgert knallte sie das Telefon auf den Glastisch und sinnierte noch einmal über ihre Lage. Nein, sie durfte keine weiteren unschuldigen Menschen in die Sache involvieren, auch wenn sie selbst große Angst vor Sterben hatte. Madeleine lächelte innerlich über ihr eigenes Genie und Geschick. Zwar hatte ihr dieser schleimige, verräterische Bernhardt Jackson die Daten-MiniDisc mit den wertvollen Informationen abgenommen, aber einen Trumpf verbarg sie noch und sie hoffte, dass die richtigen Leute diese Infos fanden, korrekt entschlüsselten und diese auf ganzer Linie gegen Graham einsetzten, dass dieser doch noch seiner hoffentlich gerechten Strafe zugeführt werden würde. Der nächste Moment brachte ihr wieder Depression, denn alles schien ohne Sinn. Madeleine Kurz fühlte sich am Ende. Am Ende ihrer Weisheit. Am Ende ihrer Kräfte. Am Rande des Wahnsinns. Körper, Geist und Seele schrien förmlich nach Hoffnungslosigkeit, Schmerz, Angst und auch nach Zorn. Ein irres Wechselbad der Gefühle, deren sie gar nicht erst versuchte, Herrin zu werden. Alles war umsonst gewesen. Nichts hatte sie erreicht. Niemandem war geholfen. Und ihr eigenes berufliches wie privates Leben – zerstört! Ihre Haut brannte um ein Vielfaches stärker, dass ihr deswegen ein kalter Schauer nach dem anderen über den Rücken jagte. Manchmal war auch das ständige Kribbeln unter ihrer Haut und in ihrem Körper über die Maße unerträglich, dass sie sich am liebsten schreiend und weinend hätte tot kratzen können. Dann kehrte ungewöhnlicherweise für einen Moment Ruhe in ihren geschundenen Körper ein, als hätten die krabbelnden Viecher unter ihrer Haut ihre Arbeit eingestellt, um zu schlafen. Was für eine unglaubliche Wohltat! Madeleines Kopf sank erleichtert auf die Tischplatte. Sie genoss den seltenen Augenblick. Die verdrängte Erschöpfung machte sich sofort breit. Sie schloss die müden Augen und versank augenblicklich in einem traumlosen Schlaf. Kein Wunder bei den Strapazen der letzten Stunden, unter denen sie extrem gelitten hatte.
Als Doktor Kurz die Augen wieder aufschlug, drang bereits die kühle, winterliche Helligkeit des Tages in ihre Küche. Zuerst blendend, dann angenehmer und auch leicht wärmend. Alles schien ruhig. Normal. Nur ein verrückter Traum. Sie blickte zur Uhr. „Viertel acht?“, ächzte sie. „Das kann nicht sein? Ich muss … - Argh, aah, argh!“ Madeleine durchfuhr ein unsäglicher Schmerz. Wie auf ein Kommando begann die Misshandlung ihres Körpers erneut. Ihr zuvor lässig zugebundener Morgenmantel stand offen und präsentierte eine ungeheuerliche Neuigkeit, die so entsetzlich abstoßend war, dass sie wie magnetisiert hinstarrte und sogar vergaß zu atmen. Ihre Nerven schienen allesamt wie elektrisiert. Mit weit aufgerissenen, hervorquellenden Augen gewahr sie, wie sich etwas durch ihre Bauchdecke zu fressen wagte. An mehreren Stellen gleichzeitig! Der Schrei blieb ihr sekundenlang, die wie eine Ewigkeit wirkten, im Halse stecken. Blut rann in schmalen Rinnsalen aus kleinen, sich leicht nach außen wölbenden und stark geröteten Öffnungen ihrer ehemals makellosen Bauchdecke, aus denen sich kleine, widerwärtige Ameisen – Ameisen! – blutverschmiert und glänzend hervor quetschten. Madeleine zitterte aufs heftigste am ganzen Leib, begann hysterisch zu schluchzen und meinte, in einem schrecklichen Alptraum gefangen zu sein, aus dem sie jede Sekunde erwachen würde. Doch sie war bereits wach. Der angebliche Alptraum entpuppte sich wieder einmal als harte Realität und sie wusste, in Anbetracht dieser horrorhaften Situation nicht, wie sie dieser noch entkommen könnte. Ein Gedankenblitz schoss eiskalt durch ihr Gehirn, denn jäh fiel ihr wieder die befreundete Ärztin ein, mit der sie in ihrer Studienzeit und auch danach häufig korrespondierte. Die Chirurgin! Sie musste diese umgehend anrufen und über ihren Zustand informieren. Ihre studierte Freundin stellte vermutlich die wirklich allerletzte Hoffnung für die Wissenschaftlerin dar. Bitte, lass dies wenigstens kein Traum sein! Sie glaubte nicht an Gott, richtete dennoch und unbewusst ihren Hilferuf an ihn. Wenn es nur noch nicht zu spät dafür war. Schnell! Handy! Wo ist mein Handy! Das Handy! Ihre innere Stimme quieckte vor Verzweiflung. Das Gesuchte lag auf dem Küchenboden. Sie hatte es wohl während ihres Schlafes mit der Hand zu Fall gebracht. Sie ergriff es und jagte in das Wohnzimmer. Erdrückt von Schmerz und Angst und dem schwindenden, hauchdünnen, seidenen Faden der Hoffnung, mit mehr oder weniger klaren Gedanken, suchte sie gleich einer hungrigen Wildkatze eine ganz bestimmte Visitenkarte, was sie beides auch nach einer Weile zwischen den zahlreichen, auf der Couch verteilten Utensilien ihrer Businessaktentasche, die Bernhardt Jackson zuvor auf ihrer Couch ausgeschüttet hatte, fand. Zwischendurch stopfte sie sich wie besessen immer wieder Traubenzucker in den Mund, denn sie spürte zu ihrem unvorstellbaren Unglück, dass ihr Blutzucker immer wieder auf unnatürliche Weise rapide absank. Und zwar schneller, als je zuvor. Bald schon tauchten immer mehr Ameisen auf ihrem Körper auf, die ihren Organismus wie einen Bau benutzten. Die ehemals gestandene Frau und weltweit anerkannte Biologiewissenschaftlerin Doktor Madeleine Kurz jammerte, wimmerte und weinte wie ein Kleinkind. Ihr gegenwärtiger Zustand war eine noch nie da gewesene Katastrophe von Ereignissen, die sie offensichtlich gar nicht mehr beeinflussen konnte. Sie ekelte sich vor sich selbst, wenn sie an ihrem entstellten Leib hinabschaute und vergeblich versuchte, die kleinen Viecher mit den Fingern weg zu schnipsen. Doch sie konnte kaum sehen. Tränen überschwemmten ihre Augen und liefen wie Ströme an ihren Wangen hinab. Sie vergaß völlig über ihr Telefon Hilfe zu alarmieren. Nur drei kleine Zahlen hätten ausgereicht. In ihrer ausweglosen Situation begann sie abermals den lieben Herrgott inbrünstig anzuflehen, ihr verdammt nochmal zu helfen, denn sie wusste in ihrer grenzenlosen Angst weder ein noch aus und bereits in der nächsten Sekunde … brach sie mit weit aufgerissenen Augen und entsetzten Gesichtsausdruck mitten in der Küche zusammen. Das Smartphone und die Visitenkarte fielen ihr aus den Händen. Das Jammern, Wimmern und Weinen verebbten mit einem Schlag. Ihr Herz entspannte sich von den Anspannungen und Strapazen der vorangegangenen Stunden, Minuten, Sekunden. Eine letzte Woge Blut rauschte kraftlos und schnell langsamer werdend durch die Adern, bis auch sie zum Stillstand kam. Eine allerletzte Träne stahl sich aus Madeleines offenstehendem, linken Auge. Träge rann sie an der Schläfe hinab, klammerte sich noch für einen winzigen Moment an der Haut der Toten fest und fiel anschließend lautlos und unbeachtet zu Boden, wo sie mühelos zerplatzte.
Doch all dies interessierte die fleißig arbeitenden Ameisen nicht. Sie hatten ein vorgegebenes, in ihren Genen einprogrammiertes Ziel vor Augen – die größtmögliche Ausbeutung ihres Wirtskörpers!