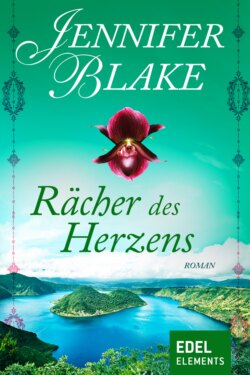Читать книгу Rächer des Herzens - Jennifer Blake - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDRITTES KAPITEL
Kurz vor fünf Uhr klopfte Olivier leise an Rios Tür. Rio war bereits wach. Er stand am offenen Fenster und sah zu, wie sich der Himmel über der weiten Biegung des Mississippi rosarot färbte. Rio hatte seine Kleidung mit Bedacht gewählt. Die Hosen aus dehnbarer Wolle machten jede Bewegung mit. Dazu trug er ein frisches Leinenhemd mit Manschettenknöpfen aus Onyx, eine weiße Seidenkrawatte, deren loser Knoten sich mit einem einzigen kurzen Ruck öffnen ließ, eine Weste mit grauen Streifen und einen schwarzen Gehrock. Obwohl er die derzeitige Mode, sich Unmengen von Pomade ins Haar zu schmieren, abscheulich fand, hatte er doch ein wenig davon benutzt, damit ihm die morgendliche Brise keine Strähnen in die Augen wehte. Sein Hut lag neben dem Futteral, in dem der Degen ruhte, den er bei solchen Anlässen zu benutzen pflegte. Zwei weitere Waffen in verschiedenen Größen hatte er zudem für alle Fälle eingepackt.
»Alà vous café, Monsieur Rio.«
Rio nahm die Tasse von dem Tablett, das Olivier ihm hinhielt, und trank einen Schluck, bevor er einen Dank murmelte.
»Ein schöner Morgen für ein Duell.«
Rio zuckte die Achseln. Das Wetter war tatsächlich recht gut, nur ein Hauch von Nebel hing in der Luft.
»Sie hätten mit der Krawatte warten sollen«, sagte Olivier mit einem Blick auf die drei zerknüllten Seidenbänder, die auf dem Bett lagen. »Ich hätte Ihnen helfen können.«
»Ich bin früh aufgewacht.«
Olivier nickte, als habe er sich das gedacht.
»Ich sah keinen Grund, uns beide um den Schlaf zu bringen.«
»Machen Sie sich Sorgen?«
Rio warf Olivier einen finsteren Blick zu. »Dieses Treffen dürfte im Grunde gar nicht stattfinden.«
»Es wird nicht lange dauern.«
»Richtig.« Der Fechtmeister leerte die kleine Tasse mit dem heißen, starken Gebräu und stellte sie auf das Tablett zurück.
»Gestern Abend, der Besuch von Mademoiselle Vallier …«
»Bitte!«, sagte Rio in scharfem Ton.
Olivier schlug die Augen nieder und verstummte.
Rio hasste diese untertänige Attitüde. Er nahm an, Olivier wollte ihm damit ein schlechtes Gewissen machen und ihn somit zu einer Erklärung nötigen, die er eigentlich nicht zu geben gedachte. »Vor einem Duell an Frauen zu denken ist genauso unangebracht, wie die Nacht zuvor mit irgendeiner Kokotte zu verbringen.«
»Ganz recht«, murmelte Olivier.
»Nicht dass Mademoiselle Valliers Einmischung von Bedeutung wäre. Aber ich möchte lieber nicht an ihren Besuch erinnert werden.«
»Sie hatten bestimmt nie vor, ihren Bruder zu töten.«
»Ich bin kein Mörder«, bestätigte Rio knapp.
»Nein. Aber ich frage mich, warum Sie das der Dame nicht einfach gesagt haben. Damit wäre die Sache nämlich erledigt gewesen.«
»Ich will, dass sie glaubt, in meiner Schuld zu stehen.«
»Als wenn das von Bedeutung wäre.«
»Sie hält mich für einen Ehrenmann«, sagte Rio trocken.
»Und? Hat sie Recht?«
Ein Klopfen an der Eingangstür im Erdgeschoss ersparte Rio eine Antwort. Das mussten Caid Roe O’Neill und Gilbert Rosière sein, selbst Fechtmeister und Rios Freunde, die heute als seine Sekundanten fungieren sollten. Sie kamen pünktlich. Rio nahm es als gutes Omen.
Caid, der Ire, war sein erster Sekundant. Er lebte erst seit kurzem in der Stadt und hatte die Kutsche gemietet. Der Wagen wartete in der Rue Saint-Pierre auf die Männer. Gilbert nahm den Koffer mit den Waffen an sich. Gemeinsam gingen die drei Fechtmeister durch die Gasse zu der Seitenstraße, wo der Wagen stand. Das Winterwetter zeigte sich außerordentlich mild, deshalb hatte der Kutscher das Verdeck geöffnet. Sie fuhren nur ein kurzes Stück bis zum Haus von Dr. Kiefer, der für das Treffen engagiert worden war. Der Arzt aus Wien galt als fähiger Mann und hatte viel Erfahrung mit Duellen. Mit seiner schwarzen Tasche unter dem Arm trat er, kaum dass die Kutsche angehalten hatte, aus der Tür. Man verbeugte sich und tauschte ein paar Höflichkeitsfloskeln aus, dann ging die Fahrt weiter.
Die Wagenräder holperten über das unebene Pflaster der Rue Saint-Anne und durch den Schmutz der schlammigen Straße am Congo Square. Erst nachdem sie das Vieux Carré, die Altstadt, verlassen hatten, ging es ein wenig schneller voran. Man nannte dieses Viertel auch Old Square. Französische Ingenieure hatten das gitterförmige Straßennetz vor über hundert Jahren angelegt und es anschließend mit einer schützenden Mauer umgeben. Aber die Stadt war längst weiter gewachsen. Am Rande des Viertels mit dem Namen Faubourg Marigny standen bereits die skelettartigen Gerüste zahlloser weiterer Gebäude, die ihrer Fertigstellung harrten.
Sie fuhren Richtung Bayou St. Jean und erreichten schließlich die ersten Ausläufer der Allard Plantage. Rio starrte auf das wilde Gewirr aus jungen Palmen, lilafarbenen Astern und hohen Gräsern, das in den Gräben wucherte und sich in der sanften Morgenbrise wiegte. Hinter all diesem Unkraut erhob sich das Zuckerrohr wie eine grüne Wand. Bald würde man es ernten, es mit scharfen Messern schneiden, wenn es am kräftigsten und am gehaltvollsten war. Rio wandte sich ab. Seine Miene war finster.
Nach einer weiteren Meile kam ein Eichenwäldchen in Sicht – der bevorzugte Ort, um Fragen der Ehre zu klären. Wie blanke Spiegel schimmerten die Blätter der Bäume im Morgenlicht. Das Moos, das in langen Strängen von den knorrigen Ästen hing, glich silbernen Spitzenbändern. Unter den Schatten spendenden Bäumen war das Gras dicht und grün. Am Rand des Hains standen zwei große Eichen, die man die Zwillingsschwestern nannte. Dies war der perfekte Platz für ein Duell. Er bot Schutz vor den schrägen Strahlen der Morgensonne, welche die Kontrahenten blenden konnten, und einen nahezu ebenen Boden. Die Kutsche hielt in der Nähe der Bäume, und die Männer stiegen aus.
Der junge Vallier war nirgends zu sehen. Gilbert blickte Rio mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Offenbar werden wir allein frühstücken müssen, mon ami, und kein Aderlass wird uns zuvor den Appetit verderben.«
»Immer mit der Ruhe, Titi«, sagte Caid lächelnd. Er benutzte den Spitznamen, den die französischen Kreolen mit ihrer Vorliebe für die Verdoppelung von Silben dem Fechtmeister angehängt hatten – sehr zu dessen Leidwesen. »Wir sind ein wenig zu früh hier, weil wir unseren Freund diesmal nicht erst aus dem Bett werfen mussten.«
»Du hast Recht. Er macht einen geradezu erschreckend wachen Eindruck, findest du nicht?«
Rio warf seinen Kumpanen einen zynischen Blick zu. Er wusste, dass sie sich an seiner Stelle ebenso gut vorbereitet hätten. Beide waren in jener glänzenden Verfassung, die ihre Profession von ihnen verlangte. Gilbert, von der Abstammung her eigentlich Italiener, sah aus wie ein Franzose. Das lag nicht zuletzt an der französischen Kleidung und den französischen Schuhen, die er mit Vorliebe trug. Auch frisieren ließ er sich von einem Franzosen. Mit seinem umgänglichen Wesen und dem gelegentlich ein wenig überschäumenden Temperament gehörte er zu den wenigen Fechtmeistern, die verheiratet waren. Seine Familie wohnte über dem Studio.
Caid war größer und muskulöser als Gilbert. Seine Figur ähnelte der von Rio. Die keltische Herkunft sah man ihm nicht an. Er stammte zwar von der grünen Insel, gehörte aber zu den dunklen Iren, deren weibliche Vorfahren wohl vor langer Zeit am Strand den spanischen Invasoren in die Hände gefallen waren. Caid hatte lockiges, dunkles Haar, und das Dunkelblau seiner Augen erinnerte an die tiefen Wasser der Nordsee. Im Beisein von anderen gab er sich abwechselnd charmant und ungehobelt. Rios Freunde führten genau wie er die Klinge mit großer Kunstfertigkeit und waren den meisten anderen Maîtres d’Armes der Stadt überlegen. Wenn die drei Männer einmal gegeneinander antraten, endeten die Kämpfe meist unentschieden.
Es dauerte nicht lange, bis sie einen Wagen herannahen hörten. Eine Mietdroschke donnerte um die Kurve, an den Strängen ein schäumendes Pferd. Hinter den Rädern stieg eine gewaltige Staubwolke in den Morgenhimmel. Der Kutscher brachte den Wagen zum Stehen, Vallier und seine Leute sprangen heraus, und die beiden Gruppen begrüßten einander. Dann trat Denys Vallier vor. »Es tut mir Leid, dass Sie warten mussten, Messieurs. Die Mietdroschke kam zu spät.«
Sich dem Charme dieses höflichen und offenen jungen Mannes zu entziehen war auch für Rio ein Ding der Unmöglichkeit. Denys sah seiner Schwester sehr ähnlich, wobei ihre Züge fein und aristokratisch wirkten, seine hingegen langsam zugunsten eines männlicheren Aussehens ihre Jungenhaftigkeit verloren. Nach dem Vorbild der Romantiker trug Denys Vallier einen kurzen Bart und lange Koteletten. Rio spürte, wie sich in ihm etwas zusammenzog. Ihm blieb nicht mehr viel Zeit für die Entscheidung, mit der er sich schon die ganze Nacht über herumgequält hatte.
»Kein Problem«, sagte er knapp. »Wir waren eher zu früh hier.«
Denys Vallier deutete eine Verbeugung an, dann entfernten sich die beiden Gruppen etwa zwanzig Schritte voneinander. Dr. Kiefer und der Wundarzt Dr. Buchanan, den Vallier für sich engagiert hatte, breiteten auf sauberen weißen Leinentüchern ihre Instrumente aus. Die beiden ersten Sekundanten begaben sich zur Mitte der Kampfbahn. Beide Parteien verzichteten auf eine Inspektion der Waffen. Man würde Degen benutzen, die den üblichen Abmessungen entsprachen. Die Bahn sollte fünfzehn Schritte lang sein. Die Grenzen wurden mit Kalk markiert. Dann ließ man einen mexikanischen Silberdollar darüber entscheiden, welcher der Kontrahenten die Sonne oder den Wind gegen sich haben sollte und wer die Signale geben würde. Caid gewann. Damit waren die Vorbereitungen abgeschlossen.
Rio hatte inzwischen Gehrock und Weste abgelegt und sich die Hemdsärmel bis zu den Ellbogen aufgerollt. Währenddessen rumpelten weitere Kutschen heran. Darin saßen die unvermeidlichen Zuschauer, die sich bei jedem Duell einstellten. Sie würden den Kampf kommentieren und natürlich Wetten abschließen. Rio ließ sich von der Ankunft der Schaulustigen nicht ablenken.
Viele Maîtres d’Armes schätzten es, wenn sie bei ihren Duellen Publikum hatten. Sie betrachteten die Treffen im Morgengrauen als willkommene Gelegenheit, ihre Fertigkeiten unter Beweis stellen zu können und neue Kunden zu werben. Rio hatte für diese Art der Selbstdarstellung nur wenig übrig. Ihn erinnerten die Fechtübungen unter den Zwillingsschwestern eher an die Kämpfe im Kolosseum im alten Rom, wo sich das sensationslüsterne Volk ebenfalls an blutigen Schauspielen ergötzt hatte.
Caid trat an Rios Waffenkoffer, der offen im Gras lag, und untersuchte die Klingen. Mit einem anerkennenden Grunzen drückte er seine Zufriedenheit aus und blickte zu Rio auf. »Deine Wahl?«
Rio zeigte auf eine einfache, solide Waffe und ließ sie sich von Caid reichen. Dann kreiste er mit den Schultern, um die Muskeln zu lockern, und wartete.
Inzwischen fielen bereits die ersten Sonnenstrahlen durch die Baumkronen, ließen die Blätter und die langen Moosgehänge an den Ästen wie Gold und Silber schimmern. In den Zweigen flüsterte die Morgenbrise. Sie war schwer vom Staub und vom Geruch des zertretenen Grases. Ein Stück entfernt keckerte ein Eichhörnchen, und ein Kardinalvogel schwang sich durch das Geäst der Eichen. Die Farbe seines Gefieders erinnerte an frisches Blut. Irgendwo krächzte eine Krähe.
Dann legte sich Stille über den Kampfplatz.
Rio und seine beiden Sekundanten gingen zur Mitte der Bahn, Vallier und dessen Freunde gesellten sich zu ihnen. Die Kontrahenten entboten einander den formalen Salut, dann traten die Sekundanten beiseite.
Caid und Rio sahen einander an, stummes Einvernehmen im Blick. Dann nickte Rio kurz.
»En garde!«, rief Caid.
Rios Klinge kreuzte die seines Kontrahenten. Der Klang glich dem einer hellen Glocke. Während sie die Kampfhaltung einnahmen, gestattete sich Rio einen Blick auf sein Gegenüber. Denys Valliers Gesicht war gerötet. Seine Augen glühten vor Eifer, aber Feindseligkeit suchte Rio dort vergebens. Denys Vallier hatte eine gute Haltung, nur sein Arm zitterte ein wenig.
»Beginnt!«
Bei Caids Kommando spürte Rio, dass sich die Konzentration und geistige Wachheit, die für einen guten Fechter unabdingbar waren, wie ein Mantel um seine Schultern legten. Seine Augen fixierten die Spitze des Degens, während der Griff und die Klinge zu Teilen seines eigenen Körpers wurden. Mit einer fließenden Bewegung und absoluter Genauigkeit führte er seinen ersten Angriff.
Schon Sekunden später wusste er, dass er Celinas Bruder mit Leichtigkeit töten konnte. Eigentlich hätte ihn das nicht überraschen dürfen, aber ein wenig mehr Kunstfertigkeit hatte er dennoch erwartet, denn seines Wissens besuchte Vallier regelmäßig Croqueres Studio.
Die Stimmen der Zuschauer wurden leiser und verstummten schließlich ganz. Die meisten von ihnen fochten wenigstens gelegentlich selbst und wussten, dass auch der beste Amateur sich kaum je gegen einen Meister behaupten konnte. Außerdem merkten die Schaulustigen sofort, dass Vallier alles andere als ein begnadeter Fechtschüler war.
Rio spürte Ärger in sich aufsteigen. Er fragte sich, ob es Selbstmordgelüste, Stolz oder Dummheit gewesen waren, die den jungen Mann dazu bewogen hatten, ihn herauszufordern. Vordergründig ging es natürlich immer um die Ehre. Denys Vallier konnte es nicht zulassen, dass jemand in seiner Gegenwart eine abwertende Bemerkung über seine Schwester machte. Nicht zum ersten Mal verfluchte sich Rio dafür, dass er seine Zunge nicht im Zaum gehalten hatte. Aber vielleicht hatte Vallier tatsächlich auch nur die erstbeste Gelegenheit beim Schopf gepackt, sich ein prestigeträchtiges Duell mit einem angesehenen Fechtmeister zu sichern. Schon so mancher hatte gehofft, sich ein wenig im Glanz eines Maître d’Armes sonnen zu können, und sich vielleicht sogar Chancen auf einen ruhmreichen Sieg ausgerechnet. Rio hatte wegen solcher Eitelkeiten bereits des Öfteren sein Leben riskieren müssen.
Denys Vallier war wendig und hatte ein gutes Auge. Das reichte für eine notdürftige Verteidigung. Abgesehen davon fehlte es ihm an Können und Finesse. Versuchte er einen Angriff, so tat er es unkontrolliert und mit viel zu steifem Handgelenk. Ohne Rücksicht auf Verluste stürmte er vor und parierte im Gegenzug Rios Angriffe so fahrig, dass dieser Mühe hatte, seinen Gegner nicht aus Versehen aufzuspießen. Rio verlegte sich darauf, den jungen Mann zu beschäftigen, während er nach einer Möglichkeit suchte, das Duell zu beenden, ohne sich und seinen Gegner zum Gespött zu machen.
Inzwischen war Vallier blass geworden. Die Lippen presste er so fest zusammen, dass sie sich bereits bläulich verfärbten. Hin und wieder atmete er stoßweise zwischen zusammengebissenen Zähnen hindurch. In seine Augen, die denen seiner Schwester so sehr glichen, hatte sich ein Ausdruck der Verzweiflung geschlichen. Längst war ihm klar geworden, dass er gegen Rio nicht die geringste Chance hatte, dass es nicht mehr lange dauern konnte, bis der kalte Stahl seine Brust durchbohrte. Es war grausam, ihn zappeln zu lassen, ihm allerhand hoffnungslose Anstrengungen abzuringen, ihm das Gefühl zu geben, er könne sein Schicksal doch noch wenden.
Mehr als einmal hatte Rio im Duell seinen Gegner getötet. Doch dazu war er nur genötigt, wenn sich dieser auf keinen Fall geschlagen geben wollte. Genau wie die meisten Franzosen in New Orleans war Rio ein Verfechter der europäischen Regeln, die zur Wiederherstellung der Ehre lediglich verlangten, dass einer der Gegner mit einer blutenden Wunde vom Felde ging. Die amerikanische Auffassung, ein Duell könne nur mit dem Tod eines der beiden Kontrahenten enden, fand er barbarisch. Hier stand die Rache, nicht die Ehre im Vordergrund. Gegen Denys Vallier nach den amerikanischen Regeln zu verfahren, wäre einem Mord nahe gekommen.
Das Duell zu einem halbwegs guten Ende zu bringen, fiel Rio schließlich leichter als gedacht. Es gehörte nicht viel dazu, Valliers rechten Unterarm zu erreichen. Eine leichte Drehung des Handgelenkes genügte schon. Jeder einigermaßen erfahrene Fechter hätte Rios halbherzig geführten Angriff mit Leichtigkeit abgewehrt. Doch sein Degen erreichte ungehindert das Ziel. Rio spürte, wie die Klinge Haut und Muskeln durchtrennte.
Vallier stieß einen erstickten Schrei aus und ließ den Degen fallen. Noch bevor die Sekundanten das Kommando zum Abbruch geben konnten, wich Rio zurück. Er und Vallier machten jeweils auf dem Absatz kehrt und taten ein paar Schritte in entgegengesetzte Richtungen. Ein Murmeln ging durch die Reihen der Schaulustigen – ob aus Mitgefühl oder aus Enttäuschung über das frühe Ende des Duells war schwer zu sagen.
Valliers Arzt begann umgehend, die Wunde zu untersuchen. Mit einem Baumwolllappen, den er zuvor mit Alkohol getränkt hatte, wischte er das Blut ab, presste dann den Daumen in das Fleisch des jungen Mannes und unterbrach damit den Blutfluss. Valliers Freunde inspizierten die Verletzung. Nach einer kurzen Besprechung trat der erste Sekundant vor.
»Dr. Buchanan ist der Ansicht, es bestünde die Gefahr, dass unser Mann verblutet, wenn er das Duell fortsetzt. Deshalb muss es unverzüglich beendet werden.«
Mit Bedauern stellte Rio fest, dass er offenbar eine Arterie verletzt hatte. Das war nicht mit Absicht geschehen, konnte aber nicht immer vermieden werden. Er hoffte, dass wenigstens alle Sehnen intakt geblieben waren, damit Vallier keine bleibenden Schäden zurückbehielt.
Rio übergab Caid den Degen und wandte sich an Gilbert. »Frag bitte, ob ich hinzutreten darf, Titi. Ich möchte gern ein paar Worte mit meinem tapferen Herausforderer wechseln.«
Gilbert Rosière ging zu der anderen Gruppe und kam bald darauf mit der Erlaubnis zurück. In der Zwischenzeit hatte Rio schon seine Ärmel glatt gestrichen und sich Weste und Gehrock übergezogen. Er begab sich nun zu Mademoiselle Valliers Bruder und deutete eine Verbeugung an.
Vallier war blass, sein glühender Eifer verflogen. Fast schüchtern erwiderte er Rios Blick. »Sie wollten mit mir sprechen, Monsieur?«
»Ja«, sagte Rio grimmig. »Kann mein Arzt etwas für Sie tun?«
»Nicht nötig«, antwortete Valliers Doktor. »Ich habe die Blutung unter Kontrolle. Wenn der Arm nicht weiter bewegt wird, hört sie bald ganz auf.«
»Gut.« Rio wandte sich wieder an Vallier. »Erlauben Sie mir zu sagen, dass ich Ihre Verletzung ebenso bedaure wie die Bemerkung, die zu diesem Treffen geführt hat. Ich bitte Sie, nach Möglichkeit beides zu vergessen.«
Sein Gegner hätte sich stur stellen können, hätte nachfragen können, ob dies eine formelle Entschuldigung sei. Doch er verzichtete darauf. Stattdessen streckte er Rio die unverletzte linke Hand hin und sagte: »Mit dem größten Vergnügen.«
Die Großzügigkeit des Jungen ließ sein Ansehen bei Rio wieder steigen. Er ergriff die Hand und sagte: »Wenn Ihre Verletzung verheilt ist, würde ich mich freuen, unter angenehmeren Umständen noch einmal mit Ihnen die Klingen kreuzen zu dürfen. Vielleicht besuchen Sie mich einmal in meinem Studio?«
»Monsieur, ich … das ist zu viel der Ehre«, stammelte Vallier.
Das war gut möglich, aber Rio meinte seine Einladung ernst. Er hatte Celina Vallier etwas versprochen und konnte das Wohlwollen gegenüber ihrem Bruder also gut noch ein wenig weiter treiben. »Dann bis bald.«
»Ich werde kommen.«
Rio nickte und ging dann zu seinen Freunden zurück. Schon wenige Augenblicke später waren sie auf dem Rückweg in die Stadt.
»Was für eine schöne Entschuldigung«, sagte Titi grinsend. »Das hätte ich dir gar nicht zugetraut.«
»Ich habe einen Fehler gemacht und es zugegeben. Mehr nicht«, antwortete Rio gereizt.
Caid warf ihm einen schrägen Blick zu. »Du weißt, dass sich nun jeder junge Heißsporn der Stadt auf deine Zehen stellen oder dir den Ellbogen in die Rippen rammen wird.«
»Unsinn.«
»Warte nur ab. Man wird glauben, du wärest inzwischen zu weichherzig, um noch eine echte Gefahr darzustellen. Oder man hofft, durch eine mäßige Vorstellung dein Mitleid zu erregen und dadurch zu ein paar Privatstunden zu kommen.«
»Ich hatte kein Mitleid mit Vallier.«
»Dann hast du ihn wohl wegen seiner schönen Augen am Leben gelassen. Oder waren es vielleicht eher die Augen seiner Schwester?«
Rio wandte sich dem Freund mit neuer Aufmerksamkeit zu. »Wie kommst du denn darauf?«
»Nun, immerhin hast du deine Bemerkung über sie zurückgenommen. Offenbar glaubst du inzwischen nicht mehr, dass sie nach den drei Trauerjahren aus lauter Verzweiflung jeden Tagedieb heiraten würde. Wer, wenn nicht die Dame selbst, hätte deine Meinung so schnell ändern können?«
»Ich habe nur noch einmal genau darüber nachgedacht.«
»Das kann nie schaden, mon ami.«
»Und was soll das nun wieder heißen?«
»Das weißt du sehr gut. Männer wie du und ich mögen Einlass in das Haus einer so freisinnigen Witwe wie Murelle Herriot finden – besonders wenn sie gerade aus Paris zurückgekehrt ist. Dort ist es im Moment en vogue, sich mit Bohemiens, Künstlern und allerhand anderem Volk zu zeigen. Hier bei uns in New Orleans sollte man mit einer Dame im heiratsfähigen Alter hingegen keinen allzu engen Kontakt suchen. Wenn du eine gewisse Grenze überschreitest, bist du deine Kundschaft schneller los, als ein Dampfschiff in der Flussbiegung verschwindet.«
»Ich werde daran denken«, sagte Rio gereizt.
»Und dann trotzdem tun, wozu es dich drängt? Nein, vergiss, was ich gesagt habe. So töricht bist nicht einmal du.«
Rio musterte Caid mit forschendem Blick, aber bevor er etwas erwidern konnte, meldete sich Titi zu Wort. »Sollten wir nicht auf den guten Ausgang des Duells trinken? Ich jedenfalls wäre nicht abgeneigt.«
»Wir könnten auch ein Frühstück vertragen«, bestätigte Caid. »Wohin gehen wir?«
Jeder, der im Vieux Carré lebte, wo Essen und Trinken seit jeher wie Künste gepflegt wurden, hätte die Wichtigkeit dieser Frage verstanden. Man diskutierte verschiedene Möglichkeiten und entschied sich schließlich für das St. Louis Merchant’s Exchange and Hotel. Im Restaurant des Hauses kochte der unvergleichliche Alvarez. Außerdem konnte man von dort auf die Rue Saint-Louis und auf den Eingang der Passage de la Bourse hinaussehen. Die Fechtstudios lagen nur wenige Schritte entfernt, und bald würden die Schüler dort in Scharen einfallen.
The Exchange erinnerte selbst zu dieser frühen Stunde bereits an einen Bienenstock. James Hewlett hatte das Handelshaus vor etwa vier Jahren eröffnet und die Geschäfte des alten Maspero aus der Rue Chartres übernommen. Inzwischen galt Hewletts Etablissement als die erste Adresse der Stadt, wo man Geschäfte tätigen, sich sehen lassen und gesehen werden konnte. Im Erdgeschoss des prunkvollen Baus befanden sich das Restaurant und eine Bar. Im ersten Stock wurde Handel getrieben, es gab luxuriöse Gästezimmer mit insgesamt über zweihundert Betten und zwei großartige Ballsäle. Über diesem, nach oben offenem Stockwerk wölbte sich eine gewaltige Kuppel, die der Architekt Charles Bingley Dakin nach dem Vorbild eines Athener Tempels entworfen hatte. Als ›Laterne des Diogenes‹ bekannt, bot die imposante Dachkonstruktion, die jedes Geräusch als Echo zurückwarf, das passende Ambiente für die Geschäfte, die darunter getätigt wurden. In dem weiten Raum, den sie überspannte, wurden Dampfschiffe ebenso versteigert wie Stadthäuser und Grundstücke, Plantagen, Pferde oder Rinderherden. An Samstagen fand hier sogar ein Sklavenmarkt statt.
Betörende Duftschwaden von Kaffee und Zuckergebäck umwogten die Männer, während sie sich zu ihrem Lieblingstisch in der Ecke durcharbeiteten. Bald standen drei Tassen des dampfenden Gebräus mit viel Milch und einem Schuss Branntwein vor ihnen, außerdem eine große Platte mit süßem Gebäck.
Immer wieder wurden die Fechtmeister von Stammgästen ihrer Studios oder von Privatschülern gegrüßt. Sie selbst nickten den anderen Maîtres zu, die im Restaurant die Runde machten. Unter ihnen war auch Nicholas Pasquale. Er war noch recht neu in der Stadt und hatte von den anderen Maîtres d’Armes den Spitznamen La Roche, der Fels, verpasst bekommen, denn er rührte sich beim Fechten kaum je von der Stelle. Als José Llulla, genannt Pépé, das Restaurant betrat, konnten sich die Freunde eines ironischen Grinsens nicht erwehren. Pépé war wie immer von einer Schar Anhänger umringt, die genau wie ihr schweigsamer, aber doch tödlich präziser Meister lange dünne Schnurrbärte trugen, deren Spitzen ihnen bis weit unters Kinn reichten. Niemand wusste, wie viele Männer Llulla auf dem Feld der Ehre niedergestochen hatte. Aber ein makaberer Witz besagte, dass er mit seinen Opfern einen eigenen Friedhof füllen konnte.
Der Vorschlag, dass alle Fechtmeister der Passage einmal in einem Turnier gegeneinander antreten sollten, stammte von Pépé. Diese Vorführung war dazu gedacht, die vielen einzelnen Schaukämpfe abzulösen, die nur dem Zweck dienten, neue Kunden zu werben. Noch war man sich nicht einig, ob das Turnier tatsächlich stattfinden sollte. Einige besonders beflissene Fechter verlangten, jeder Teilnehmer müsse das Zertifikat einer renommierten Akademie vorlegen können. Andere wiesen zu Recht darauf hin, dass dies nur ein Versuch war, Pépé und einige andere Fechtmeister, die ein solches Papier nicht vorweisen konnten, endgültig auszubooten. Ob man sich je einigen würde, stand noch in den Sternen.
Rio wusste, dass sich Pépé zu ihnen gesellen würde, sobald er sie entdeckte. Da der dünne, stets melancholisch dreinblickende Fechter von den Balearen stammte, betrachtete er Rio und sich als Landsleute. Die beiden hatten sich angefreundet, soweit das für Konkurrenten möglich war. Vom anderen Ende des Restaurants her winkte jemand Pépé zu. Ein Dandy mit Don-Quixote-Bart und einer aufwändig bestickten Weste erhob sich, verbeugte sich schwungvoll und wies dann mit der Hand auf einen leeren Stuhl. Offenbar wollte er, dass sich der Fechtmeister zu ihm und seinen Begleitern setzte. Llulla zögerte einen Augenblick, bevor er die Einladung annahm.
»Wer ist denn das?«, fragte Caid mit einem Nicken in Richtung des jungen Don Quixote. »Ich glaube, ich habe den Mann noch nie gesehen.«
»Es heißt, er sei ein Gesandter aus Mexiko«, sagte Gilbert. Dabei hielt er dem Ober die Kaffeetasse zum Nachfüllen hin. »Er ist auf dem Weg nach Washington und soll verhindern, dass Texas in die Staatenunion aufgenommen wird.«
»Damit wird er sich hier aber nicht viele Freunde machen.« Rio interessierte sich weder besonders für das Schicksal der ehemaligen spanischen Kolonie Texas noch für Mexikos Haltung zum Staatenbund. Doch er wusste, dass die meisten Bewohner der Stadt durchaus eine Meinung dazu hatten. Seit den Tagen der spanischen Herrschaft gab es enge Verbindungen zwischen Louisiana und Texas. Damals war der spanische Monarch das Staatsoberhaupt der südlichen Staaten gewesen, und El Camino Real, die Straße des Königs, hatte Natchez, das nun in Mississippi lag, mit Natchitoches, mit San Antonio in Texas und schließlich mit Mexico City verbunden. In New Orleans hatte man vor vier oder fünf Jahren den Kampf der Texaner um die Unabhängigkeit mit großem Interesse verfolgt und hätte es nicht gern gesehen, wenn sich Mexiko die junge Republik nun einverleibte.
»Die meisten anderen Staaten würden es gutheißen, wenn Texas mit zur Union gehörte«, sagte Caid. »Mexiko kontrolliert bereits große Teile der Ebenen im Westen und der Wüstenstaaten, von der Gegend, die man Kalifornien nennt, ganz zu schweigen. Falls sich die Mexikaner Texas aneignen – was sehr wahrscheinlich ist, wenn man es nicht bald als Staat in die Union aufnimmt – , wird die Grenze in Zukunft entlang der im Louisiana-Purchase-Vertrag festgelegten Linie verlaufen. Damit wären alle weiteren Vorstöße in den Westen unmöglich, und wir müssten New Orleans als eine Art vorgeschobenen Posten betrachten. Die Grenze zwischen uns und Mexiko würde in greifbarer Nähe verlaufen.«
»Das könnte durchaus bald der Fall sein«, sagte Gilbert. »Die Gegner der Sklaverei aus dem Nordosten wollen den Sklavenstaat Texas nicht in der Union haben.«
»Mag sein, aber wer kann es sich leisten, sich ein so gewaltiges neues Territorium entgehen zu lassen?«
»Im Falle einer mexikanischen Invasion wird es Krieg geben«, sagte Gilbert im Brustton der Überzeugung.
»Es könnte auch Krieg geben, wenn man Texas zum Mitglied der Union macht«, hielt Rio dagegen. »In Mexico City wird man das als Landraub betrachten.«
»Was es natürlich auch wäre«, sagte Gilbert mit einem schiefen Grinsen. »Und wenn die Kampfhandlungen beginnen, hocken wir in dieser Stadt mittendrin.«
Caid lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Das ist gut fürs Geschäft, meine Freunde. Die mexikanische Armee kämpft mit Säbeln. Die Männer, die sich in Texas den nackten Klingen stellen müssen, werden vorher noch ein wenig Unterricht in der Kunst, ihre Haut zu retten, haben wollen.«
Rio nickte mechanisch. Es fiel ihm schwer, noch zuzuhören. Der Tisch, an dem sich die Redakteure aus dem nahe gelegenen Büro der Tageszeitung L’Abeille oder auch The Bee – die Biene – niedergelassen hatten, leerte sich. Damit war der Blick frei auf den Gentleman, der bei dem mexikanischen Gesandten und Pépé Llulla saß.
Das Gesicht des Mannes war gerötet. Seine schlaffen Wangen trugen eine ungesunde violette Farbe, vor allem an der Stelle, an der sie sich mit seinem Doppelkinn vereinten. Dort saß eine eng geknüpfte, goldfarbene Seidenkrawatte. Pépés teure Kleider wirkten an ihm wie eine Wursthaut. Er hatte sich reichlich gefärbte Pomade ins ergraute Haar geschmiert, um die wenigen verbliebenen Locken dunkler erscheinen zu lassen. Das Morgenlicht, das durchs Fenster hereinfiel, gab den schütteren Strähnen einen Glanz, als wären sie nass. Der Mann trug ein viel zu großes Blumengebinde am Kragen, und die Verzierungen an seiner Uhrkette waren so schwer, dass sie jedes Mal, wenn er sich vorbeugte und nach einem Stück Gebäck griff, geräuschvoll auf der Tischplatte aufschlugen. Rio studierte den Mann genau. Dabei stieg eine so eiskalte Feindseligkeit in ihm auf, dass er erschauerte.
»Mon vieux«, sagte Titi und berührte ihn am Arm. »Was ist denn mit dir? Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen?«
Rio zwang sich ein Lächeln ab. »Wohl eher ein Elefant.«
»Das ist der spanische Graf«, sagte Caid, der den Hals verdreht hatte, um Rios Blick folgen zu können. »Er beehrt uns mit seinem Besuch, weil er gedenkt, in Baumwolle und Zuckerrohr zu investieren. Außerdem, so heißt es, hätte er nichts dagegen, nebenher noch die Tochter eines reichen Plantagenbesitzers zu ehelichen.«
»Don Damian Francisco Adriano de Vega y Ruiz, Conde de Lérida, wie man ihn auf Spanisch bescheiden nennt«, steuerte Titi bei. »So großspurig wie fett. Aber so mancher ist bereit, angesichts des Titels darüber hinwegzusehen. Er hat in Spanien bereits zwei Ehefrauen begraben, eine davon, so heißt es, in ungeweihter Erde. Sie hat sich umgebracht. Man sagt, er habe ein Auge auf die kleine Vallier geworfen.« Rios Gesichtsausdruck ließ Titi jäh innehalten.
»Was weiß man sonst noch über ihn?«, fragte Rio in einem Ton, der beiläufig klingen sollte.
Titi und Caid tauschten einen kurzen Blick aus. Caid zuckte die Achseln. Titi räusperte sich und fuhr fort: »Der Graf kam vor ein paar Wochen aus Havanna hier an. Er hat seine hübsche Geliebte in einem Haus auf der Rampart einquartiert und besucht sie so regelmäßig, wie andere Männer einen Verdauungsspaziergang machen. Genauso häufig sieht man ihn in den Spielhallen, wo er große Einsätze auf den Tisch legt und inzwischen als schlechter Verlierer bekannt ist.«
»Und weiter?«, sagte Rio, als Titi verstummte.
»Bei den Händlern entlang der Royale und der Chartres steht er bereits tief in der Kreide. Das gilt auch für Hewlett, denn er wohnt in der besten Suite hier im Hotel. Morgens trinkt der Graf am liebsten heiße Schokolade. Er steht nie vor der dritten Tasse auf. Was ihn am meisten plagt, sind seine Hämorrhoiden und seine schwachen Knie. Ich habe gehört, zwei Diener müssen ihm aufhelfen, wenn er endlich wieder einmal erfolgreich auf dem pot de chambre Platz genommen hat.« Titi grinste. »Reicht das?«
Rio musterte ihn skeptisch. »Woher weißt du all diese Einzelheiten?«
»Sklaventratsch, das Herzblut von New Orleans. Schließlich bleibt denen, die dich bedienen, nur wenig verborgen. Was wüsstest du denn sonst noch gern?«
»Wie stehen die Chancen für den Grafen, von Monsieur Vallier als Ehemann für seine Tochter in Betracht gezogen zu werden?«
»Gut bis exzellent würde ich sagen. Monsieur Vallier hat gerade eine lange Trauerzeit hinter sich, in der man ihn nur selten zu Gesicht bekam. Doch seit Neuestem sucht er die Gesellschaft einer hübschen Dame namens Clementine, die er kennen lernte, als er mit dem Grafen einen Quadroonenball besuchte. Du weißt schon, bei diesen Tanzveranstaltungen wählen die betuchten Gentlemen unter den hübschen Mischlingsdamen die schönsten aus. Außerdem kann man Monsieur Vallier jeden Abend in Begleitung seines neuen compadre in Davis’ Spielhalle antreffen. In Alvarez’ Bar wettet man inzwischen zwei zu eins, dass der Ehevertrag in Kürze unterschriftsreif ist und die Hochzeit noch vor der Fastenzeit stattfindet.«
»Und was sagt Mademoiselle Vallier dazu?«
Titi zuckte die Achseln. »Man hat sie nicht gefragt.«
Dieses Versäumnis muss unbedingt nachgeholt werden, dachte Rio. Und zwar bald.