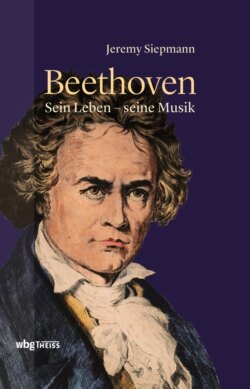Читать книгу Beethoven - Jeremy Siepmann - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Aufstieg
ОглавлениеMusik […] ist der Wein der neuen Schöpfung und ich bin Bacchus, der diesen herrlichen Wein für die Menschen aus der Rebe preßt und sie mit dem Geist desselben trunken macht.
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Aller Wahrscheinlichkeit nach war der stämmige, dunkle, strubblige kleine Mann, der diese Feststellung äußerte, der erste bedeutende Komponist, der von der Identität eines Gottes ausging – wenn auch des Weingottes. Aber Bescheidenheit war seine Sache nicht. Er war möglicherweise auch der erste Komponist, der wiederholt und bewusst für die Nachwelt schrieb. Warum auch nicht? Er war in guter Gesellschaft. Bei einer anderen Gelegenheit schrieb er:
Ich weiß aber wohl daß Gott mir näher ist wie den andern in meiner Kunst, ich gehe ohne Furcht mit ihm um, ich hab ihn jedesmal erkannt und verstanden, mir ist auch gar nicht bange um meine Musik, die kann kein bös Schicksal haben, wem sie sich verständlich macht, der muß frei werden von all dem Elend, womit sich die andern schleppen.
Beethovens Geburtshaus in Bonn
Dies war eine deutliche Behauptung. Obwohl es so scheint, war Beethoven aber nicht arrogant. Er sprach über seine eigene Erfahrung, als Lebenskünstler und als Mann, der den Unterschied zwischen wahrer Freude und bloßem Vergnügen kannte. Auf die eine oder andere Weise verkünden viele seiner Werke diese Freude; doch vieles war das Produkt unermesslichen Leidens. Grob vereinfacht kann sein Leben als heldenhafter Kampf gegen das Elend gesehen werden, in dem der Trotz der Unterwerfung wich und letztlich einer transzendenten Sicht, die eine solche Auffassung beinahe gegenstandslos macht. In seiner Musik kommen wir der Lösung des alten Paradoxons, in dem eine unaufhaltsame Gewalt auf einen unbeweglichen Gegenstand trifft, so nahe, wie es nur geht. Über eindreiviertel Jahrhunderte nach seinem Tod bleibt Beethoven der gigantischste Kämpfer der Musikgeschichte.
Er wurde 1769, 1770 und 1772 in der kleinen deutschen Stadt Bonn im Rheinland geboren (es war ein Merkmal seiner Einzigartigkeit, dass er nicht ein-, sondern dreimal geboren wurde). Der erste Ludwig wurde tatsächlich 1769 geboren, starb aber wie so viele Kinder in dieser Zeit schon nach wenigen Wochen. Der zweite folgte ungefähr 20 Monate später, wahrscheinlich am 16. Dezember 1770 geboren und mit Bestimmtheit am nächsten Tag getauft; der dritte existierte nie wirklich außer in der lebenslangen Verwechslung des zweiten Ludwigs. In vorgerücktem Alter schrieb er an einen alten Freund:
Du wirst mir eine freundschaftliche Bitte nicht abschlagen, wenn ich Dich ersuche, mir meinen Taufschein zu besorgen. […] Solltest Du auch selbst es der Mühe wert halten, der Sache nachzuforschen und es Dir gefallen, die Reise von Koblenz nach Bonn zu machen, so rechne mir nur alles an. Etwas ist unterdessen in acht zu nehmen, nämlich daß noch ein Bruder früherer Geburt vor mir war, der ebenfalls Ludwig hieß (nur mit dem Zusatze Maria), aber gestorben ist. Um mein gewisses Alter zu bestimmen, muß man also diesen erst finden, da ich ohnedem schon weiß, daß durch andre hierin ein Irrtum entstanden, da man mich älter angegeben, als ich war. Leider habe ich eine Zeitlang gelebt, ohne selbst zu wissen, wie alt ich bin. Ein Familienbuch hatte ich, aber es hat sich verloren, der Himmel weiß wie. Also, laß Dichs nicht verdrießen, wenn ich Dir diese Sache sehr warm empfehle, den Ludwig Maria und den jetzigen, nach ihm gekommenen Ludwig ausfindig zu machen. Je bälder Du mir den Taufschein schickst, desto größer meine Verbindlichkeit.
Es war weder das erste noch das letzte Mal, dass er diesen Gefallen von einem Freund erbat; und jedes Mal focht er die Richtigkeit des Beweises energisch an, wenn er erbracht wurde. Wenn Beethoven selbst Schwierigkeiten mit seinem Alter hatte, hatten andere, auch Personen, die ihn kannten, Probleme mit seinen Namen – dem ersten, letzten und mittleren. Er war wahlweise bekannt als Ludwig, Louis, Luis und Luigi und nahm so vier Nationalitäten an, während sein Familienname von Zeit zu Zeit als Betthoven, Bethofen oder sogar Bephoven erscheint und „van“ oft durch „ von“ ersetzt wird („van“ ist niederländischen Ursprungs und bietet nicht das aristokratische Gewicht des deutschen „von“). Es gab sogar einen vierten Ludwig van Beethoven, den Großvater des Komponisten – ein sehr geschätzter Kapellmeister, der vielfach als Vorbild des jungen Beethoven diente, wie es der Vater ausdrücklich nicht war.
Johann Beethoven, ein trinkfreudiger Hofmusiker (er war Tenor und unterrichtete Gesang und Klavier), sah in seinem offensichtlich talentierten Sohn die Chance auf weltliche Erlösung für sich selbst und machte sich rücksichtslos an den Versuch, einen zweiten Mozart hervorzubringen. Von Anfang an musste Beethoven einen hohen Preis für die Ambitionen seines Vaters zahlen. Mehr als ein Besucher sah den kleinen Jungen weinen, als er übte. Wiederholt wurde er in den Keller gesperrt und/oder auf Nahrungsentzug gesetzt. Wenn der betrunkene Johann nach Mitternacht aus der Kneipe kam, schüttelte er oft den schlafenden Jungen wach und zwang ihn ans Klavier, wo er bis zum Morgengrauen üben sollte. Das ist zumindest, was in seriösen Biografien aus fast zwei Jahrhunderten erzählt wurde. Vieles davon mag wahr sein; es ist jedoch Tatsache, dass es keine verlässlichen schriftlichen Quellen zur Bestätigung gibt. Als Lehrer und Ratgeber war Johann kein Leopold Mozart, und Beethoven, obwohl auffallend begabt, kein Wolfgang Amadeus – er wurde aber ein für sein Alter hervorragender Pianist sowie ein achtbarer Violinist.
Als Ludwig acht Jahre alt war (aber angekündigt als sechs), richtete sein Vater ein Konzert in Köln ein, um seinen Sohn und eine andere Schülerin, die Altistin Johanna Averdonk zu präsentieren. Es war ein Reinfall, von dem nicht ein Bericht, ob privat oder öffentlich, überlebt hat. Welche Strafe den Sohn auch getroffen hat (das ist ebenfalls nicht überliefert), das offensichtliche Scheitern des Konzerts war ein Armutszeugnis für die Lehrtätigkeit des Vaters, die tatsächlich auf Instrumentalunterricht beschränkt war. Jedes Anzeichen des frühen Antriebs des Jungen zu komponieren, ab seinen frühesten Improvisationen, traf auf wütende Schelte oder sogar Bestrafung des Ungehorsams. Sogar in seiner Kindheit waren Beethovens Starrköpfigkeit und Widerstand tief verwurzelt, die in seiner Reifezeit deutlich wurden. Im Laufe der folgenden fünf Jahre bekam er Unterricht in Cembalo, Pianoforte, Violine, Bratsche, Orgel und Horn durch eine bunte Sammlung ortsansässiger Lehrer. Erst 1781 erhielt er durchgehenden systematischen Kompositionsunterricht, und zwar von Christian Gottlob Neefe, einen relativ neuen Ankömmling in Bonns Musikbetrieb, der auch Beethovens alleiniger Klavierlehrer wurde.
Die erste öffentliche Beachtung des Talents und der Leistungen des Jungen erfolgte zwei Jahre später in einem Brief an Cramers Magazin der Musik:
Louis van Betthoven [sic], Sohn des obenangeführten Tenoristen, ein Knabe von 11 Jahren, und von vielversprechendem Talent. Er spielt sehr fertig und mit Kraft das Clavier, ließt sehr gut vom Blatt, und um alles in einem zu sagen: Er spielt größtentheils das wohltemperirte Clavier von Sebastian Bach, welches ihm Herr Neefe unter die Hände gegeben. Wer diese Sammlung von Präludien und Fugen durch alle Töne kennt, (welche man fast das non plus ultra nennen könnte,) wird wissen, was das bedeute. Herr Neefe hat ihm auch, sofern es seine übrigen Geschäfte erlaubten, einige Anleitung zum Generalbaß gegeben. Jetzt übt er ihn in der Composition, und zu seiner Ermunterung hat er 9 Variationen von ihm fürs Clavier über einen Marsch in Mannheim stechen lassen. Dieses junge Genie verdiente Unterstützung, daß er reisen könnte. Er würde gewiß ein zweyter Wolfgang Amadeus Mozart werden, wenn er so fortschritte, wie er angefangen.
Wir finden abermals den Vergleich mit Mozart sowie den (sicher unbeabsichtigten) Fehler in der Angabe von Beethovens Alter. Wie sich herausstellte, war Neefe selbst der Autor des Briefes.
In einem Punkt stimmten alle Lehrer Beethovens überein: Er war kein einfacher Schüler. Bereits in seiner Kindheit war seine Haltung gegenüber der Tradition etwas völlig Neues in der Musik, und sie sollte später der Geschichte eine neue Richtung geben. Mit aller Rücksichtslosigkeit eines Genies nahm er vom Erbe seiner Vorgänger nur, was ihm im Hinblick auf sein eigenes inneres Erleben sinnvoll erschien. Den Rest verwarf er. Indem er ihm das Wohltemperierte Klavier gab, hat Neefe möglicherweise mehr für Beethovens zukünftige Entwicklung getan als alle seine anderen Lehrer zusammen. Interessanterweise entdeckten Haydn und Mozart in Wien Bach zur gleichen Zeit, dank des gelehrten Barons van Swieten (der der Widmungsträger von Beethovens erster Sinfonie werden sollte). Das Wohltemperierte Klavier blieb, wie viele der Bach’schen Werke, erstaunlicherweise rund 40 Jahre lang nach seiner Vollendung unveröffentlicht und kursierte nur in Abschriften.
Außer einem kurzen Besuch in Holland anlässlich des Todes eines Verwandten blieb Neefes Empfehlung zu reisen für vier weitere Jahre unbeachtet. In der Zwischenzeit machte Beethoven schnell Fortschritte. Innerhalb eines Jahres war er ein bewährter Vertreter Neefes als Hoforganist und wurde als stellvertretender Cembalist in das Hoforchester des Kurfürsten aufgenommen. 1784, mit nicht einmal 14 Jahren, wurde er zum zweiten Organisten ernannt. Als Beethoven 16 wurde, war der Kurfürst von seinen Fähigkeiten so beeindruckt, dass er eine Reise nach Wien finanziell unterstützte, damit er bei Mozart studierte (der zu diesem Zeitpunkt 31 Jahre alt war und in die Komposition von Don Giovanni vertieft war). Als Mozart ihn das erste Mal hörte, reagierte er angeblich kühl. Beethoven, davon unbeeindruckt, bat Mozart, ihm ein Thema zu geben, über das er improvisieren könne. Mozart kam der Bitte nach, und Beethoven tat, was er am besten konnte. Mozarts Aufmerksamkeit war sogleich gefesselt. Er hörte mit wachsendem Erstaunen zu und schlich zur Türschwelle eines angrenzenden Raumes, wo einige Freunde saßen. „Auf den gebt Acht“, flüsterte er, „der wird einmal in der Welt noch von sich reden machen.“ So lautet die oft erzählte Anekdote, obwohl es keine Augenzeugenberichte gibt, die dies untermauern. Auch wenn es sie gäbe, sind solche Berichte nicht verlässlicher als Anekdoten. Von seinem Freund und Schüler Ferdinand Ries hören wir beispielsweise, dass Beethoven es sehr bedauerte, Mozart nie spielen gehört zu haben. Von seinem Freund und Schüler Czerny erfahren wir andererseits, dass er Mozart öfter gehört habe.
Beethoven spielt 1787 im Hause Mozarts
Hätte es Beethovens erhoffte Unterrichtsstunden mit Mozart gegeben, wüssten wir zweifellos mehr darüber. So aber erfuhr Beethoven, binnen zweier Wochen nach seiner Ankunft in Wien, dass seine Mutter ernsthaft erkrankt war. Sie lebte noch drei Monate, bevor sie im Alter von 40 Jahren der Tuberkulose erlag. Da sein Vater immer tiefer in den Alkoholismus versank, übernahm Beethoven mit 16 Jahren die volle Verantwortung für die Familie: seinen Vater, zwei jüngere Brüder namens Carl und Johann und eine neugeborene Schwester, die noch vor Ablauf des Jahres starb. Am 15. September 1787 schrieb er an Josef Schaden, mit dem er kürzlich Bekanntschaft gemacht hatte:
hochedelgebohrner
insonders werther freund! was sie von mir denken, kann ich leicht schließen; daß sie gegründete ursachen haben, nicht vortheilhaft von mir zu denken, kann ich ihnen nicht widersprechen; doch ich will mich nicht eher entschuldigen, bis ich die ursachen angezeigt habe wodurch ich hoffen darf, daß meine entschuldigungen angenommen werden. ich muß ihnen bekennen: daß, seitdem ich von augspurg hinweg bin, meine freude und mit ihr meine gesundheit begann aufzu hören; je näher ich meiner vaterstadt kam, je mehr briefe erhielte ich von meinem vater, geschwinder zu reisen als gewöhnlich, da meine mutter nicht in günstigen gesundheitsumständen wär; ich eilte also, so sehr ich vermochte, da ich doch selbst unpäßlich wurde; das verlangen meine kranke mutter noch einmal sehen zu können, sezte alle hinderniße bej mir hinweg, und half mir die gröste beschwerniße überwinden. ich traf meine mutter noch an, aber in den elendesten gesundheitsumständen; sie hatte die schwindsucht und starb endlich ungefähr vor sieben wochen, nach vielen überstandenen schmerzen und leiden. sie war mir eine so gute liebenswürdige mutter, meine beste freundin; o! wer war glücklicher als ich, da ich noch den süßen namen mutter aussprechen konnte, und er wurde gehört, und wem kann ich ihn jetzt sagen; den stummen ihr ähnlichen bildern, die mir meine einbildungskraft zusammensezt? So lange ich hier bin, habe ich noch wenige vergnügte stunden genoßen; die ganze zeit hindurch bin ich mit der engbrüstigkeit behaftet gewesen, und ich muß fürchten, daß gar eine schwindsucht daraus entstehet; dazu kömmt noch melankolie, welche für mich ein fast eben so großes übel, als meine krankheit selbst ist. denken sie sich jetzt in meine lage, und ich hoffe vergebung, für mein langes stillschweigen, von ihnen zu erhalten. die außerordentliche güte und freundschaft, die sie hatten mir in augspurg drey k(a)r(o)lin zu leihen, muß ich sie bitten noch einige nachsicht mit mir zu haben; meine reise hat mich viel gekostet, und ich habe hier keinen ersaz auch den geringsten zu hoffen; das schicksaal hier in bonn ist mir nicht günstig.
sie werden verzeihen, daß ich sie so lange mit meinem geplauder aufgehalten, alles war nöthig zu meiner entschuldigung. ich bitte sie mir ihre verehrungswürdige freundschaft weiter nicht zu versagen, der ich nichts so sehr wünsche, als mich ihrer freundschaft nur in etwas würdig zu machen. ich bin mit aller hochachtung
ihr gehorsamster diener und freund
l. v. beethowen.
kurf-kölnischer hoforganist.
Frau van Beethoven war eine allseits anerkannte Frau. Sie war ein Ausbund an leidgeprüfter Tugendhaftigkeit, aber Herzlichkeit war nicht ihre Art. Wenige konnten behaupten, sie je lachen gesehen zu haben; und sie überschüttete ihren ältesten Sohn nicht mit offenkundiger Zuneigung. Doch war es ihr Einfluss, auf den er (indirekt) den Moralkodex zurückführte, den herauszustellen er sein Leben lang bemüht war und dessen Entstehung in seiner Kindheit er stets anführte, nämlich dass es seit seiner Kindheit sein größtes Glück gewesen sei, etwas für andere zu tun; seit der Kindheit ist sein Eifer, der armen, leidenden Menschheit zu dienen, keinen Kompromiss mit niedrigeren Motiven eingegangen; niemals fände man ihn unehrenhaft etc.
Wie er dies damit vereinbarte, dass er die Missa solemnis an mehrere Verleger gleichzeitig verkaufte, ist eine Sache, über die er kein Wort verlor. Aber das ist zu weit vorgegriffen.
Nach einer Zeit voller Armut, Krankheit und Anfällen von Depression begann Beethoven ernsthaft, seine Stärken zu entdecken. Er schloss neue Freundschaften – darunter der erste in einer langen Reihe einflussreicher Adliger, Graf Waldstein – und etablierte sich als konkurrenzloser Klavier-Virtuose. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich Neuigkeiten von seinem Können bis weit über die Grenzen Bonns und Umgebung hinaus verbreiteten. Carl Ludwig Junker, der ihn in Mergentheim während eines Besuchs des kurfürstlichen Hoforchesters hörte, lobte seine Tugenden in einem Brief an die Musikalische Correspondenz in den höchsten Tönen:
Noch hörte ich einen der größten Spieler auf dem Klavier, den lieben guten Bethofen; von welchem in der speierischen Blumenlese vom Jahr 1783 Sachen erschienen, die er schon im 11. Jahr gesetzt hat. Zwar ließ er sich nicht im öffentlichen Konzert hören; weil vielleicht das Instrument seinen Wünschen nicht entsprach […]. Indessen, was mir unendlich lieber war, hörte ich ihn phantasiren, ja ich wurde sogar selbst aufgefordert, ihm ein Thema zu Veränderungen aufzugeben. Man kann die Virtuosengröße dieses lieben, leisegestimmten Mannes, wie ich glaube, sicher berechnen, nach dem beinahe unerschöpflichen Reichthum seiner Ideen, nach der ganz eigenen Manier des Ausdrucks seines Spiels, und nach der Fertigkeit, mit welcher er spielt. Ich wüßte also nicht, was ihm zur Größe des Künstlers noch fehlen sollte. Ich habe Voglern auf dem Fortepiano […] oft gehört […] und immer seine außerordentliche Fertigkeit bewundert, aber Bethofen ist ausser der Fertigkeit sprechender, bedeutender, ausdrucksvoller, kurz, mehr für das Herz: also ein so guter Adagio- als Allegrospieler. Selbst die sämmtlichen vortrefflichen Spieler dieser Kapelle sind seine Bewunderer, und ganz Ohr, wenn er spielt. Nur er ist der Bescheidene, ohne alle Ansprüche. Indes gestand er doch, daß er auf seinen Reisen, die ihn sein Kurfürst machen ließ, bei den bekanntesten guten Klavierspielern selten das gefunden habe, was er zu erwarten sich berechtigt geglaubt hätte: Sein Spiel unterscheidet sich auch so sehr von der gewöhnlichen Art das Klavier zu behandeln, daß es scheint, als habe er sich einen ganz eigenen Weg bahnen wollen, um zu dem Ziel der Vollendung zu kommen, an welchem er jetzt steht.
Dieser „liebe, leisegestimmte Mann“, „der Bescheidene“, war nicht ganz 22 Jahre alt. Fast genau ein Jahr später verließ er Bonn, um sich dauerhaft in Wien niederzulassen. Junkers rosarote Beschreibung sollte bald überholt sein.
Ein Pianist ohne Rivalen in Bonn zu sein, war eine Sache; ein solcher in Wien zu sein, eine ganz andere. Als Beethoven dort in der zweiten Novemberwoche 1792 ankam, beherbergte die Stadt mehr als 300 Berufspianisten und mehr als 6000 Klavierschüler. Beethoven war entschlossen, sie alle zu besiegen, und verhehlte diese Tatsache nicht. Er hatte einen großen Wetteifer und nahm an einer Reihe Klavierduelle teil, oder fädelte diese teilweise sogar ein, in denen er die Wiener Pianisten von ihren Hochsitzen stürzte, einen nach dem anderen. Unter diesen befand sich Josef Gelinek, der kaum wusste, wie ihm geschah:
In dem jungen Menschen steckt der Satan. Nie habe ich so spielen gehört! Er fantasiert auf ein von mir gegebenes Thema, wie ich selbst Mozart nie fantasieren gehört habe. Dann spielte er eigene Compositionen, die im höchsten Grade wunderbar und großartig sind, und er bringt auf dem Clavier Schwierigkeiten und Effekte hervor, von denen wir uns nie haben etwas träumen lassen.
Ein anderer Virtuose, Daniel Steibelt, war so gedemütigt von der pianistischen Tracht Prügel durch Beethovens Hände, dass er aus dem Raum flüchtete, bevor Beethoven geendet hatte, und anschließend jede Zusammenkunft ablehnte, bei der Beethoven ebenfalls zugegen sein könnte.
Wie von Junker festgehalten, war Beethovens Spiel etwas Neues; und es entfachte eine neue Form der Kritik, eine neue Art der Erfahrung für den Zuhörer. Sogar Mozart, der weniger als ein Jahr vor Beethovens Ankunft in Wien gestorben war, hätte nie zu folgender Prosa veranlasst:
[…] schwelgte er einmal im unermeßlichen Tonreich, dann war er auch entrissen dem Irrdischen; der Geist hatte zersprengt alle beengenden Fesseln, abgeschüttelt das Joch der Knechtschaft, und flog siegreich jubelnd empor in lichte Ätherräume; jetzt brauste sein Spiel dahin gleich einem wild schäumenden Cataracte, und der Beschwörer zwang das Instrument mitunter zu einer Kraftäußerung, welcher kaum der stärkste Bau zu gehorchen im Stande war; nun sank er zurück, abgespannt, leise Klagen aushauchend, in Wehmuth zerfließend; – wieder erhob sich die Scala, triumphirend über vorübergehendes Erdenleiden, wendete sich nach oben in andachtsvollen Klängen, und fand beruhigenden Trost am unschuldsvollen Busen der heiligen Natur. – Doch, wer vermag zu ergründen des Meeres Tiefe? Es war die geheimnisreiche Sanscrittsprache, deren Hieroglyphen nur der Eingeweihte zu lösen ermächtigt ist!
So schrieb der Komponist Ignaz von Seyfried über Beethovens „Duell“ mit seinem engsten Konkurrenten, dem hochgeschätzten Joseph Wölfl.
Ein Brief an die Allgemeine musikalische Zeitung eines anderen Augenzeugen liefert einen leidenschaftsloseren Bericht, der das Bild vervollständigt:
Ich will mich bemühen, Ihnen das Eigene Beyder anzugeben, ohne an jenem Vorrangsstreite Theil zu nehmen. Beethovens Spiel ist äußerst brillant, doch weniger delikat, und schlägt zuweilen in das Undeutliche über. Er zeigt sich am allervortheilhaftesten in der freyen Phantasie. Und hier ist es wirklich ganz außerordentlich, mit welcher Leichtigkeit und zugleich Festigkeit in der Ideenfolge B. auf der Stelle jedes ihm gegebene Thema, nicht etwa nur in den Figuren variirt (womit mancher Virtuos Glück und – Wind macht) sondern wirklich ausführt. Seit Mozarts Tode, der mir hier noch immer das non plus ultra bleibt, habe ich diese Art Genusses nirgends in dem Maaße gefunden, in welchem sie mir bey B. zu Theil ward.
Nach einer in hohem Maße respektvollen Diskussion von Wölfls Spiel bemerkt er, dass „Wölfl durch sein anspruchsloses, gefälliges Betragen über Beethovens etwas hohen Ton noch ein besonderes Übergewicht erhält“.
Carl Czerny, später Beethovens Schüler und ein großer Kenner des Klavierspiels, war vom Gegensatz zwischen Beethovens und Mozarts Spiel sehr beeindruckt:
Mozart’s Schule: Ein klares, schon bedeutend brillantes Spiel, mehr auf das Staccato als auf das Legato berechnet; geistreicher und lebhafter Vortrag. Das Pedal selten benützt und niemals nothwendig.
Beethoven’s Manier: Charakteristische und leidenschaftliche Kraft, abwechselnd mit allen Reizen des gebundenen Cantabile ist hier vorherrschend. […]
[Er] entlockte dem Fortepiano durch ganz neue kühne Passagen, durch den Gebrauch des Pedals, durch ein ausserordentlich charakteristisches Spiel, welches sich besonders im strengen Legato der Accorde auszeichnete, und daher eine neue Art von Gesang bildete, – viele bis dahin nicht geahneten Effekte. Sein Spiel […] war […] geistreich, grossartig, und besonders im Adagio höchst gefühlvoll und romantisch. Sein Vortrag war, so wie seine Compositionen, ein Tongemälde höherer Art, nur für die Gesammtwirkung berechnet.
Wie so oft war das Ergebnis emotionaler Sprengstoff. Dies traf besonders zu, wenn Beethoven improvisierte:
Seine Improvisation war höchst glanzvoll und packend: gleichgültig in welcher Gesellschaft er sich gerade befand, verstand er es, eine solche Wirkung auf jeden Hörer hervorzubringen, daß häufig genug kein Auge trocken blieb, manch einer aber in lautes Schluchzen ausbrach. So etwas Wunderbares war in seinem Ausdruck, abgesehen von der Schönheit und Originalität seiner Ideen und seines feurigen Stils, sie wiederzugeben. Wenn er eine Improvisation dieser Art beendet hatte, brach er meist in ein lautes Gelächter aus und machte sich über die Gemütbewegung der Hörer lustig, die er ihnen verursacht hatte.
Zu keiner Zeit seines Lebens war Beethoven ein einfacher Zeitgenosse. Er war sicherlich kein Diplomat. Und in seiner Leidenschaft und Überschwänglichkeit konnte er gegenüber den Klavieren so unbedacht sein wie zu seinen Freunden. Einer von diesen war der Komponist Antonín Reicha. Er sollte Beethoven umblättern, war aber damit beschäftigt, an den Klaviersaiten zu ziehen, die rissen, während die Hämmer zwischen den kaputten Saiten steckten. Beethoven bestand darauf, bis zum Ende weiter zu spielen, und so sprang Reicha vor und zurück, befreite einen Hammer da, wendete dort eine Seite um … Er hatte mehr zu tun als Beethoven!
Beethovens Broadwood-Flügel
Sogar in seiner Jugendzeit war Beethoven viel mehr als nur Pianist und Klavier-Komponist. Er hatte zwei imposante Kantaten geschrieben und viel Kammermusik, in der dem Klavier keine Rolle zufällt. 1795 – Beethoven war nun 24 – wurde er beauftragt, die Tänze für den jährlichen Wohltätigkeitsball im berühmten Redoutensaal zu komponieren. Damals wie heute überrascht die Tatsache, dass es für ihn weitaus einfacher war, solche Musik zu schreiben, als selber zu ihr zu tanzen. Auf der Tanzfläche machte er keine gute Figur.
Wie in keiner anderen Stadt der Welt wurde in Wien in jenen Tagen fast wie besessen getanzt. Der Tanz war in der Tat eines der Dinge, die den Ruf der Stadt als Festung der (nicht immer) vornehmen Frivolität begründeten. Ball- und Tanzsäle waren fast so gegenwärtig wie die zahlreichen Kaffeehäuser, Schenken und Bierhallen. Sie wurden von Angehörigen aller Schichten frequentiert, die oft maskiert waren, um ihre Identität zu verbergen, da, wie ein rechtschaffener Historiker verkündete, viele solcher Etablissements, ungeachtet ihres schicklichen Äußeren, Institutionen für anrüchige Zwecke schlechthin waren. Prostitution war auf jeder Ebene weit verbreitet, was der junge Beethoven missbilligte. Vergnügungen auf den Straßen und in den Theatern wurden von Gauklern, Puppenspielern, Seiltänzern, Akrobaten und dergleichen dominiert. Der vorherrschende Geschmack galt mehr dem Trivialen als dem Gehaltvollen, Eskapismus statt Philosophie, Pläsier statt Erziehung. Gab es aber Wirklichkeitsflucht, gab es auch viel, vor dem man entfliehen musste. Unter der Oberfläche der Ausgelassenheit lag die Arbeit eines unbarmherzigen Polizeistaats. Dissidenten wurden gemeinhin verhaftet, verprügelt und eingesperrt, während Hunderte Spione der Regierung fast jede Ebene der Gesellschaft infiltriert hatten.
Beethoven hatte wenige Illusionen über die Gesellschaft, in die er eingetreten war. Im Sommer 1794 schrieb er an einen Freund in Bonn:
Hier ist es sehr heiß; die Wiener sind bange, sie werden bald kein Gefrorenes mehr haben können: da der Winter so wenig kalt war, so ist das Eis rar. Hier hat man verschiedene Leute von Bedeutung eingezogen; man sagt es hätte eine Revolution ausbrechen sollen – aber ich glaube, solange der Österreicher noch brauns Bier und Würstel hat, revoltiert er nicht. Es heißt, die Tore zu den Vorstädten sollen nachts um zehn Uhr gesperrt werden. Die Soldaten haben scharf geladen. Man darf nicht laut sprechen hier, sonst gibt die Polizei einem Quartier.
Zu gegebener Zeit würde Beethoven selbst seine Stimme erheben, aber für den Moment schwieg er. Er hatte keine Angst und war im Ganzen zufrieden mit seiner Situation. Er hatte keinen grundlegenden Streit mit dem Adel, aus dem seine wertvollsten Förderer stammten, sowohl gegenwärtig als auch zukünftig; und er schätzte das Zugehörigkeitsgefühl mindestens ebenso hoch wie seine Karriere. In vielerlei Hinsicht gaben ihm die vornehmen und aristokratischen Familien, die ihn willkommen hießen, ein Gefühl von Behaglichkeit, Sicherheit und Wertschätzung, die er in seiner eigenen Familie selten erfahren hatte. Es gab auch ein merkwürdiges, unausgesprochenes Bündnis zwischen den repressiven Behörden und der breiteren Kulturlandschaft. Wie in vielen despotischen Regierungen schätzte die Polizei die beruhigende Wirkung, die die Künste haben konnten, vor allem die Theater. So unwahrscheinlich es sein mag, war es die Polizei, die die Schließung eines der Haupttheater Wiens verhinderte. Aus ihrem offiziellen Memorandum: „Das Volk ist an die Schaubühne gewöhnt. Das Theater an der Wien besonders ist die Lieblingsunterhaltung der höheren und der mittleren Stände. Selbst die niederen Stände nehmen Anteil. In Zeiten wie die gegenwärtige, wo so mannigfaltige Leiden den Charakter der Menschen verstimmen, muß die Polizei mehr als jemals zur Zerstreuung der Staatsbürger auf jedem sittlichen Wege mitwirken. Die gefährlichsten Stunden des Tages sind die Abendstunden. Unschädlicher werden sie nicht ausgefüllt als im Theater“ – es sei denn zuhause, beim Musizieren mit Freunden. Hierzu lieferte Beethoven, sogar mehr als im Ballsaal, bereitwillig die erforderlichen Mittel. Einiges seiner Kammermusik, die er für Blasinstrumente sowie für Bläser und Streicher gemeinsam schrieb, ist weitaus interessanter und fesselnder als seine Tanzmusik. Auch dies war Unterhaltung; aber hier gab es echte musikalische Konversation, in der musikalische Ideen begonnen, ausgetauscht und entwickelt wurden, alles mit einer meisterhaften Verteilung der instrumentalen Klangfarbe.
Beethoven erlebte den Großteil seines frühen Wiener Lebens als eine Art Befreiung. Während er in Bonn als inoffizielles Familienoberhaupt sein eigenes Leben verschiedentlich den Bedürfnissen anderer unterordnen musste, konnte er in Wien eine Art aufgeklärter Egozentrik genießen. Nun konnte er sich selbst an erste Stelle setzen; und seine Hauptaufgabe bestand in der Erfüllung dessen, was er zunehmend als sein Schicksal akzeptierte. Hilfreich war natürlich, dass er trotz seines etwas rauen Äußeren und seines provinziellen Benehmens schnell der Liebling der Aristokratie geworden war – der Machtausüber. Er war tatsächlich in aller Munde, zunächst als Pianist, dann immer häufiger als Komponist. Aber er war sich wohl bewusst, dass all dies ihn als Künstler korrumpieren könnte. In seinem Tagebuch ermahnte er sich selbst, sich nicht von der „göttlichen Kunst“, wie er sie jetzt nannte, ablenken zu lassen:
Muth. Auch bei allen Schwächen des Körpers soll doch mein Geist herrschen. […] Dieses Jahr muß den völligen Mann entscheiden. – Nichts muß übrig bleiben.
Das hieß auch, zuzugeben, zumindest theoretisch, dass es trotz seines Genies, wie er frei eingesteht, auch Aspekte seiner Kunst gab, die er noch erlernen musste. In der frühesten Phase seiner Wiener Zeit scheint Beethoven praktisch bei jedem Unterricht gehabt zu haben, wenn auch um zu zeigen, wie wenig er ihn brauchte. An einen von ihnen, den geschätzten Pädagogen Johann Georg Albrechtsberger, erinnert man sich heute vor allem wegen seines grandiosen Urteils über Beethovens Zukunft. An einen Kollegen schreibend warnte er: „Gehen Sie mit dem nicht um, der hat nichts gelernt und wird nie etwas ordentliches machen.“ Der namhafteste unter Beethovens Lehrern zu diesem Zeitpunkt war kein anderer als der bedeutendste und berühmteste Komponist der Welt, Joseph Haydn. Beethoven erklärte einst, „nie etwas von ihm gelernt zu haben“. Seine Musik erzählt jedoch eine andere Geschichte.
Vor Gott war Beethoven aufrichtig bescheiden. Tatsächlich war er aufrichtig gegenüber Fehlern in allem, was er tat oder fühlte. Gegenüber der Menschheit mit ihrem Leiden und ihrer Widerstandskraft empfand er eine leidenschaftliche, wenn auch größtenteils symbolische Liebe. Aber für den Menschen allgemein, seit jungen Jahren vertreten von seinem Vater, empfand er im Ganzen Verachtung, die er kaum verbarg. „Hol’ sie der Teufel“, schrieb er einmal, „ich mag nichts von ihrer ganzen Moral wissen, Kraft ist die Moral der Menschen, die sich vor anderen auszeichnen, und sie ist auch die meinige.“ An anderer Stelle bezieht er sich auf Personen, die sich für seine vertrauten Freunde halten: „Ich betrachte [sie] als bloße Instrumente, worauf ich, wenns mir gefällt, spiele; […] ich taxiere sie nur nach dem, was sie mir leisten.“ Doch in seinem schwindelerregenden Aufstieg zu den Gipfeln künstlerischer Macht und gesellschaftlichem Prestige schien er sich an der Gesellschaft seiner Freunde zu erfreuen, so wie sie an seiner. Nach dem, was man hörte, genoss er Unterhaltung und Gelächter, ob in Kneipen oder Schlössern, und er entdeckte, dass er entgegen allen Erwartungen äußerst anziehend auf Frauen wirkte.
Beethovens Charme war jedoch, wie sein Sinn für Etikette, nicht immer sofort augenfällig – wie sich eine befreundete Pianistin der Lichnowsky-Familie, Frau von Bernhard, später erinnerte:
Wenn er in unser Haus kam, steckte er gewöhnlich erst den Kopf durch die Thür und vergewisserte sich, ob nicht Jemand da sei, der ihm missbehagte. Er war klein und unscheinbar, mit einem hässlichen rothen Gesicht voll Pockennarben. Sein Haar war ganz dunkel und hing fast zottig ums Gesicht, sein Anzug war sehr gewöhnlich und nicht entfernt von der Gewähltheit, die in jener Zeit und zumal in unsern Kreisen üblich war. Dabei sprach er sehr im Dialekt und in einer etwas gewöhnlichen Ausdrucksweise, wie denn überhaupt sein Wesen nichts von äusserer Bildung verrieth, vielmehr unmanierlich in Geberden und Benehmen erschien. Er war sehr stolz; ich habe gesehen wie die Mutter der Fürstin Lichnowsky, die alte Gräfin Thun, vor ihm, der in der Sophaecke lehnte, auf den Knieen lag, ihn zu bitten, dass er doch etwas spiele. Beethoven that es aber nicht.
Eine betagte Gräfin auf Knien vor einem ungehobelten Klavierspieler Mitte zwanzig – noch dazu eine Gräfin, die eine Mäzenin von Mozart, Haydn und Gluck war! Ein anderer Adliger, ihr Sohn Fürst Lichnowsky, gab seinem Personal strikte Anweisungen, dass, falls er und Beethoven je zur gleichen Zeit an der Tür seien, man sich zuerst Beethovens annehmen solle.
Beethovens fast gänzliche Billigung durch die Aristokratie Wiens war so neu wie seine Musik. Haydn, nun Anfang sechzig, hatte im Gegensatz erst kürzlich die Dienerlivree abgelegt, die er jahrzehntelang im Dienste der Esterházy-Familie getragen hatte. Dass Beethoven wirklich charmant war und eine angenehme Gesellschaft sein konnte, ist weithin belegt. Wenn es darum ging, die äußeren Zeichen des Adels zu beobachten, zeigte er jedoch, wie wir gesehen haben, eine fast aggressive Geringschätzung. Ferdinand Ries bemerkte:
Etiquette und was dazu gehört, hatte Beethoven nie gekannt und wollte sie auch nie kennen. So brachte er durch sein Betragen die Umgebung des Erzherzogs Rudolph, als Beethoven anfänglich zu diesem kam, gar oft in große Verlegenheit. Man wollte ihn nun mit Gewalt belehren, welche Rücksichten er zu beobachten habe. Dieses war ihm jedoch unerträglich. Er versprach zwar sich zu bessern, aber – dabei blieb’s. […] Der Erzherzog lachte gutmütig über den Vorfall und befahl, man solle Beethoven nur seinen Weg ungestört gehen lassen: er sei nun einmal so.
Von Anfang an bestand Beethoven bei seinen Beziehungen zum Wiener Adel darauf – weniger durch Erklären als durch sein Verhalten –, dass er gleichgestellt behandelt werde. Wie er später einem seiner fürstlichen Gönner gegenüber bemerkte: „Fürst! was Sie sind, sind Sie durch Zufall und Geburt. Was ich bin, bin ich durch mich. Fürsten gibt es Tausende. Beethoven nur einen.“ Und die Fürsten wussten dies. Fast ab dem Moment seiner Ankunft in Wien wurde er von den Obersten des Landes begeistert angenommen und gefeiert. Sie waren von seinem Adel des Geistes ebenso beeindruckt wie er selbst. Sie weideten sich an seinem Genie und erfreuten sich an seinem überbordenden Selbstvertrauen. In Anbetracht seiner offenbar unbestechlichen Integrität und seiner fast übermenschlichen Fähigkeit, die Gefühle seiner Zuhörer zu manipulieren, müssen sich viele von seinen Aufmerksamkeiten geschmeichelt gefühlt haben. Dies wäre kaum der Fall gewesen, hätte es seinen respektlosen Sinn für Humor nicht gegeben. Sie liebten seine Witze. Sie liebten die Tatsache, dass er von ihrem Rang so völlig unbeeindruckt war. Sie liebten seine Macht. Trotz all seines Mangels an gesellschaftlichen Umgangsformen machte sich seine Gabe zur Freundschaft fast auf allen Ebenen bezahlt. In der Tat scheint der Beethoven dieser frühen Wiener Jahre zum ersten Mal in seinem Leben fast unmäßig glücklich gewesen zu sein.