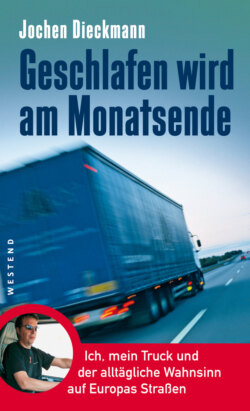Читать книгу Geschlafen wird am Monatsende - Jochen Dieckmann - Страница 8
ОглавлениеOn the road: Mein Weg vom Kleinlasterfahrer zum internationalen Trucker
Meinen ersten Lkw-Job hatte ich gleich mit 18. Ich durfte damals mit dem frisch erworbenen Autoführerschein einen 7,5-Tonner fahren, so habe ich mir eine Zeit lang mein Studium finanziert. Zuerst fuhr ich für ein Baugeschäft Ware aus, da musste ich immer Garagentore oder ein paar Dutzend Zementsäcke quer über irgendwelche Baustellen schleppen. Später jobbte ich für eine Spedition im Nahverkehr, da gab es dann »nur« Kartons zu tragen. Das Geld reichte mir nicht, die Arbeit gefiel mir nicht, deswegen machte ich gleich mit 21 den Führerschein für große Lkw. Im Verhältnis zu heute war das damals ein Kinderspiel, sowohl in Bezug auf die Anforderungen als auch auf den Preis.
Ich kam schnell an eine Anstellung in Bremen. Der Speditionsmarkt war damals – Anfang der achtziger Jahre – anders strukturiert als heute. Um in Deutschland gewerblichen Fernverkehr zu betreiben, brauchte man eine Konzession für jedes einzelne Fahrzeug – ähnlich wie heute noch im Taxigewerbe. Ohne dieses Papier durfte man nur in einem Umkreis von fünfzig Kilometern um den Heimatort gewerblich fahren. Auch in den meisten anderen Ländern Europas war die Anzahl der Konzessionen beschränkt, sie wurden daher praktisch nie an die Behörde zurückgegeben. Stattdessen entwickelte sich ein Markt dafür. In den achtziger Jahren konnte man eine solche sogenannte »rote Konzession« für etwa 250 000 Mark kaufen, sie kostete also mehr als der Lkw selbst. Diese nach Planwirtschaft riechenden Beschränkungen wurden erst Anfang der neunziger Jahre europaweit aufgehoben. In Griechenland wurde das sogar erst im Jahr 2010 nachgeholt, gegen den Widerstand der betroffenen Fuhrunternehmer.
Ins Ausland sind nur diejenigen gefahren, die keine Konzession für den nationalen Fernverkehr ergattert hatten, denn hier waren die Gewinnspannen deutlich niedriger. Für eine Tour von Hamburg nach Marseille gab es kaum mehr Geld als für eine Tour von Hamburg nach München. Ich bin damals jahrelang nach Frankreich gefahren, manchmal auch nach Italien und Spanien. Die Firmenstandorte lagen nahe einer Grenze, da die Spedition ja keine innerdeutsche Konzession hatte. Wenn ich etwa von Bremen nach Italien fahren musste, bin ich damals also erst einmal Richtung Groningen gestartet, dann durch die Niederlande, Belgien, Frankreich nach Italien. Heute nur noch schwer vorstellbar: An jeder Grenze musste man warten, Formulare ausfüllen, beachten, wieviel Diesel man für das jeweilige Land im Tank haben darf, und so weiter. Lediglich zwischen Holland und Belgien gab es damals schon eine offene Grenze. Sonntagabends losfahren und dienstagmorgens in Montpellier ausladen war damals normal …
Die Lkw im nationalen Fernverkehr waren fast alle mit zwei Fahrern besetzt, denn die Konzession sollte ja möglichst viel Geld erwirtschaften. Auch damals gab es zwar Gesetze, die maximale Lenkzeiten vorschrieben, aber sie wurden noch konsequenter ignoriert als heute. Zudem gab es noch weniger Kontrollen. Daher waren Lkw mit roter Konzession praktisch rund um die Uhr unterwegs; mit zwei Fahrern ließ sich das noch intensiver organisieren. Im internationalen Verkehr hingegen ließen die Gewinnspannen keinen zweiten Fahrer zu, was mir persönlich sehr recht war. In einem Punkt war das Gewerbe aber für die damalige Zeit sehr »modern« strukturiert: Die großen Speditionen wälzten das Risiko auf kleine Subunternehmer ab. Sie hatten schon damals oft keine eigenen Fahrzeuge mehr oder nur einige wenige für die lukrativsten Aufträge. Es gibt diese Konstellation heute noch: Auf dem Auflieger steht ganz groß der Name der seriösen Firma und auf der Fahrertür ganz klein der Name des Subunternehmers, der die Arbeit erledigt.
Das Herzstück einer großen Spedition bestand und besteht in einer guten Telefonanlage, einem guten Disponenten und dessen gutem Adressbuch. Der Disponent teilt die Fahrzeuge ein, telefoniert einerseits mit den Kunden, andererseits mit den Fahrern und koordiniert die Transportaufträge. Dieser Job wird sehr gut bezahlt. Nicht nur, weil er der wichtigste in der Spedition ist, sondern vor allem, weil jeder Spediteur immer Angst haben muss, dass der Disponent sonst wegläuft. Das wäre ja eigentlich nicht so schlimm, dumm ist nur, dass er dann auch sein Adressbuch mit den ganzen Kundenkontakten mitnimmt. Die Auftraggeber fühlen sich oftmals mehr den Disponenten persönlich verpflichtet als den Speditionen. Wechselt ein Disponent, nimmt er seine besten Kontakte (und die daraus resultierenden Aufträge) 0ft einfach mit.
Disponenten sind meistens gelernte Speditionskaufleute. In Fahrerkreisen erzählt man sich, dass die Lehrlinge in diesem Beruf im ersten Lehrjahr vor allem lernen, überzeugend zu lügen – und manche von ihnen bestätigen das auch. Dem Kunden wird etwa gesagt, dass »die Ware jeden Moment bei Ihnen auf den Hof rollen müsste«, auch wenn sie den Speditionshof noch gar nicht verlassen hat. Oder der Fahrer wird gefragt: »Kannst Du bitte mal eben da noch vorbeifahren und die zwei Kisten hinten drauf schmeißen«, auch wenn er weiß, dass die beiden Kisten so groß sind, dass der Wagen danach mit Überbreite ohne Genehmigung weiterfahren muss, niemand da ist, um beim Beladen zu helfen und der Umweg mehrere Stunden Fahrzeitüberschreitung bedeutet.
Die Subunternehmer wiederum waren damals oft windige Klitschen, viele Chefs standen mit einem Bein im Knast und dem anderen kurz vor der Pleite. »Hire and fire« war an der Tagesordnung, schriftliche Arbeitsverträge waren die absolute Ausnahme, und gesetzliche Vorschriften dienten bestenfalls als Küchenpapier. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Schon damals musste ich oft meinem Geld hinterherlaufen und habe die Arbeitsstelle gewechselt. Ich erinnere mich an einen Chef, der besonders krass war. Wir hatten oft Ladung für Andorra. Das Land kam mir vor wie ein einziger Duty-free-Shop, die Ladung bestand daher auch immer aus allem, was gut und teuer ist, Kameras oder Hi-Fi etwa. Der Chef stand kurz vor der Pleite, vergriff sich an der Ladung und vertickte viele Kartons unter der Hand an finstere Halbweltgrößen.
Heute würde ich sagen, dass es unverantwortlich war, ohne Erfahrung gleich diese Arbeit zu beginnen. Aber die Chefs hat das alle nicht gestört. Ich bekam einen Schlüssel in die Hand gedrückt und sollte 24 Tonnen Altpapier von Hamburg nach Bordeaux fahren. Darüber, was bis heute so an sinnlosen Sachen kreuz und quer durch Europa reist, wird noch zu reden sein.
In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre habe ich dann die Sparte gewechselt und bin seitdem nur noch für Textilspeditionen gefahren. Die Branche wird oft auch mit dem zynischen Begriff »Lohnveredelung« beschrieben: Materialien aus dem reichen Norden werden in Länder transportiert, wo Menschen für einen Apfel und ein Ei die gesamte Arbeit erledigen. Die Ware verlässt einzeln, auf Bügeln mit Plastiküberzug und mit einem deutschen Sticker versehen, so wie man sie dann im Kaufhaus vorfindet, die Fabrik. Das ist zum Fahren relativ angenehm, da man erstens nie hohes Gewicht und zweitens keinen Ärger mit Plane und Gestänge hat, was zum Be- oder Entladen gelegentlich mühsam abgebaut werden muss. So macht man lediglich die Tür auf, setzt zurück an die Rampe, und das war’s. Die Textilauflieger haben Kofferaufbauten, also feste Außenwände statt einer Plane. Die Innenwände sind perforiert und bieten Platz für hundert Eisenstangen, die in jeder beliebigen Höhe quer eingerastet werden können. Auf denen hängen dann die Bügel mit Jacken, Röcken, Hosen oder Kinderkleidung.
Die Produktionsstätten lagen in Portugal, Spanien, Süditalien, Jugoslawien, Rumänien, Griechenland oder der Türkei. Heute haben sich die meisten Ziele weiter nach außen verschoben. Die Textilproduktion für die heimischen Märkte findet immer weniger in EU-Ländern statt, sondern in Moldawien, Albanien, Weißrussland, Marokko, Tunesien und natürlich nach wie vor in Asien. Im Bereich der Textilspeditionen war der Markt damals unter wenigen Großen aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Österreich und der Türkei aufgeteilt. Ich fuhr für einen Subunternehmer in Eichstätt und der wiederum für eine große Spedition aus Norddeutschland. Die Ziele waren die Türkei, Jugoslawien und Rumänien. Damals hatten die Trips hinter den Eisernen Vorhang noch etwas von Abenteuer. Handys gab es nicht, und das sozialistische Telefonnetz konnte man getrost vergessen, von Satellitenpeilung ganz zu schweigen. Man war also über viele Tage weder für den Chef aus Eichstätt noch für den Disponenten aus der Zentrale in Osnabrück erreichbar.
Ich erinnere mich an eine lustige Szene, das muss 1988 gewesen sein. An der Grenze zwischen Ungarn und der Tschechoslowakei stutzte ein Grenzer über die zwei verschiedenen Verantwortlichen in Osnabrück und in Eichstätt. Ich erklärte ihm das mit Händen und Füßen so: »Wenn ich ausgeladen habe, muss ich zweimal telefonieren: Einmal nach Osnabrück, die sagen mir, wo ich Rückladung bekomme, und einmal nach Eichstätt, von da kriege ich mein Geld.« Weil der Grenzer rätselnd guckte, fragte ich ihn, ob er das verstanden habe, und er antwortete: »Ja, ich schon verstanden. Perestroika! Zweimal telefonieren!«
In Eichstätt hatte ich einen meiner beiden nettesten Chefs der Welt, dessen Name ich hier gerne nenne: Michael Osiander. In jungen Jahren war er lange Zeit selbst gefahren und das hatte er nicht vergessen. Er tat alles, um seinen Fahrern die Arbeit leichter zu machen. Er war sehr konservativ und katholisch und zugleich sehr menschlich, tolerant und kollegial. Es kam vor, dass ich – eilig wie immer – auf der Durchreise von Istanbul nach Osnabrück keine Zeit fand, den Umweg über Eichstätt zu fahren. Dann habe ich an der Autobahnraststätte vierzig Kilometer entfernt Pause gemacht. Er kam dorthin, hat am Auto dies und das repariert und mich erst danach mit frischem Kaffee geweckt. Nach allen Erfahrungen davor und fast allen danach erscheinen mir solche Chefs wie eine vom Aussterben bedrohte Art.
In einige der damaligen Ostblockländer bin ich erst nach zwanzig Jahren wieder gekommen, und zwar wieder mit dem Lkw. Was sich geändert hat und ob auch noch etwas gleich geblieben ist, auch darüber wird noch zu reden sein.
Ende 1988 habe ich den Fernfahrerberuf dann wegen Rückenproblemen an den Nagel gehängt. Ich habe eine Ausbildung gemacht, bin Journalist geworden und habe für den Hessischen Rundfunk Radio gemacht. Doch 1996 holte mich die Vergangenheit wieder ein. Als ich die Stellenanzeige sah, wusste ich, dass ich den Job haben will und auch bekommen werde: »Hessisches Kultusministerium sucht pädagogischen Mitarbeiter mit Lkw-Fahrpraxis«. Das »Kulturmobil« ist ein Showtruck, der immer für mehrere Tage auf einem Schulhof irgendwo in Hessen aufgebaut wird und der Lehrerfortbildungen anbietet. Für den Auflieger wurde ein Prototyp in Auftrag gegeben, den man auf die doppelte Breite ausfahren kann. Die Inneneinrichtung wurde geld-spielt-keine-Rollemäßig ausgestattet. Ein Lkw, der seine Funktion erfüllt, während er steht, ist eine große Ausnahme und eine angenehme Sache für den »Fahrer«. Auch hatte ich während dieser Zeit den zweiten nettesten Chef der Welt, Roland Kunkel. Er war eben kein Fuhrunternehmer, sondern Pädagoge. In den gesamten zwei Jahren musste ich nicht ein einziges Mal auf Anweisung gegen irgendwelche Gesetze verstoßen, das war für mich eine völlig neue Erfahrung. Ich wurde allerdings auch nicht ein einziges Mal in den zwei Jahren angehalten und kontrolliert, man sah dem Truck die Behörde auf zehn Kilometer Entfernung an. Geschlafen habe ich nicht in der Fahrerkabine, sondern in Hotels. Nach zwei Jahren hatte ich allerdings die Nase voll vom ständigen Unterwegs-Sein und hängte den Fernfahrerberuf ein zweites Mal für immer an den Nagel, wie ich dachte.
Aber es kam anders. Viele Jahre später rettete mich dieser Beruf als letzte Lösung aus der Arbeitslosigkeit. Nach der Jahrtausendwende wurden nicht nur in Deutschland Fernfahrer gesucht, der Berufsstand kämpfte mit Nachwuchsproblemen: Immer weniger junge Leute entscheiden sich für die immer umfangreichere und teurere Ausbildung zum Fernfahrer. Ich knüpfte also an meine alten Erfahrungen an und begann bei einem Subunternehmer, der im Auftrag einer Aschaffenburger Textilspedition die Strecke Barcelona-Mönchengladbach im Linienverkehr fuhr. Der entpuppte sich jedoch schnell als betrügerischer Pleitegeier. Heute denke ich, er hatte von vornherein gar nicht vor, mich zu bezahlen. Als ich nach sechs Wochen noch kein Geld gesehen hatte, habe ich gleich wieder dort aufgehört.
Überhaupt hat sich in den Jahren viel weniger geändert, als ich es angesichts der zahlreichen neuen nationalen und europaweiten Gesetze zu Arbeitszeiten, Sicherheitsbestimmungen und Arbeitnehmerrechten vermutet hätte. Nach wie vor wird in der Branche flächendeckend gegen Gesetze und Sicherheitsauflagen verstoßen; Vorschriften über Ruhezeiten, Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Sicherheitsauflagen für Fahrzeuge sind nach wie vor für etliche Spediteure nur etwas, was so clever und konsequent wie möglich umgangen werden sollte.
Die deutschen Spediteure haben vor der großen Finanzkrise laut geheult über die fehlenden qualifizierten Fahrer. Gleichzeitig haben sie aber nur sehr geringe Löhne gezahlt. Daher habe ich es wie viele andere Kollegen gemacht: Ich bin ausgewandert. In einem Job, bei dem man sowieso nie zu Hause ist, ist es schließlich auch egal, ob der Arbeitgeber um die Ecke wohnt oder in Urundi Bimbamba. Ich erinnerte mich an eine niederländische Firma, die ich noch von früher kannte und bekam dort auch sofort Arbeit. Diese Firma transportiert unter anderem Textilien. Die geschlossenen Kofferauflieger bieten sich aber auch an für Werttransporte wie Zigaretten und Computer. Manche Auflieger haben zudem ein Kühlaggregat und können daher verderbliche Ware befördern, wie zum Beispiel Obst und Gemüse oder Schnittblumen. In der paneuropäischen Truckersprache werden sie kurz Frigo genannt. Ich mag keine Frigos, denn zum einen steht man dort wegen des Terminguts noch mehr unter Zeitdruck und muss auch immer sonntags fahren, zum anderen macht das Kühlaggregat rund um die Uhr einen solchen Lärm, dass ich schlecht dabei schlafen kann.
In dieser Firma wird für jede Tour der Auflieger gewechselt, manchmal sogar während der Tour. Auf dem Rückweg aus Italien oder Marokko kommt einem dann auf halber Strecke jemand aus Holland entgegen, man wechselt die Trailer, bekommt neue Papiere und fährt wieder zurück. So kann es passieren, dass man wochenlang nicht nach Holland in die Firma kommt, nach Hause in die Wohnung erst recht nicht. Gelegentlich fährt man aber auch mal eine Woche lang in Holland, Belgien oder Deutschland be- und entladen. Im Sommer hatte ich diese seltenen »Heimspiele« ganz gern, da es im Mittelmeerraum eine schweißtreibende Angelegenheit sein kann, sich permanent in der Blechkiste aufhalten zu müssen.
Bevor wir nun auf große Tour gehen, möchte ich noch einige Worte verlieren über die mittlerweile in der gesamten EU geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu den Lenk- und Ruhezeiten. Sie wurden nicht nur zum Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer erlassen, sondern auch zu meinem eigenen.