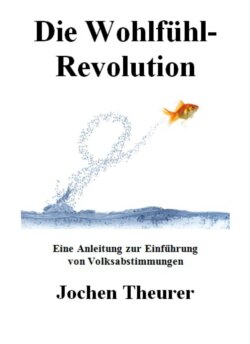Читать книгу Die Wohlfühl-Revolution - Jochen Theurer - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eine rein parlamentarische Demokratie funktioniert nicht
ОглавлениеErstaunlich ist deshalb nicht, dass die Berufspolitiker egoistisch handeln, sondern dass das durch das geltende Wahlrecht nicht verhindert wird. Denn offiziell ist Deutschland ja eine „parlamentarische Demokratie“. Dahinter steckt die Idee, dass es bei 80 Millionen Menschen praktisch unmöglich ist, zu jeder politischen Frage eine Volksabstimmung zu machen. Deshalb wählen sich die Menschen eine kleine Gruppe von Vertretern, die für sie die Gesetze beschließen. Und die Volksvertreter lassen sich dabei ausschließlich vom Wohl des Volkes leiten und nicht von ihren eigenen Interessen.
In der Theorie klingt das ganz vernünftig. In der Praxis funktioniert das aber nur dann, wenn die Abgeordneten auch tatsächlich zum Wohl des Volkes handeln. Doch warum sollten sie das tun? Dafür gibt es eigentlich nur zwei Gründe: Entweder sind die Abgeordneten davon überzeugt, dass sie ihre eigenen Interessen zurückstellen müssen und handeln deshalb freiwillig zum Wohl des Volkes. Oder sie werden durch Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten dazu gezwungen.
Solche Sicherungen gibt es auch in Deutschland. Die Bundestagsabgeordneten werden nur für jeweils vier Jahre gewählt. Dadurch sollen die Menschen die Chance haben, unfähige und egoistische Abgeordnete wieder loszuwerden. Zudem können Gesetze, die nicht dem Grundgesetz entsprechen, vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben werden. Dass die Berufspolitiker trotzdem so oft egoistisch handeln, liegt hauptsächlich daran, dass diese Mechanismen in der Praxis nicht sonderlich effektiv sind.
Das Bundesverfassungsgericht darf nicht von sich aus jedes Gesetz prüfen. Viele Gesetze landen daher nie vor dem Bundesverfassungsgericht und gelten deshalb weiter, obwohl sie gegen das Grundgesetz verstoßen. Es gibt auch keine Möglichkeit, unfähige und egoistische Abgeordnete vorzeitig zu entlassen. Die Berufspolitiker sind in den vier Jahren ihrer Amtszeit praktisch unangreifbar.
Die härteste Sanktion ist die Aussicht, nicht wiedergewählt zu werden. Doch auch hier gibt es ein Schlupfloch. In Deutschland werden nämlich nur 50 Prozent aller Bundestagsabgeordneten direkt von den Menschen gewählt. Das sind die Kandidaten, die sich in einem Wahlkreis für das „Direktmandat“ bewerben. Um in den Bundestag zu kommen, muss ein Direktkandidat in seinem Wahlkreis mehr (Erst-)Stimmen erhalten, als alle anderen Kandidaten. Die Wähler in einem Wahlkreis können daher einen ungeeigneten Direktkandidaten verhindern. Allerdings wird die andere Hälfte der Bundestagsmandate über „Landeslisten“ vergeben.
Die Landeslisten können nur von politischen Parteien eingereicht werden. Die Landeslisten enthalten die Namen von Politikern der jeweiligen Partei in einer bestimmten Reihenfolge. Je mehr Zweitstimmen eine Partei bei der Bundestagswahl erhält, desto mehr ihrer Bewerber ziehen über die Landeslisten in der dort festgelegten Reihenfolge in den Bundestag ein.
Da nur die politischen Parteien bestimmen, wer auf der Landesliste kandidieren darf, kommen mit Hilfe der Landesliste auch solche Personen zu Abgeordnetenmandaten, die im Volk niemand haben will. Die Menschen können einen unfähigen oder gemeinwohlschädlichen Abgeordneten deshalb nur dann abstrafen, wenn er als Direktkandidat antritt, ohne über die Landesliste abgesichert zu sein. Dieses Risiko geht aber kaum ein Berufspolitiker ein, der um seine Wiederwahl fürchtet.
Im Übrigen ist die persönliche Abwahl eines ungeliebten Abgeordneten auch eher unrealistisch. Denn die meisten Menschen kennen weder „ihren“ Wahlkreisabgeordneten, noch wissen sie, wie er bislang im Bundestag abgestimmt hat und welche Positionen er eigentlich vertritt. Deshalb wählen fast alle Menschen mit ihrer Erststimme den Kandidaten der von ihnen bevorzugten Partei.
In der Realität wird auch kaum jemand der von ihm favorisierten Partei seine (Zweit-)Stimme deshalb verweigern, weil auf der Landesliste unfähige Berufspolitiker ganz oben stehen. Die Menschen in Deutschland wählen Parteien, nicht Personen. Deshalb braucht der einzelne Berufspolitiker nicht befürchten, persönlich abgestraft zu werden. Er kann sich immer hinter seiner Partei verstecken. In der Wahrnehmung der meisten Menschen entscheiden Parteien und nicht einzelne Abgeordnete.
Die Landeslisten sind somit ein effektives Mittel, wie sich unfähige und unbeliebte Berufspolitiker in den Bundestag mogeln können. Die theoretische Möglichkeit einer Abwahl ist deshalb kein sonderlich abschreckendes Szenario für einen Berufspolitiker.
Infolgedessen hängt es allein von den Bundestagsabgeordneten ab, wie sie sich entscheiden. Wenn sie überzeugt sind, dass das Gemeinwohl an erster Stelle stehen muss, können sie sich entsprechend verhalten. Wenn sie dagegen ihre eigenen Interessen als wichtiger bewerten, können sie egoistisch handeln. Und genau das ist das Problem in Deutschland.
Es hängt allein vom guten Willen der Berufspolitiker ab, ob sie zum Wohl des Volkes handeln oder nicht. Das System der „parlamentarischen Demokratie“ ist in Deutschland deshalb nur formal etabliert. Der rechtfertigende Grund, warum die Menschen die Entscheidungen der Abgeordneten akzeptieren sollen, ist jedoch nicht gegeben. Denn das geltende Wahlrecht führt dazu, dass vor allem unfähige Egoisten als Abgeordnete in den Bundestag einziehen.
Die meisten Berufspolitiker nutzen das Abgeordnetenmandat, um möglichst viele finanzielle und soziale Vorteile für sich herauszuschlagen.
Das zeigt sich ganz offenkundig, wenn es darum geht, die Diäten zu erhöhen. Bei Diätenerhöhungen gibt es nie Streit zwischen den Abgeordneten der verschiedenen etablierten Parteien. Vielmehr versuchen sie, Diätenerhöhungen so heimlich und geräuschlos wie möglich über die Bühne zu bringen, so dass es keinen empörten Aufschrei in der Öffentlichkeit gibt. Diätenerhöhungen werden deshalb meist dann beschlossen, wenn gerade ein anderes Thema die öffentliche Wahrnehmung dominiert.
Das Argument für die übermäßigen Diätenerhöhungen ist immer dasselbe: Man müsse einen Anreiz für gute Leute schaffen. Dabei wird aber geflissentlich übersehen, dass die wirklich guten Leute in der freien Wirtschaft wesentlich mehr verdienen und es ja gerade nicht die „High Potentials“ sind, die in den Bundestag gewählt werden. Zudem sollen die Diäten ja nicht der Hauptanreiz sein, ein Bundestagsmandat zu erringen.
Primäres Ziel sollte sein, das Wohl des deutschen Volkes zu mehren. Im Grundgesetz ist auch nur die Rede von „Entschädigung“. Es wäre deshalb völlig ausreichend, wenn jeder Abgeordnete soviel bekommt, wie er vor seiner Wahl durchschnittlich verdient hat. Denn nur insoweit entsteht ihm durch den Verdienstausfall ja ein „Schaden“. Doch das stünde im Widerspruch zu dem Hauptmotiv der meisten Bundestagsabgeordneten – die finanzielle Situation durch das Mandat zu verbessern.
Aber auch sonst nehmen die Berufspolitiker alles mit, was geht. Man denke nur an den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Als der nach dem Aufdecken diverser Lügen und Halbwahrheiten im Zusammenhang mit besonders günstigen Privatkrediten, gesponserten Hotelübernachtungen und kostenlosen Urlauben wegen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn zurücktrat, begründete er seinen Rücktritt mit „politischen Gründen“.
Das war zwar blanker Unsinn - die Rücktrittsgründe beruhten schließlich allesamt auf privaten Angelegenheiten -, aber doch ziemlich clever. Denn dadurch konnte er nach einem Jahr im Amt den „Ehrensold“ in Höhe von 199.000 Euro (ab 2013: 217.000 Euro) einsacken, den alle ehemaligen Bundespräsidenten bis an ihr Lebensende jährlich bekommen. Selbstverständlich hätten ihm die anderen Berufspolitiker den Ehrensold auch ohne weiteres streichen können.
Allerdings wäre dadurch ein unerwünschter Präzedenzfall geschaffen worden. In Zukunft wäre es dann nämlich möglicherweise regelmäßig zu der Forderung gekommen, Versorgungsansprüche der Berufspolitiker wegen persönlichen Fehlverhaltens zu kürzen oder zu streichen. Und daran hat kein Berufspolitiker ein Interesse. Dementsprechend waren sich die Berufspolitiker auch über Parteigrenzen hinweg einig, dass Christian Wulff seinen „Ehrensold“ in voller Höhe erhalten soll.
Dass es den Berufspolitikern in erster Linie um die finanziellen Vorteile des Abgeordnetenmandats geht, zeigt sich auch daran, dass sie alles tun, um die eigene Wiederwahl zu sichern. Dazu ist es unbedingt erforderlich, dass sie von ihrer Partei weiter unterstützt werden. Folglich tun sie alles, um es sich mit der Parteiführung nicht zu verscherzen.
Aus Angst vor dem Verlust des Mandats bezahlen die Abgeordneten zum Beispiel die von den Parteien geforderten „Abgeordnetenbeiträge“. Jede der etablierten Parteien verlangt von ihren Abgeordneten, dass diese einen Teil ihrer Diäten (meistens zwischen 10 und 20 Prozent) an die Partei „spenden“. Darauf besteht zwar kein rechtlicher Anspruch, doch die Drohung, nicht wieder aufgestellt zu werden, genügt. In der Praxis weigern sich nur die Abgeordneten, die nicht mehr kandidieren wollen oder deren innerparteiliche Karriere aus anderen Gründen zu Ende ist.
Innerhalb der etablierten Parteien ist es auch ein ungeschriebenes Gesetz, dass niemand unterstützt wird, der irgendwie als „Nazi“ verdächtig ist. Berufspolitiker fürchten deshalb nichts so sehr, wie in die rechte Ecke gestellt zu werden. Um die Wiederwahl zu sichern, unterwerfen sie sich deshalb regelmäßig einer objektiv völlig irrationalen „political correctness“.
In vielen Kirchen gab es früher Figuren in Gestalt von afrikanischen Kindern. Wenn man eine Spende in die Öffnung warf, bedankte sich die Figur durch ein Kopfnicken. Genauso verhalten sich heute viele Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Obwohl sie nach dem Willen des Grundgesetzes eigentlich selbstbewusste Vertreter des deutschen Volkes sein sollten, lassen sie sich regelmäßig zu willenlosen „Nicknegerchen“ degradieren.
Der augenfälligste Beweis dafür ist der „Fraktionszwang“. Obwohl die Abgeordneten nach dem Grundgesetz nicht an Weisungen gebunden und nur ihrem Gewissen verpflichtet sind, fügen sie sich fast immer den Vorgaben der Partei- und Fraktionsführung. Abweichler sind extrem selten. Wer ankündigt, gegen ein aus Sicht der Parteiführung wichtiges Vorhaben zu stimmen, wird vorab entsprechend bearbeitet. Wer sich trotzdem nicht fügt, dem wird angedroht, bei der nächsten Wahl keinen sicheren Listenplatz oder Wahlkreis mehr zu bekommen. Da ein Verlust des Mandats für die meisten Abgeordneten einen finanziellen und sozialen Abstieg bedeuten würde, ist diese Drohung sehr effektiv. In der Realität gibt es jedenfalls kaum Abweichler.
Zur Rechtfertigung des Fraktionszwangs wird von den Parteiführern immer vorgebracht, dieser sei erforderlich, um eine effektive Parlamentsarbeit und die Funktionsfähigkeit der Regierung sicherzustellen. Nun mag es durchaus sein, dass ein Bundeskanzler seine Leute leichter bei der Stange halten kann, wenn er sie bedrohen lässt. Aber das kann doch nicht einen Verfassungsbruch rechtfertigen.
Jeder „einfache“ Bürger würde für dieses Verhalten wegen Nötigung bestraft. Korrekterweise müssten die Parteichefs die Bundestagsabgeordneten inhaltlich überzeugen – oder bestimmte Gesetze werden eben nicht beschlossen. Letzteres wäre angesichts der bereits mehr als 100.000 Normen allein auf Bundesebene ohnehin nicht die schlechteste Alternative.
Allerdings haben die Bundestagsabgeordneten bislang noch nie ernsthaft gegen den Fraktionszwang protestiert (oder ihn gesetzlich ausdrücklich verboten). Das ist aber nicht weiter verwunderlich, denn da es den meisten Abgeordneten in erster Linie sowieso nur um ihre finanzielle Absicherung geht, ist ihnen der Inhalt der Gesetze in der Regel egal (sofern sie nicht die Chance der Wiederwahl gefährden).
Abgeordnete wissen deshalb oft nicht einmal, worüber sie eigentlich abstimmen.
Am 24. April 2008 stimmte der Bundestag über den „Vertrag von Lissabon“ ab. Durch den „Vertrag von Lissabon“ sollte die von den Menschen in Frankreich und Irland in Volksabstimmungen abgelehnte „EU-Verfassung“ inhaltlich doch noch umgesetzt werden. Diesmal jedoch nicht durch ein einzelnes Dokument, sondern heimlich, indem viele kleine Änderungen in die bestehenden EU-Verträge eingeführt wurden. Der „Vertrag von Lissabon“ bestand deshalb nicht aus einem sinnvollen, zusammenhängenden Text, den man durchlesen und verstehen konnte, sondern er enthielt auf 32 Seiten Fragmente der folgenden Art:
34) Ein Artikel 15b mit dem Wortlaut des Artikels 23 wird eingefügt, der wie folgt geändert wird:
a) […]
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
i) […]
ii) Im bisherigen zweiten Gedankenstrich, der dritter Gedankenstrich wird, werden die Worte „Beschluss zur Durchführung einer gemeinsamen Aktion oder eines gemeinsamen Standpunkts fasst“ ersetzt durch „Beschluss zur Durchführung eines Beschlusses, mit dem eine Aktion oder ein Standpunkt der Union festgelegt wird, erlässt,“.
Um zu verstehen, was das konkret bedeutet, hätte man immer die jeweiligen EU-Verträge daneben legen und vergleichen müssen. Erst eine Woche vor der Abstimmung im Bundestag erhielten die Abgeordneten eine „konsolidierte“ Fassung der EU-Verträge (also eine Fassung der Verträge, wie sie durch den „Vertrag von Lissabon“ geändert würden). Diese Fassung war 479 Seiten stark.
Obwohl kein Abgeordneter innerhalb einer Woche diesen Text sinnvoll begreifen konnte (Verfassungsjuristen benötigten dafür mehrere Monate), regte sich kein Widerstand. Klar war nur, dass dadurch erhebliche Souveränitätsrechte von Deutschland auf die EU übertragen werden würden.
Trotzdem verlangte kein Abgeordneter mehr Bedenkzeit. Bei der Abstimmung konnten die meisten Abgeordneten deshalb gar nicht wissen, welche Folgen das genau haben würde – und dennoch stimmten sie mit überwältigender Mehrheit zu.
Das gleiche Phänomen zeigt sich im Zusammenhang mit der „Euro-Rettung“. Dabei geht es um hunderte von Milliarden Euro, die Deutschland möglicherweise bezahlen muss. Trotzdem nickten die Abgeordneten bislang brav alle Vorlagen der Regierung im Rekordtempo ab, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht.
So stimmte der Bundestag zum Beispiel am 29. September 2011 der Erhöhung des „Euro-Rettungsschirmes“ EFSF zu. Dadurch erhöhte sich die Haftung Deutschlands für Kredite an überschuldete Euro-Länder von 123 Milliarden Euro auf 211 Milliarden Euro. Obwohl Deutschland dadurch praktisch mehr als 2/3 seines Bundeshaushalts verpfändete, wussten viele Abgeordnete am Tag der Abstimmung nicht einmal die ungefähre Summe, um die es geht. Aber die Kanzlerin hatte das ganze als „alternativlos“ bezeichnet und so stimmten die Abgeordneten zu.
Die Abgeordneten haben auch keine Probleme damit, sich selbst zu entmachten. Immer wieder beschließen sie, die Kompetenzen des Bundestages zu beschränken oder auf andere Institutionen zu übertragen. So hatten sie zum Beispiel durch die Zustimmung zum „Vertrag von Lissabon“ zugleich eingewilligt, dass die EU künftig selbständig weitere Souveränitätsrechte von den Nationalstaaten auf sich übertragen kann, also ohne dass der Bundestag dem zustimmen muss.
Am 9. Oktober 2011 hatten die Abgeordneten beschlossen, dass künftig nicht mehr der gesamte Bundestag darüber entscheiden soll, ob im Zuge der „Euro-Rettung“ viele Milliarden Euro deutscher Steuergelder verpulvert werden. Vielmehr sollte es genügen, wenn ein Sondergremium von 9 Abgeordneten zustimmt.
Diese wiederholten Selbstentmachtungen der Abgeordneten erklärte das Bundesverfassungsgericht zwar jeweils für verfassungswidrig. Der Bundestag muss auch weiterhin einer Übertragung von Souveränitätsrechten auf die EU zustimmen und milliardenschwere „Rettungspakete“ selbst beschließen. Daran zeigt sich jedoch deutlich, dass es den meisten Abgeordneten im Grunde völlig egal ist, welche Rechte der Bundestag hat. Ihnen kommt es nur darauf an, im Parlament zu sitzen und Diäten zu kassieren. Solange die Wiederwahl nicht gefährdet ist, wird alles abgenickt, was die Parteiführung vorgibt.
Um ihre Privilegien zu behalten, missbrauchen die Berufspolitiker sogar die Möglichkeiten, die sie als Bundestagsabgeordnete und Inhaber aller wichtigen öffentlichen Ämter haben. Dadurch beherrschen sie den gesamten Staat und können ihre Macht absichern. Das bekannteste Symptom dafür ist die „Ämterpatronage“.
Nach dem Grundgesetz dürfen öffentliche Ämter, also die Stellen in der Verwaltung und bei den Gerichten, nur nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung der Bewerber vergeben werden. Die Berufspolitiker nutzen jedoch ihren Einfluss und die gesetzgeberischen Möglichkeiten, um möglichst viele ihrer Parteifreunde auf staatlichen Posten unterzubringen. Das geht von den Gerichten, über die staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten bis hin zu vielen tausenden Stellen in der Verwaltung.
Für die Berufspolitiker hat das den Vorteil, dass sie ihre Machtpositionen sichern, indem sie loyale Mitstreiter auf wichtige Positionen hieven. Zudem können „verdiente“ Parteisoldaten belohnt oder, falls sie ihren bisherigen Posten verloren haben, versorgt werden.
Die Folge davon ist, dass besser qualifizierte Bewerber nur aufgrund des fehlenden oder „falschen“ Parteibuchs nicht zum Zuge kommen. Zudem sind die Profiteure der Ämterpatronage dem, der sie gewährt, zu Dank verpflichtet. Auf der Strecke bleiben dabei regelmäßig die Interessen der Allgemeinheit.
Gegen solche offenkundigen Mauscheleien gibt es keine gesetzlichen Verbote. Obwohl in Deutschland nahezu jeder Lebensbereich umfassend durchnormiert ist, klaffen ausgerechnet in Bezug auf das Handeln der Berufspolitiker große Lücken.
Warum gibt es keine Sanktionen, wenn die Berufspolitiker ein verfassungswidriges Gesetz beschließen, das vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben wird? Warum ist es nicht strafbar, wenn die Berufspolitiker ihre eigenen Interessen entgegen dem Grundgesetz über das Wohl des deutschen Volkes stellen? Warum werden Wahllügen oder unverantwortliches Schuldenmachen nicht bestraft?
Es gibt viele Länder, in denen die Berufspolitiker im Fall von Amtsmissbrauch für die Auswirkungen ihres Handelns persönlich zur Verantwortung gezogen werden können. Nicht jedoch in Deutschland.
Hier macht sich ein Abgeordneter ausnahmsweise nur dann strafbar, wenn er sich für eine konkrete Abstimmung im Bundestag bezahlen lässt. Erlaubt ist es dagegen, einem Abgeordneten „einfach so“ Geld zu geben, quasi zur „Pflege der politischen Landschaft“. Erlaubt ist es auch, einen Abgeordneten dafür zu belohnen, dass er in seiner Fraktion für ein bestimmtes Gesetz wirbt oder in einem Bundestagsausschuss, in dem die eigentliche Gesetzesarbeit gemacht wird, dafür stimmt.
Diese Missstände sollten eigentlich durch die UN-Konvention gegen Korruption (UNCAC) behoben werden. Die deutschen Berufspolitiker haben die Konvention bereits im Jahr 2003 unterzeichnet. Geändert hat sich seither jedoch nichts. 2011 weigerten sich die Bundestagsabgeordneten, den Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung so zu erweitern, dass er auch „das verwerfliche Beeinflussen eines Abgeordneten bei der sonstigen Wahrnehmung seines Mandats“ erfasst.
Berufspolitiker quer durch alle etablierten Parteien schrecken nicht einmal davor zurück, bewusst gegen Gesetze zu verstoßen, wenn das dem eigenen Vorteil und der (Wieder-)Wahl dient. Viele Skandale und Affären legen davon ein beredtes Zeugnis ab: Flick, Barschel, Leuna, die bayerischen Amigos, der CDU-Spendenskandal mit schwarzen Konten, angeblichen jüdischen Vermächtnissen und Helmut Kohls „Ehrenwort“, die Bonusmeilen-Affäre usw.
Dass insoweit aber kaum ein Berufspolitiker je ins Gefängnis muss, hängt mit einer Bestimmung im Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) zusammen. Nach § 146 GVG unterstehen die Staatsanwälte der Weisungsbefugnis des jeweiligen Landesjustizministers. Da dieser in der Praxis immer einer der etablierten Parteien angehört, können Ermittlungen gegen Kollegen leicht und leise verhindert werden. Die Staatsanwälte dürfen eine solche Weisung nämlich nicht öffentlich bekannt machen – andernfalls droht ihnen eine Bestrafung wegen Verrats von Dienstgeheimnissen.
Die Berufspolitiker beteuern zwar immer, diese Befugnis nicht zu nutzen – abschaffen wollen sie sie aber gleichwohl nicht. Die Berufspolitiker stellen sich dadurch außerhalb der für alle geltenden Gesetze.
All diese Missstände führen dazu, dass die Legitimationsvoraussetzungen der parlamentarischen Demokratie in Deutschland heute nicht mehr gegeben sind. Die Berufspolitiker richten weder ihr Verhalten freiwillig ausschließlich am Gemeinwohl aus, noch können sie durch die auf dem Papier existierenden Kontroll- und Sanktionsmechanismen effektiv dazu gezwungen werden.
Natürlich ließe sich das ändern. Das Wahlsystem könnte so reformiert werden, dass verstärkt charakterlich und fachlich kompetente Personen einen Anreiz hätten, sich für ein Bundestagsmandat zu bewerben. Dazu müsste man jedoch die Macht der etablierten Parteien hinsichtlich der Verteilung der Bundestagsmandate brechen. Eine Kandidatur müsste auch ohne die langjährige Ochsentour erfolgreich sein können.
So würde zum Beispiel durch die Abschaffung der Landeslisten den etablierten Parteien ein wichtiges Machtmittel genommen. Wenn jeder Kandidat dieselben Ressourcen für den Wahlkampf zur Verfügung hätte, wäre viel an Chancengerechtigkeit gewonnen. Das könnte man zum Beispiel dadurch erreichen, dass jeder Kandidat nur eine bestimmte Summe ausgeben darf.
Oder indem jeder Bewerber in einem Wahlkreis seine wichtigsten Positionen schriftlich auf fünf Seiten darlegen kann. Aus den Texten aller Bewerber in einem Wahlkreis könnte man eine Broschüre erstellen, die an jeden Wähler im Wahlkreis verteilt wird. Dann könnten sich die Wähler ein inhaltliches Bild von allen Kandidaten verschaffen. Im Gegenzug wären alle übrigen Wahlkampfveranstaltungen, Wahlplakate und Fernsehauftritte verboten. Einzig öffentliche Fragerunden, bei denen alle Bewerber eines Wahlkreises zugelassen sind, würden noch stattfinden.
Dann hätten auch solche Bewerber eine Chance, die sich nicht jahrelang dem Parteiapparat angedient haben oder die vielleicht in den Medien nicht ganz so gut rüberkommen, aber dafür eine gute inhaltliche Arbeit machen und das Wohl der 80 Millionen „einfachen“ Menschen berücksichtigen.
Die Diäten könnten auf das durchschnittliche Einkommen begrenzt werden, das ein Abgeordneter vor seiner Wahl erzielt hat (ggf. mit Mindest- und Höchstgrenzen). Wenn Abgeordnete keine bezahlten Nebentätigkeiten ausüben dürften oder alle weiteren Einnahmen auf die Diäten angerechnet würden, sänke der Anreiz, sich aus finanziellen Motiven in den Bundestag wählen zu lassen. Denselben Effekt hätte es, wenn kostenlose Leistungen von Lobbyisten an Berufspolitiker wie Urlaube, günstige Kredite usw. verboten und für beide Seiten strafbar wären.
Berufspolitiker, die vorsätzlich öffentlich lügen oder ihren Amtseid verletzen, könnten wegen Amtsmissbrauch strafrechtlich verurteilt werden. Zudem könnten sie für die Folgen ihrer Entscheidungen persönlich mit ihrem eigenen Vermögen haften.
Jede dieser Maßnahmen würde bewirken, dass es für unfähige Egoisten weniger attraktiv wäre, Berufspolitiker zu werden. Dann bestünde die Chance, dass Menschen in die Parlamente einziehen, denen es nicht vor allem um ihre persönlichen Interessen geht, sondern um das Wohl der Allgemeinheit. Und solche Menschen gibt es.
Derzeit engagieren sie sich jedoch entweder außerhalb der Politik oder sie resignieren und finden sich mit dem bestehenden Zustand ab. Doch das kann unter geänderten Rahmenbedingungen sehr schnell anders werden. Welches Potential insoweit vorhanden ist, zeigen zum Beispiel die Vorgänge um Stuttgart 21. Wenn die Menschen eine reale Chance sehen, werden sie aktiv.
Doch natürlich setzen die Berufspolitiker keine dieser Maßnahmen gesetzlich um. Denn dadurch würden sie ja ihre eigenen Chancen schmälern, (wieder-)gewählt zu werden. Zudem bestünde die Gefahr, dass die Berufspolitiker ihre finanziellen und sonstigen Privilegien verlieren.