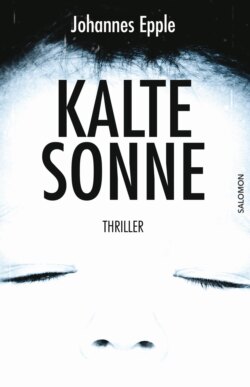Читать книгу Kalte Sonne - Johannes Epple - Страница 8
Anfang August, 2015 Lordtom99:\4\Wien_München_Hamburg:Neumann.docx
ОглавлениеDas Nachmittagslicht gab den Dingen eine sanfte Aura. Es nieselte, der Gehsteig war nass. Es roch nach verdampfendem Wasser und feuchtem Gras. Ich ging die Alser Straße hoch zum Gürtel und nahm die U6 zur Burggasse. In der Station kaufte ich ein Falafel-Sandwich und einen Ayran. Ich aß auf meinem Innenhofbalkon, startete mein Notebook und lud die Fotos von der Kleinen aus dem Kinderdorf hoch. Ein 14 Monate altes Mädchen, die Haare braun und noch etwas dünn, die Augen groß und blau.
Ich kontrollierte meine Mails und schrieb Tereza, der Pflegerin meiner Mutter, dass ich heute noch nach München fahren würde, um bei ihrem morgigen Umzug ins Pflegeheim dabei zu sein. Meine Mutter war fast achtzig und wurde langsam senil. Vergangene Woche hatte sie vom Supermarkt, in den sie seit zwanzig Jahren ging, nicht mehr heimgefunden. Da ich nach meinem Medizinstudium gleich die Stelle im Wiener Donauspital bekommen hatte und selten nach München kam, war sie die meiste Zeit auf sich gestellt. Seit drei Jahren kümmerte sich Tereza um das Nötigste, aber die war allmählich auch überfordert.
Die Fahrt nach München dauerte länger als sonst. In Salzburg geriet ich in den Abendverkehr. Erst bei Freilassing löste sich der Stau auf. Kurz nach acht Uhr bog ich in die Wohnsiedlung in Ottobrunn ein. Meine Mutter lebte gegenüber einem Fußballplatz in einem zweistöckigen Haus mit einem drei Meter breiten Grasstreifen als Garten und freiem Blick in das Badezimmer des Nachbarn. Seit dem Tod meines Vaters hatte die Pflege des Gartens stark gelitten. Die Hainbuchenhecken mussten längst geschnitten werden und der Kirschbaum war verwildert.
Im Haus stieg mir ein altbekannter Geruch in die Nase. Mein Vater war Imker gewesen, und zu seiner Arbeit hatte auch das Ausschmelzen der Bienenwaben gehört. Er erledigte diese Säuberungsaktionen jedes Jahr im Oktober immer wochentags, wenn ich in der Schule war, und meine Mutter ihrem Job im Sekretariat der örtlichen Zweigstelle einer Versicherung nachging.
Nichts, und ich meine absolut nichts, roch erbärmlicher als ausgeschmolzene Waben. Als Kind empfand ich den Geruch als ein olfaktorisches Inferno, für das ich mich vor meinen Schulfreunden schämte. Heute wurde ich rührselig, als ich im Vorraum meine Wildlederschuhe abstreifte und diesen Gestank in der Nase hatte. Es hatte wohl etwas mit Nostalgie und meinem schlechten Gewissen gegenüber meiner Mutter zu tun.
»Ich bin’s, Georg«, rief ich, als ich ins Wohnzimmer trat.
Meine Mutter sah sich eine Sendung über die Naturwunder Amerikas im Bayrischen Rundfunk an. Da sie auf meine Begrüßung nicht reagierte, rutschte ich neben ihr auf die Couch und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Mit leeren Augen starrte sie mich an. »Ich bin’s, Georg«, wiederholte ich.
Tereza tauchte in der Küchentür auf und schüttelte den Kopf. »Tagsüber war es gut«, sagte sie. »Wir waren in der Stadt beim Friseur, nicht wahr, Frau Neumann?«
Statt einer Antwort gab meine Mutter ein tiefes Gurgeln von sich. Mit halb offenem Mund starrte sie in eine Dimension jenseits von Raum und Zeit.
»Georg?« Sie sah zwischen Tereza und mir hin und her.
Tereza holte eine Tasse heiße Milch aus der Küche. »Schauen Sie, was ich hier habe«, sagte sie.
Meine Mutter lächelte wie ein fünfjähriges Mädchen vor dem Weihnachtsbaum.
Ich bat Tereza in die Küche. Ich war schockiert über den Zustand meiner Mutter. Bei meinem jüngsten Besuch hatte sie noch viel klarer gewirkt.
»Sie ist aufgeregt wegen Ihres Besuches. Es ist nicht immer so schlimm«, sagte Tereza.
Ich holte mir aus dem Kühlschrank ein kleines Bier und schnippte die Krone in den Mülleimer. »Ist sie noch zu einem normalen Gespräch fähig?«
»Kommt drauf an, was Sie darunter verstehen.«
»Ich habe Fragen.«
»Vielleicht morgen«, sagte Tereza.
Ich sah zum Küchenfenster hinaus. Im Nachbargarten schraubten zwei Burschen mit umgedrehten Baseballkappen an einem Quad. Im Hintergrund lief deutscher Hiphop. »Ich habe ein Foto von Helene«, sagte ich. »Ich will ihr damit eine Freude machen. Soll ich es ihr jetzt zeigen?«
»Schön, dass die Kleine wieder da ist. Der Stress nach der Entführung aus dem Krankenhaus hat Ihre Mutter schwer belastet.«
»Da meine Mutter nicht mehr dazu fähig ist, hat mich die Polizei ersucht, die Vormundschaft für Helene zu übernehmen.«
»Und?«
»Ich habe abgelehnt.«
Tereza kniff die Augen zusammen.
»Ich bin 46 Jahre alt. Ich lebe alleine und habe einen fordernden Beruf.«
Tereza verschränkte die Arme vor der Brust.
»Wo ist überhaupt der Vater?«, fragte ich. »Ist es nicht klüger, den Vater zu suchen, damit er Verantwortung für seine Tochter übernimmt?«
Tereza nickte. »Wenn Sie Ihrer Mutter das Foto zeigen wollen, machen Sie es jetzt. Sie wird sicher bald müde werden.«
Ich trank einen Schluck Bier und holte mein Notebook aus dem Wagen. Als ich zurückkam, blieb ich in der Wohnzimmertür stehen. Die Szene, die sich mir bot, war grotesk. Meine Mutter kniete vor dem Couchtisch, mit dem Gesicht in der Popcornschale, und schaffte es dabei auch noch, laut zu schnarchen. Scheinbar wirkte die Honigmilch auf sie wie ein starkes Sedativ. Tereza versuchte, sie hochzustemmen. »Normalerweise schläft sie um sieben Uhr abends. Routinen sind für sie wichtig. Mit Aufregung wie über Ihren Besuch kann sie schwer umgehen.«
Ich legte mein Notebook auf den Couchtisch und half Tereza, den schlafenden Körper auf die Couch zu heben. Dann zeigte mir Teresa die Untersuchungsergebnisse der vergangenen zwei Wochen und die Medikamente, die meine Mutter täglich nahm.
Während der Fahrt von Wien hierher war ich so auf das Foto von Helene konzentriert gewesen, dass ich mich nicht auf das Verhalten meiner Mutter vorbereitet hatte. Seit Weihnachten hatte ich sie nicht mehr gesehen. Das war fast vier Monate her.
Ich wusste nicht mehr genau, wann ich das Interesse an meiner Mutter verloren hatte. Seit über zehn Jahren lebte ich in Wien und arbeitete als Herz-Thorax-Chirurg im Donauspital. Dazu gehörte eine Sechzig-Stunden-Woche inklusive Wochenend- und Bereitschaftsdiensten. Zwischendurch hatte ich Beziehungen, wovon keine länger als ein Jahr gehalten hatte. Hätte mich meine Mutter nicht jede Woche angerufen, hätten wir uns ganz aus den Augen verloren. Wenn sie anrief, immer sonntags um 18 Uhr, war es stets dasselbe. Wie geht es dir? Was macht der Beruf? Wie ist das Wetter in Wien? Und ganz schlimm: Hast du Kleider für den Winter? Es wird kalt.
Beim Blick auf die schnarchende, mit Medikamenten vollgepumpte Frau wurde mir klar, dass Anrufe dieser Art wohl bald ausbleiben würden. Traurigkeit ergriff mich, eine Sehnsucht nach unserer Sonntagsroutine, nach Fragen, deren Sinn es war, eine Verbindung zwischen zwei einander fremd gewordenen Menschen herzustellen.
Gemeinsam mit Tereza trug ich meine Mutter in den ersten Stock. Alles war wie früher. Die dunkle Holzvertäfelung an der Decke machte das Schlafzimmer bedrohlich. Tereza und ich hievten meine Mutter ins Bett und zogen ihr den Bademantel aus. Sie öffnete die Augen und sah mich an. »Ich weiß schon, wer du bist«, sagte sie.
Es war ein eigenartiges Gefühl, die Nacht in meinem alten Zimmer zu verbringen. An den Wänden hingen Poster von Fußballern aus den 90er-Jahren. Im Schreibtisch fand ich Klassenfotos aus der Realschulzeit und leere CD-Hüllen. Tote Hosen, Bad Religion, H-Blocks. Dazwischen hingen Hiphop-Poster, die meine Halbschwester Miriam aufgehängt hatte. Nachdem ich Ende 1990 nach Wien gegangen war, hatte Miriam das Zimmer bewohnt. Miriam und ich hatten eine eher schwierige Beziehung. Wir hatten kaum Kontakt zueinander. Ich war der große Bruder und sie die Nachzüglerin. Ihre Existenz erinnerte mich immer an den frühen Herztod meines Vaters. Ich war damals erst 17 gewesen, und meine Mutter hatte kurz danach eine Liaison mit einem IT-Spezialisten gehabt, der zunächst nach Irland und von dort nach Cambridge gegangen war und sich weder bei meiner Mutter noch bei seiner Tochter Miriam je wieder gemeldet hatte.
Die Erinnerungen an meine Jugend hielten mich wach. Ich starrte an die Decke und lauschte den Regentropfen, die gegen das Fenster prallten. Um zwei und um vier Uhr morgens schrie meine Mutter und ich hörte Tereza durchs Haus eilen. Ich war froh, dass sie mich nicht um Hilfe bat.
Um sechs Uhr läutete mein Wecker. Beim Frühstück las ich am Handy ein paar Artikel. Um sieben Uhr stand die Sonne über den Dächern der Nachbarhäuser. »Wir müssen um neun im Altenheim sein«, sagte Tereza, die aufgeweckt wirkte, als hätte sie die ganze Nacht durchgeschlafen.
Im Zimmer meiner Mutter waren die Jalousien heruntergelassen. Am Nachtkästchen blinkte das rote Lämpchen des Notfallpiepsers, mit dem meine Mutter Tereza zu sich rufen konnte. Ein süßlicher Uringeruch hing in der Luft.
Tereza schaltete das Licht an und klatschte in die Hände. »Guten Morgen«, sagte sie. »Heute ist Ihr großer Tag.«
Meine Mutter gähnte. Meine Anwesenheit verwirrte sie offenbar. Sie griff nach Terezas Hand und zeigte auf mich.
»Er ist gestern gekommen«, sagte Tereza.
Wir machten sie zu zweit für den Tag fertig. Tereza kämmte ihre Haare, steckte sie in einen dunkelbraunen Hosenanzug und schminkte ihre Wangen. Während sie in der Küche mit zittrigen Fingern ein Rührei mit Toastbrot aß, holte ich mein Notebook. »Mama«, sagte ich und sah zu Tereza, die den Geschirrspüler einräumte. »Ich habe ein Foto hier, das ich dir zeigen möchte.«
»Von mir?«
»Nein. Von Miriams Tochter.«
»Miriam«, antwortete meine Mutter. »Miriam ist tot.«
Die Worte kamen mit kindlicher Naivität über ihre Lippen. Meine Mutter erinnerte mich an eine Fünfjährige, die ein ernstes Gespräch über Weihnachten führen wollte. Ich trank einen Schluck Orangensaft. »Miriam ist nicht tot«, sagte ich.
Meine Mutter sah zu Tereza. »Es hat ein Feuer gegeben«, sagte sie zu ihr.
Es wurde still im Raum. Meine Mutter rührte mit dem Löffel in ihrer Kaffeetasse. Tereza schaltete den Geschirrspüler ein und holte das Gepäck aus dem ersten Stock.
Ich rutschte mit dem Notebook näher an meine Mutter heran und öffnete den Ordner mit den Fotos aus dem Kinderheim in Strebersdorf. »Kennst du die Kleine?«
Meine Mutter strich mit zwei Fingern über das Gesicht des Mädchens am Bildschirm und flüsterte dabei etwas Unverständliches.
»Jetzt hast du sie wieder«, sagte ich. »Freut dich das?«
Keine Antwort. Nur der Anflug eines Nickens. Tereza kam wieder in die Küche und setzte sich zu uns. Sie tippte auf ihr Handgelenk. Wir waren schon spät dran.
»Männer in Uniformen waren da«, sagte meine Mutter.
»Das waren Polizisten«, antwortete ich.
Meine Mutter sah Tereza an. »Miriam ist nicht tot«, sagte sie.
Tereza legte ihre Hand auf die Schulter meiner Mutter und machte beruhigende Zischlaute.
»Helene ist wieder da« sagte ich. »Zurzeit liegt sie in einem Wiener Kinderheim. Sonst geht es ihr gut.«
Meine Mutter reagierte nicht. Egal, was ich versuchte, ich drang nicht zu ihr durch.
»Miriam ist nicht tot«, sagte sie noch einmal zu Tereza.
Ich tippte auf den Bildschirm. »Schau her! Schau sie dir an! Sie ist richtig hübsch.«
Meine Mutter schnappte nach Luft. Tereza gab mir ein Zeichen, mich zurückzuhalten. Sie legte meiner Mutter eine Trainingsjacke über die Schultern und begleitete sie in den Garten. »Wir warten draußen. Georg bringt die Koffer in den Wagen. Dann fahren wir.«
Meine Mutter blinzelte verblüfft, sagte aber nichts.
Ottobrunn hatte ein eigenes Altenheim, das drei Straßen weiter zwischen einem Gasthaus und dem örtlichen Fußballplatz lag. Wir mussten also nicht weit fahren.
Eine Hilfspflegerin und eine Stationsschwester empfingen uns. Die beiden Frauen halfen meiner Mutter aus dem Wagen und begleiteten sie zu ihrem Zimmer mit Blick auf den Fußballplatz. Alles war vorbereitet. Ich musste nur noch ein Formular unterschreiben, dann war die Sache erledigt. Meine Mutter war im Heim und Tereza war arbeitslos. Zum Abschied küsste sie meine Mutter auf die Stirn und hinterließ ihre Nummer bei der Stationsschwester. »Damit sich Frau Neumann bei mir melden kann, wenn sie etwas braucht.«
Meine Mutter ließ alles teilnahmslos über sich ergehen. Sie war offenbar froh, als sie sich in ihrem Zimmer ins Bett legen konnte. Ich setzte mich an den Bettrand. Ich war in sentimentalen Situationen nie gut gewesen. Auch jetzt wusste ich nicht, wie ich mich verhalten sollte. »Ich komme bald wieder«, sagte ich.
Meine Mutter schluckte geräuschvoll. »Das Mädchen …«, sagte sie.
»Sie ist deine Enkelin«, sagte ich. »Ich will nicht, dass sie in einem Heim oder bei Fremden aufwächst.«
»Wann fahren wir wieder nach Hause?«, fragte sie.
Ich schaltete die kleine Stereoanlage an und legte eine von Terezas Entspannungs-CDs ein. Als der Klang einer Panflöte ertönte, sank meine Mutter tiefer in den Polster. »Warum hat Miriam diese Medikamente genommen?«, fragte sie. Sie wirkte auf einmal fast klar.
»Es gehörte zu ihrem Beruf«, antwortete ich.
Am nächsten Tag fuhr ich nach Hamburg zur Asklepios Klinik im Stadtteil Altona. Da ich gegen fünf Uhr morgens aus Ottobrunn losfuhr, kam ich gut voran und brauchte für die Strecke quer durch Deutschland nicht länger als sechs Stunden. Miriam lag seit 15 Monaten auf der Intensivstation der Klinik. Ich hatte sie zuletzt kurz nach ihrer Einlieferung besucht, nach dem Brand in ihrer Wohnung in Norderstedt.
Gegen 11.30 Uhr nahm ich eine Ausfahrt von der Stadtautobahn, die direkt in die Tiefgarage des Krankenhauses führte. Ich folgte einer grünen Linie in den Trakt C mit der Intensivstation. Dort servierten die Stationshelfer gerade das Essen. Da die meisten Patienten nicht bei Bewusstsein waren, kamen sie mit einem Wagen aus.
Ich klopfte an der Glastür der Schwesternstation und sah mich um. Die Asklepios Klinik hatte eine ziemlich große Intensivstation, zumindest war sie größer als jene des Donauspitals in Wien. Es gab einen Akutraum mit zwanzig Betten und 10 bis 15 Einzelzimmer. Als niemand reagierte, trat ich in den Aufenthaltsraum des Personals. Die Spüle war voll mit Kaffeetassen und Kuchentellern. Auf einem Tisch stand eine leere Sektflasche. Ich drückte die Notfalltaste, mit der Schwestern einen Arzt oder die Oberschwester rufen können, und wartete draußen am Gang. Eine Frau mittleren Alters kam, und als sie im Schwesternzimmer niemanden vorfand, sah sie mich misstrauisch an. »Haben Sie gedrückt?«
Ich tat ahnungslos. »Mein Name ist Georg Neumann«, sagte ich.
Ihr Misstrauen blieb. »Sie sind wegen Miriam Neumann hier?«
»Ich bin ihr Halbbruder«, sagte ich.
Die Schwester ließ ihren Blick von meinem Scheitel bis zu den Fußspitzen schweifen. Sie wirkte wie die weibliche Karikatur eines SS-Mannes: dünne, zusammengepresste Lippen, farblose Augen und der brutale Blick eines Kampfhundes.
»Ständig kommen Menschen, die sich als Verwandte von Frau Neumann ausgeben. Onkel, Cousins, Großväter. Halbbruder ist neu, Halbbruder, das gefällt mir. Haben Sie einen Ausweis?«
»Was soll das werden?«
»Vergangene Woche waren vier Typen da, die sich in Frau Neumanns Zimmer einschleichen wollten, um Fotos zu machen. Ohne Ausweis können Sie es vergessen. Ich bin hier die Pflegedienstleiterin.«
Ich reichte ihr meinen Führerschein. Sie entspannte sich etwas, als sie meinen Namen las. »Ich heiße Christina und ich kümmere mich seit einem halben Jahr um Miriam«, sagte sie. »Ich habe sie gleich bei ihrer Einlieferung erkannt. Mir war klar, dass sie eine besondere Patientin sein würde.«
Ich betrachtete ihre durchtrainierte Figur. Ein typisches Opfer, dachte ich.
»Ich habe ihren Channel abonniert und habe mir alle ihre Videos angesehen«, sagte Christina.
Christina ging voraus zum Zimmer 17. Drinnen stand ein Bett im Halbdunkel. Miriam war intubiert und hing an einem Beatmungsgerät, das gleichzeitig ihre Herzwerte maß. Sie lag in einem oben offenen Glaskasten, mit elektronisch gesteuerter Matratzenheizung, um ihre Körpertemperatur stabil zu halten.
Als ich an den Glaskasten herantrat, fielen mir als Erstes Miriams dürre Oberarme auf. Sie waren kaum dicker als ein Stuhlbein oder der Griff eines Tennisschlägers. Der Anblick schockierte mich. Miriams Oberarme waren früher besonders stark gewesen. Auf YouTube gab es unzählige Bizeps- und Trizeps-Trainingsvideos von ihr. Durch das Koma hatte sie den Großteil ihrer Muskelmasse verloren, denn nach einem Monat ohne Training beginnt bei einem gesunden Menschen der Muskelabbau.
»Wie schön sie früher war«, sagte Christina. »Es ist ein Jammer.«
»Ja«, antwortete ich, »sei du selbst …«
»… und dann sei ein Stück besser«, vervollständigte sie Miriams Slogan.
Christina strich die Bettdecke glatt und kontrollierte die Tropfgeschwindigkeit der Kochsalzlösung. »Ich hab mir dieses Fitness-Chick-Programm gekauft, Sie wissen schon, diesen Ganzkörperplan mit Ernährungsberatung und allem. Wegen meiner unregelmäßigen Arbeitszeiten hatte ich nicht den Erfolg, den Miriam mir versprochen hatte.«
Christina umrundete das Bett und öffnete das Fenster. Draußen ertönte vom nahegelegenen Hafen das Nebelhorn eines Frachters. Christinas Haare waren strähnig und trocken, ihre Haut zeigte Akne-Narben. Das perfekte Zielobjekt für Miriams Marketingstrategien, dachte ich. Miriam hatte mehr als 100.000 Follower auf Instagram, 80.000 auf YouTube und knapp 150.000 Freunde auf Facebook. Sie hatte ihnen mit Videos und Fotos gezeigt, wie sie im Fitnessstudio ihren Körper in Form bringen konnten.
Sei du selbst und dann sei ein Stück besser. Miriams Slogan stand auf Stringers, Sporthöschen und Eiweißpräparaten. Mehrere Sportbekleidungsfirmen sponserten sie, sie hatte ihre eigene Modelinie namens Squat-Chicks 4 Life und war Stammgast in TV-Shows. Von Wien aus hatte ich lange nicht mitbekommen, wie erfolgreich Miriam mit ihrem Fitness-Business war. Erst als Tereza bei einem Telefonat darauf hingewiesen hatte, dass meine 25-jährige Halbschwester nun ihr Gehalt übernehmen wolle, war ich stutzig geworden. Ich sah mir ihre Homepage an und staunte nicht schlecht, als ich jede Menge Softporno-Fitness-Bilder entdeckte.4
»Wir haben acht Mal versucht, Frau Neumann vom Beatmungsgerät zu nehmen«, sagte Christina. »Jedes Mal hatte sie fast einen Lungeninfarkt. Die Lungen sind durch das Rauchgas dermaßen zerstört, dass sie nicht eigenständig atmen kann.«
Ich blätterte durch die Patientenmappe. Die meisten Dokumente kannte ich, da mir die behandelnden Ärzte regelmäßig E-Mails mit den Untersuchungsergebnissen zusandten.
»Ich verstehe nicht, warum sie so viel Valium genommen hat«, sagte Christina. »Sie war doch natural. Wer keine amerikanischen Booster nimmt, braucht doch kein Valium, um herunterzukommen.«
»Niemand von diesen YouTube-Bodybuildern ist natural«, sagte ich. »Miriam hatte sechs Jahre trainiert. Sie hatte 67 kg und einen Körperfettanteil von 19 Prozent. Zumindest steht das auf ihrer Homepage. Für eine Frau ist das verflucht gut. Natural ist das in diesem Zeitraum nicht zu erreichen.«
»Sie hat also gelogen«, sagte Christina und klopfte mit den Fingern auf Miriams Patientenmappe.
»Natural ist ein schwieriger Begriff«, sagte ich. »Nahrungsergänzungsmittel wie Kreatin, BCAA-Eiweiß-Pulver sind in jedem Fitnessshop legal zu haben. Ist jemand, der sie nimmt, natural?«
»Eiweiß-Pulver?« Christina lachte. Sie setzte sich an den Esstisch beim Fenster und ließ einen Apfel über die Tischplatte rollen. »Wegen Eiweiß-Pulver hat sie sicher nicht zu Valium gegriffen. Sie sind Arzt?«
»Wien. Donauspital«, antwortete ich. »Herz-Thorax-Chirurgie.«
Christina wischte den Apfel am Tischtuch ab und biss ab.
»Ein Typ, der sie besucht, meinte, Miriam sei super natty gewesen.«
»Super natty?«
»Das sagen sie in der Szene für total natural.«
»Wer ist der Typ? Einer von den angeblichen Brüdern und Neffen?«
»Er scheint wirklich zu ihr zu gehören.«
»Warum wollen eigentlich so viele Leute Miriam besuchen? Sie war bekannt, okay, aber sie war kein Filmstar.«
»Kennen Sie sich mit der YouTube-Fitness-Szene aus? Es gibt Athleten und Kommentatoren. Es gibt Kritiker und Fitness-Journalisten. Es gibt eigene Talkshows von YouTubern mit YouTubern über ihre Helden. Es hört sich irre an, aber irgendein YouTuber hat behauptet, Miriam liege nicht im Koma, sondern sei kerngesund. Das hat scheinbar eingeschlagen. Er bekam Klicks. Er machte eine richtige Verschwörungstheorie-Doku mit Leuten, die Miriam in ihrem Homegym gesehen haben wollen.«
»Meine Schwester ist also ein Fitness-Elvis«, sagte ich.
»So in etwa«, antwortete Christina und biss wieder in den Apfel. »Die Leute wollten sich überzeugen, ob sie wirklich auf unserer Station liegt. Inzwischen sollte sich die Wahrheit herumgesprochen haben, aber ein paar Idioten haben es immer noch nicht kapiert.«
»Wer ist der Typ, der wirklich zu ihr zu gehören scheint?«
»Zum ersten Mal besuchte er sie gleich nach der Aufnahme. Er war bei ihr im Zimmer und hat keine Probleme gemacht. Er hat nie gesagt, in welchem Verhältnis er zu Miriam steht. Anfangs haben wir danach auch nicht gefragt. Es war seine Idee, Helene von der Säuglingsstation zu holen und sie für ein paar Stunden neben Miriam zu legen.«
Das Gerät zur Überwachung von Miriams Herzrhythmus piepste. Am Gang hörte ich Männer lachen. »Meinen Sie, dass er Helenes Vater ist?«
Ihr Misstrauen kehrte zurück. »Warum interessiert Sie das? Sie waren sechs Monate lang nicht da, und jetzt stellen Sie mir Fragen, auf die Sie die Antworten selbst kennen müssten?«
Ich hatte keine Lust, unsere Familienangelegenheiten mit einer fremden Pflegedienstleiterin zu besprechen. »Ich habe einiges versäumt«, sagte ich deshalb nur.
»Miriams ganze Familie hat sich rar gemacht. Ihre Mutter ist angeblich zu alt, Vater hat sie anscheinend keinen, aber das wissen Sie ja wohl. Der Typ, der sie immer besucht, ist um einige Jahre jünger als Miriam. Ich weiß nicht, wie er zu ihr steht, aber ich glaube nicht, dass er Helenes Vater ist.«
»Haben Sie seine Adresse?«
»Wir fragen im Normalfall, und damals war das noch ein Normalfall, Besucher nicht nach ihrem Namen. Sie kommen. Sie gehen. Mehr ist nicht.«
»Wie sieht er aus?«
»Er ist auch ein Fitness-Typ. Er trägt meistens einen Kapuzenpullover von einem bekannten Hamburger Fitnessstudio. Backyardgym.«
»Sonst noch etwas?«
»Es geht um Helene?«, fragte sie.
Ich nickte.
»Gut. Lassen Sie mich nachdenken. Er hat ein Tattoo am Unterarm. Das hat ja schon fast jeder. Seines ist rot. Vielleicht hilft Ihnen das.«
Ich gab Christina meine Karte. »Ich würde den jungen Mann gerne kennenlernen«, sagte ich. »Rufen Sie mich an, wenn er da ist?«
Ich blickte in Miriams eingefallenes, von dunkelblauen Äderchen durchzogenes Gesicht.
»Soll ich Sie alleine lassen?«, fragte Christina.
Gleich darauf rastete die Tür ein. Ich wartete noch ein paar Minuten. Dann gab ich ihr einen Kuss auf die Stirn und ging ebenfalls.