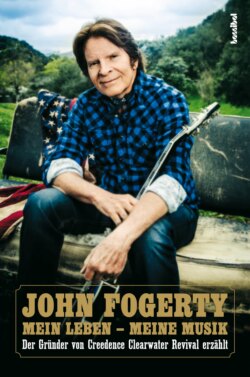Читать книгу Mein Leben - Meine Musik - John Fogerty - Страница 10
ОглавлениеICH ERINNERE MICH NOCH an einen Ausflug mit meinem Vater nach Montana im Sommer nach der neunten Klasse. Ich hatte meine Gitarre, eine Silvertone, mit dabei und spielte auf dem Rücksitz des Autos vor mich hin. Ich versuchte mich an „Red River Valley“ in einer Moll-Tonart, wodurch es ein wenig bluesiger oder folkiger klang. Auch meinem Dad fiel das auf. Es war so verdammt heiß, dass das Kunststoff-Griffbrett der Gitarre sich aufwölbte wie eine schmelzende Kerze. Es müssen über 40 Grad gewesen sein, aber mir war das egal. Ich hatte meine Gitarre und befand mich in einer Zauberwelt, in der ich einem geheimen Schamanen-Pfad folgte. Anders kann ich das gar nicht beschreiben. Heute habe ich genau die gleiche Verbindung zur Musik. Ich hatte schon bei meiner Geburt ein Liedchen auf den Lippen. Ich wollte mich musikalisch ausdrücken und wusste, dass ich mich sonst nicht komplett fühlen würde.
Die erste Gitarre, die wir zu Hause hatten, war eine alte Stella, die stabil wie ein ’48er Ford gebaut war. Wir Jungs spielten gerne im Haus Baseball, und die Stella war unser Schläger! Allerdings weiß ich nicht, ob sie meinem Dad oder meiner Mom gehörte, weil sie niemand spielte. Mein Dad dürfte ein paar Griffe gekannt haben, doch als ich mich ernsthaft dafür zu interessieren begann, war er schon seit Jahren außer Haus.
Meine Mom und ich nahmen die akustische Stella zu den Gitarrenstunden bei Barry Olivier mit und spielten abwechselnd darauf. Barry schlug uns jedoch eine Gitarre mit Nylon-Saiten vor, was tatsächlich besser für uns war. Der Gruppenunterricht, an dem außer mir nur Erwachsene teilnahmen, umfasste ungefähr zwei Mal sechs Wochen und erwies sich als Gottesgeschenk. Barry war ein so charismatischer Mensch und generell sehr aufrichtig. Und ich war wie ein Schwamm, der alles aufsaugte.
Entweder meine Mom oder Barry empfahlen mir, mir ein Exemplar von The Burl Ives Song Book zu besorgen. Ganz hinten waren eine Reihe von Akkorden grafisch dargestellt. Das half immens weiter. Eines Abends, als wir zu unserer Folk-Gitarrenstunde fuhren, war auch mein jüngerer Bruder Dan bei uns im Wagen. Ich spielte „S & J Blues“ auf der Gitarre, und Dan sagte: „Wow, du spielst ja wie ein Profi.“
Zu Hause hatten wir auch ein altes Klavier, auf dem ich selbstverständlich auch herumhämmerte. Mann, war das Ding verstimmt! Manchmal drückte ich Reißzwecken in die kleinen Hämmer, damit es sich mehr nach Honky-Tonk anhörte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Jugendlicher dafür heute noch die Geduld aufbrächte. Wir besaßen den Bob-Fina-Song „Bumble Boogie“ auf 78er-Single. Ich spielte diese Platte allerdings gerne langsamer ab, um so herauszufinden, was Bob Fina da genau spielte. So lernte ich schrittweise, dass da ein System dahintersteckte. Ich ließ einfach nicht locker, bis ich selbst eine präsentable Version von „Bumble Boogie“ spielen konnte. Vermutlich setzte ich mich zu Highschool-Zeiten noch am intensivsten mit dem Klavier auseinander. Ich ging der Sache aber nie wirklich ernsthaft nach und wurde nie wirklich gut an Keyboards, obwohl ich immerhin „Great Balls of Fire“ und „Whole Lot of Shakin’ Going On“ draufhatte. Das Intro zu dieser Nummer ist immer noch einer coolsten Klavier-Parts, die es gibt.
Der Jazz-Pianist Earl Grant trat um 1958 mit einer Version von „Fever“ im Fernsehen auf, woraufhin ich mir die Single kaufte. Auch Little Willie John und Peggy Lee hatten den Song schon aufgenommen, doch auf dem Klavier klang er nicht weniger frisch als etwa „What’d I Say“ oder „Whole Lot of Shakin’“. Die Nummer startete mit einem richtig coolen Riff, und als die Performance vorüber war, setzte ich mich ans Klavier, um den Song nachzuspielen – so gut ich das eben konnte. Ich wusste nicht, in welcher Tonart Earl Grant „Fever“ interpretiert hatte, doch hielt ich mich in erster Linie an die schwarzen Tasten, vermutlich in H- oder Fis-Dur. Um zwischen zwei Töne zu kommen, schlug er zwei verschiedene Töne an – einen Triller oder so. Das war alles neu für mich. „Fever“ bescherte mir zweifelsohne orgasmische musikalische Freuden! Eineinhalb Stunden lang spielte ich den Song immer und immer wieder, bis ich ihn total ausgereizt hatte. Ich schwebte in völlig anderen Sphären.
Heutzutage kann ein Jugendlicher solche Sounds einfach auf dem Computer erzeugen, aber damals, in der analogen Welt, musste man eben einfach irgendwie anders dahinterkommen. Früher Rock ’n’ Roll war, was die Gitarre angeht, oft so einfach gestrickt, dass man sich die Songs selbst beibringen konnte. Ich lernte anhand von Schallplatten auch, wie Bands zusammenspielten, wie ihre Musik arrangiert war. Das klingt vielleicht offensichtlich, aber bis ich mich mit Musikinstrumenten zu beschäftigen begann, war es so, als sprudelte die Musik, die im Radio lief, einfach nur irgendwie aus dem Lautsprecher. Ich musste erst begreifen, worin ihr Geheimnis bestand und warum wie dieser Typ welche Note spielte.
Ich erinnere mich, dass ich mich etwa an Ernie Freemans Instrumentalstück „Lost Dreams“ versuchte. Der Schlagzeug-Sound war einfach so energiegeladen. Als wäre der Song erst am Tag zuvor eingespielt worden. Mir stand eine elektrische Gitarre zur Verfügung, die mein Bruder Tom bei Leo’s Music ausgeliehen hatte. Ich saß am Piano und spielte die Melodie mit der linken Hand, schlug mit der rechten ein oder zwei Gitarrensaiten an und betätigte mit dem Fuß das Pedal von Dougs Hi-Hat. Das machte Spaß, keine Frage! So erzeugte ich Sounds, die nach „Lost Dreams“ klangen, nur war das nun ich, der da spielte, und keine Platte. Für einen Augenblick verstand ich, wie sich, sagen wir, Jerry Lee Lewis gefühlt haben muss, als alle zu ihm sagten: „Jerry Lee, du bist doch durchgeknallt! Was machst du da bloß?“ Denn genau so erging es auch mir.
Ich spielte also den Song gerade auf drei Instrumenten, als meine Mom zur Tür hereinkam und sagte: „Ach, Johnny! Was machst du da bloß?“ Als ob ich nicht mehr alle Tassen im Schrank hätte. Ich dachte mir nur: Yeah, okay. Ich mache wohl was richtig!
Meine Mom stand nicht auf Rock ’n’ Roll. Sie fand Elvis irgendwie daneben. Vermutlich machte sie sich Gedanken, ob das alles noch akzeptabel sei. Einmal besuchte sie mit ein paar Freundinnen das Jazz-Festival in Monterey. Als sie zurückkehrte, schwärmte sie ohne Ende von einem Songs, den einer der Jazzer gespielt hatte: „Ich glaube, er hieß ‚Give Me One More Time‘.“ Ich brachte es nicht übers Herz, ihr zu sagen: „Mom, das war Ray Charles mit ‚What’d I Say‘ und das ist Rock ’n’ Roll!“ Aber wisst ihr was? Sie ließ mich ungestört auf das Piano eindreschen, ohne irgendwelche Fragen zu stellen.
Mein Bruder Tom war vier Jahre älter als ich und konnte in Kreisen verkehren, für die ich noch viel zu jung war – etwa mit Musikern, die in einer ganz anderen Liga als ich spielten. Da gab es diesen Song, „Do You Want to Dance“ von Bobby Freeman, der einen besonderen Platz in der Mythologie von uns Fogerty-Brüdern einnehmen sollte. Es ist eine ganz schlichte, simple Nummer: etwas Klavier, ein wenig Bongos. Vielleicht ein bisschen Kontrabass und Gitarre – aber das war es dann auch schon. Nicht einmal ein richtiges Schlagzeug. Auf jeden Fall aber eine wunderbare Performance, ein richtig cooles Rock ’n’ Roll-Arrangement. Abgesehen davon stammte Bobby wie wir aus der Bay Area, und Tom kannte seinen Pianisten, Richard Dean. Toms Stimme erinnerte stark an jene Bobby Freemans. Wir hatten ein paar Bongos bei uns herumliegen, und so spielten wir den Song gerne gemeinsam. Tom haute in die Tasten und sang, während ich ihn an den Bongos begleitete. Er spielte bereits ein paar Jahre länger als ich. Da Bongos ziemlich einfach zu spielen sind, lernte ich den Song so gut, dass es wie auf Platte klang. Tom sang den Song bis spät in die Nacht hinein – bis um 2 Uhr oder so. Ganz egal, wie gut er das auch tat, unser Nachbar beschwerte sich trotzdem. Tom hatte eine richtig gute, entspannte Stimme mit einem großen Umfang, so wie Bobby Freeman oder Ritchie Valens. Er war wie geschaffen für solche Nummern. Tom hätte eine weiße Doo-Wop-Formation in der Art der Crests oder auch Randy and the Rainbows anführen und Songs wie „Sixteen Candles“ singen können. Eine Zeit lang tat er sich tatsächlich mit einer Gruppe namens Spider Webb and the Insects zusammen. Das waren etwas ältere Typen, die sich von einem Saxofonisten begleiten ließen. Sie kamen zu uns zu Besuch und trugen einen Song mit Tom vor, nämlich „Donna“, den Hit von Ritchie Valens. Ich wünschte, davon gäbe es eine Aufnahme, obwohl ich es immer noch in meinem Kopf hören kann, wie Tom sang und der Saxofonist die Parts, die üblicherweise die Gitarre spielte, beisteuerte. Sogar unsere Mom fand das cool. Die Insects befanden sich in Begleitung von ein paar Mädels. Das waren richtige Rock ’n’ Roll-Girls in verführerisch engen Klamotten, die quasi als Aufputz für die Jungs herhielten. Das wiederum gefiel meiner Mom weniger, was sie die Band auch wissen ließ. Obwohl ich noch sehr jung war, konnte ich spüren, dass da mit diesen Hühnern was im Busch war. Ich glaube, dass meiner Mutter genau das unangenehm war.
Der musikalische Zeitvertreib mit Tom war einfach magisch. Einmal fuhren wir in seinem rot-weißen ’56er Bel-Air-Kombi, als er bereits verheiratet war und ein paar Kinder hatte. Wir rollten dahin, und plötzlich setzte der Riff zu „When Will I Be Loved“ von den Everly Brothers im Radio ein. Wir sahen uns nur kurz an, und unsere Gesichter schienen zu sagen: „Wir sind wohl gerade gestorben und direkt im Himmel gelandet!“ Genau so erging es uns auch, als wir zum ersten Mal „Satisfaction“ hörten. Wir sitzen im Auto, und von einem Moment auf den anderen kommt da dieser Riff um die Ecke gebogen: daaah daaah da da daaah! Wir erlebten zusammen viele solcher Augenblicke. Tom und ich standen eben beide irrsinnig auf Musik und teilten sie brüderlich miteinander.
Mit zwölf oder dreizehn war es ein logischer Schritt, mir eine E-Gitarre zuzulegen und selbst Rock ’n’ Roll zu machen. Die Gitarre kaufte ich bei Sears, eine Silvertone von Danelectro für 39,95 Dollar. Sie hatte nur einen Tonabnehmer – zwei wären nämlich teurer gewesen. Mein erster Verstärker hatte fünf Watt und kostete ebenfalls 39,95 Dollar. Meine Mom half mir bei der Finanzierung, aber ich versprach, mit meinem Geld als Zeitungsbote zu bezahlen, und hielt auch Wort. Im Preis inbegriffen war ein leichter Gitarrenkoffer mit einer Oberfläche aus Alligatorenleder. Später verscherbelte ich die Danelectro für fünf Mäuse an einen Mitschüler. Ich glaube, dass er mich auch bezahlte. Dennoch hätte ich das Ding behalten sollen.
Sobald ich mit ein paar Akkorden zurechtkam, wagte ich auch, mich an „Endless Sleep“ von Jody Reynolds zu vergehen. Welche Niederlage! Obwohl niemand sonst zugegen war, hatte ich mich doch vor mir selbst blamiert. Schließlich gehört dieser Song zu meinen absoluten Lieblingsnummern. Der unheimliche Titel spricht Bände: „Wow, er singt über Selbstmord!“ Auf dieser Scheibe ertönt ein bummmm bummmm ba-haauuum, das sich irgendwo im unteren Tonumfang der Gitarre abspielt – ein echt tiefes E, wie es gar nicht noch tiefer ginge. Ich vermutete, dass dieser Sound mithilfe eines Whammy-Hebels oder einer Bassgitarre, auf deren Hals jemand nach oben rutschte, erzeugt wurde. Ich hatte zwar weder das eine noch das andere, doch wusste ich, wie man ein E anschlug. Sobald ich das tat, wurde mir klar, dass das ja tatsächlich wie „Endless Sleep“ klang. Also hing ich zu Hause ab und spielte denselben Riff immer und immer wieder, wahrscheinlich eine Stunde lang. Schließlich spielte ich ja nun zum ersten Mal in meinem Leben einen Song auf einer E-Gitarre. „Das funktioniert ja tatsächlich! Das gefällt mir! Ich spiele es gleich noch einmal!“
Zum ersten Mal spielte ich meine Silvertone vor Publikum im Rahmen einer Weihnachtsaufführung, als ich die achte Klasse besuchte. Mrs. Starck erlaubte mir, ein oder zwei der Lieder, die wir vortrugen, zu begleiten. Ich weiß gar nicht mehr, was das für Stücke waren, vermutlich irgendetwas Weihnachtliches. Immerhin erinnere ich mich noch, dass ein D-Moll- sowie ein G-Akkord darin vorkamen.
Damals war es schon ziemlich revolutionär für eine Schule, eine Vorführung für die Eltern zu organisieren, bei der eines der Kinder E-Gitarre spielte. Doch keine Angst: Allzu laut war ich damals noch nicht.
Das war auch die Gitarre, die ich spielte, als ich Doug kennenlernte. Entweder ging ich mit ihr zu ihm rüber, oder er kam zu einer Jam-Session zu mir. Mir gefiel Dougs Enthusiasmus. Er hatte Energie und war sympathisch. Alles war ganz unkompliziert und entspannt, schließlich standen wir beide auf Rock ’n’ Roll. Wir lebten in ähnlichen finanziellen Verhältnissen. Ungefähr zu jener Zeit trennten sich auch seine Eltern, weshalb er dieselben Dinge durchmachte.
Ich konnte Songs wie „Ooby Dooby“ von Roy Orbison sowie die B-Seite dazu, „Go Go Go“, spielen, und langsam erarbeiteten wir uns ein kleines Repertoire. Manchmal sang ich auch – Sachen wie „The Battle of New Orleans“ oder auch „Hully Gully“. Außerdem machte ich mir darüber Gedanken, welche anderen Kinder auch musizierten, um unseren Sound voller zu machen. Wir einigten uns schließlich auf Stu Cook fürs Piano, den Doug mir gegenüber in Mrs. Starcks Klasse erwähnt hatte. Stu war clever und mochte dieselbe Musik wie Doug und ich. Zwar wusste er damals noch nicht viel über das Instrument, für das er vorgesehen war, doch erklärte er sich bereit, es zu erlernen; deshalb wollten wir ihm eine Chance geben. Stu lebte nach unseren Maßstäben im Wohlstand. Er wohnte in einem Haus, oben in den Hügeln über El Cerrito, und hatte sein eigenes Spielzimmer mitsamt Piano. Außerdem wohnte sein Dad bei ihm zu Hause. Er war Anwalt, seine Kanzlei vertrat unter anderem auch das Football-Team der Oakland Raiders. Doug lebte hingegen unweit von mir in einer Wohnung.
An der El Cerrito High gab es drei Schülergruppen: „Delmar“, die „49ers“ und die „Saxons“. Zu Delmar gehörten die adretten Kids. Die 49ers waren die Sportler. Und die Saxons waren nicht einfach nur Greaser, nein, in ihren Reihen tummelten sich die echt fiesen Jungs, die Bad-Boys. Als ich noch die Junior High besuchte, wurde mir die Ehre zuteil, mich Delmar anzuschließen, denn damals war ich gerade ein Einser-Schüler. Auch Stu und Doug waren bei Delmar, doch irgendwann kam es zu einem Eklat um Stu, der daraufhin bei den Saxons unterkam. Er ließ sich nämlich ein Tattoo stechen, was 1962 einen ziemlichen Aufruhr verursachte. Ich glaube, dass er es sich später entfernen lassen wollte.
Das Problem mit Stu war, dass er irgendwann ungeduldig wurde. Wie sagt man noch mal? Ach ja, er wurde schwierig. Er regte sich über irgendetwas auf und wurde sauer. Irgendwann brachte ich das dann zur Sprache. Zuerst hatten wir noch in seinem Spielzimmer zusammen musiziert, als er sich plötzlich weigerte, etwas auszuprobieren: „Das ist keine gute Idee, das wird nicht funktionieren. Bla, bla, bla.“ Im Prinzip ging es darum, dass er einen Part nicht spielen konnte, weshalb er den Part schlechtredete, anstatt sich einzugestehen, dass er davon überfordert war.
Als es mir dann zu bunt wurde, sagte ich: „Du bist die Art von Typ, der am Spielfeldrand steht und nicht einmal versuchen will, mitzuspielen. Dieser Typ ist weder der Coach, noch spielt er mit. Er steht einfach nur da und ruft: ‚Das wird nie funktionieren. Warum versucht ihr das überhaupt?! Mann, das ist scheiße!‘“
Diese Ansprache hielt ich sogar öfter als nur ein Mal, weil sich im Verlauf der Jahre herausstellte, dass Stu eben so tickte. Bei Creedence war er genau diese Art von Typ. Stu konnte einem echt auf die Pelle rücken. Ich war zu schüchtern dafür – oder auch einfach nur zu höflich.
Ich schlug den Namen Blue Velvets für unsere Band vor. Und ich wäre der Anführer, der Bandleader ‒ obwohl ich das mit ironischem Unterton sage. Als Doug und ich nämlich anfingen, uns zu unterhalten, sagte ich mir: Schließe ich mich nun seiner Band an? Und dann: Nein, nein – er schließt sich meiner Band an! Irgendwann wurde aber doch recht deutlich, dass ich die Richtung vorgab. Musik war mehr mein Ding. Außerdem schrieb ich etliche Instrumentalstücke. Und wir waren eine Instrumental-Gruppe, das war unser Konzept. Ab und an sang ich vielleicht mal was wie „Hully Gully“, aber in erster Linie coverten wir Instrumental-Hits von Leuten wie Duane Eddy, Bill Doggett, Link Wray, den Ventures, Freddie King oder Johnny and the Hurricanes.
Die Blue Velvets waren gerade mal ein Trio – Gitarre, Drums, Piano. Deshalb entwickelten wir vielleicht auch nicht sonderlich Druck, aber damals gab es auch nicht wirklich viele kleine Bands, die bereits ein festes Gefüge aufwiesen. Vielleicht hatten Johnny and the Hurricanes einen Bassisten, aber auf lokaler Ebene kam das recht selten vor. Abgesehen davon waren wir die einzige Rock ’n’ Roll-Band an unserer Schule. Doug, Stu und ich spielten von der achten Klasse bis zum Ende der Highschool als Band zusammen. Niemand sonst außer uns hatte die Courage, sich hinzustellen und zu sagen: „Wir sind eine Band!“ Zwar galten wir als coole Jungs, doch man hielt uns auch für ein wenig verschroben. Als die Beatles schließlich durchstarteten, gab es plötzlich 100 Bands an unserer Schule, aber vorerst waren wir die einzige.
Ich glaube, dass die Blue Velvets zum allerersten Mal Ende 1959 bei einer „Sock Hop“-Tanzveranstaltung an der Portola Junior High auftraten. Vermutlich spielten wir fünf Instrumentals. Ich weiß noch, dass wir mindestens eine Nummer spielten, die ich geschrieben hatte. Es war ein langsamer Song, wie eine instrumentale Version von Doo-Wop, diese Art von Akkorden eben. Ein weiterer Songs, den wir an diesem ersten Abend spielten, war „Bulldog“ von den Fireballs, den wir auf dem Weg zur Party im Auto gehört hatten. Als ich dann in der Schule meine Gitarre zur Hand nahm, sagte ich zu den anderen: „Folgt mir einfach, es ist ein 12-taktiger Blues.“ Eigentlich ist es nicht mein Stil, irgendwen – geschweige denn meine eigene Band – mit unbekanntem Material zu konfrontieren, aber dieses eine Mal war ich nicht mehr zu bremsen. Und das bei unserem ersten Auftritt! Ich dachte ganz praktisch und wollte auch niemandem weismachen, ich sei Duane Eddy oder so. Nein, vielmehr war es: „Wozu bin ich hier? Ich wurde angeheuert, um auf einer Tanzveranstaltung zu spielen. Dann spiele ich besser mal was Tanzbares.“ Daran hielt ich mich im Verlauf der Jahre, sogar als ich auf den großen Bühnen der Welt auftrat. Ich entschied mich, Musik zu spielen, die einen dazu brachte, den eigenen Körper in Bewegung zu versetzen.
Mit der Zeit ergaben sich diverse Möglichkeiten für die Blue Velvets, und dieser Typ namens Bob – seinen Nachnamen habe ich vergessen – nahm uns unter seine Fittiche. Er gehörte zum El Cerrito Boys Club, den wir fortan repräsentierten, wenn wir über die gesamte Bay Area verteilt – in Pleasanton, San Leandro und Oakland etwa – unsere Gigs absolvierten. Da wir ja noch Kids waren, fuhr uns Bob mitsamt unserer Ausrüstung durch die Gegend. Er war ein echt guter Kerl und half uns sehr. Es ist mir später leider nie gelungen, ihn ausfindig zu machen, was ich sehr schade finde.
Die Blue Velvets erhielten also die Möglichkeit, oft und regelmäßig aufzutreten. Das war eine gute Schule. Wir studierten drei, vier Songs ein und kamen weit herum. Als wir irgendwo in Nordkalifornien gastierten, sprach mich zum ersten Mal James Powell an. Ihm gefiel meine kleine Band. Er sagte: „Ich habe vor, eine Platte aufzunehmen, und suche nach einer Band, die mich darauf begleitet.“ Ich war zwar erst 14, doch anders als manch anderer Musiker verfügte ich schon seit jeher über einen besonderen Antrieb. Wenn dir etwas direkt in den Schoß fällt, dann sagst du gefälligst: „Yeah, Mann – auf jeden Fall mache ich das!“ Oder etwa nicht?
Heutzutage kann jeder Jugendliche auf seinem iPhone sein eigenes Album aufnehmen. Auf diese Weise ist eine gewisse Romantik verloren gegangen. Damals hieß es: „Mom, wir werden eine Schallplatte aufnehmen!“ Es war fast unvorstellbar, eine Aufnahme zu machen. Es einfach nur sagen zu können – wie cool war das denn?
James war ein schwarzer Typ und ein richtig guter Sänger. Ich glaube, er war 25 oder so und hatte da diesen Song, „Beverly Angel“. Eine klassische Doo-Wop-Nummer, ein echt cooler Track. Außerdem hatte er noch ein paar andere – jeder Titel war ein Mädchenname. Also probten wir, und ich weiß gar nicht mehr, wie oft James zu mir nach Hause oder zu Stu ins Spielzimmer kam. James kannte diesen Typen, Joe Jarros, der seine eigene kleine Plattenfirma, Christy Records, am Start hatte. Er war ein Kleinunternehmer und betrieb das Label nebenher – er stand somit quasi für die unschuldige Seite des Rock ’n’ Roll-Geschäfts in seinen Anfangstagen.
Wir waren im Grunde genommen James’ Begleitband, doch dafür benötigten wir noch einen Bassisten. Ich hatte ein paar Mal auf dem Bass in Mrs. Starcks Musikzimmer gespielt. Sie hatte mit der Kreide Markierungen auf das Griffbrett gemacht, an denen ich mich orientieren konnte. Hey, es war wie ein Gitarre – nur größer!
Also beschloss ich, bei der Session mit James Powell den Bass zu spielen. Den Bass aus der Schule konnte ich mir zwar nicht ausborgen, aber auf meiner Zeitungstour gab es da diesen älteren Typen, der in einer Country-Band Bass spielte. Sie hatten jede Woche einen Gig in Oakland, der im Lokalfernsehen übertragen wurde. Ich freute mich immer sehr, wenn er zu Hause war, weil wir uns dann über Musik unterhielten und er mich stets ermunterte. Ein cooler Typ.
Eines Tages brachte ich ihm also seine Zeitung und erzählte ihm, wir hätten die Möglichkeit, eine Platte aufzunehmen. „Was du nicht sagst!“, antwortete er ganz begeistert. Also bat ich ihn, mir seinen Kontrabass auszuleihen. „Klar doch, Mann. Wenn ich nicht zu Hause bin, sprich einfach mit meiner Frau. Das Ding steht in der Garage.“
James hatte einen Anhänger gemietet. Schließlich war so ein Bass riesig. Deshalb wurde auch der Fender Precision erfunden, damit man sich all diese Scherereien erspart. Ich kreuzte also beim Haus dieses Typen auf, und natürlich war er nicht da. Seine Frau warf einen Blick auf James und auf mich – und ich war ja auch nur ein Junge, der Zeitungen austrug. Ich bin mir nicht sicher, ob sie die Situation verstand, aber sie ließ uns den Bass schließlich mitnehmen. So fuhren wir also mit diesem Ungetüm von Musikinstrument im offenen Anhänger über die Bay Bridge zu Coast Recorders, einem Studio in San Francisco.
Wir hatten bereits gemeinsam mit Tom ein kleines Demo aufgenommen, und zwar im Dick Vance Recording Studio. Dieser Raum war so klein gewesen, dass wir ein Fenster hatten öffnen müssen, damit Doug sich auf das Fensterbrett setzen konnte, von wo aus er dann sein Schlagzeug spielte. Wenn ich mich nicht irre, nahmen wir dort zwei Songs auf, zu denen Tom den Gesang beisteuerte. Alles, was wir bekamen, war eine Schellack-Platte. Der Typ presste sie gleich im Studio. Ein einzige Kopie, das war alles. Ich erinnere mich auch noch daran, dass Tom mit dem Lautstärkeregler an meiner Gitarre spielte, um einen Vibrato-Effekt zu erzielen. Ich spielte, und Tom bewegte den Regler rasch hin und her.Coast Recorders dagegen war ein richtiges Aufnahmestudio. Als wir eintraten, trafen wir auf Monk Montgomery, den Bruder von Wes Montgomery. Monk war einer der ersten Jazz-Bassisten, die auf ein elektrisches Instrument umstiegen. Ich dachte mir nur: Wow, die Oberliga!
Der Studiotechniker hieß Walt Payne. Jahre später sollte er uns in derselben Funktion bei den Aufnahmen zu „Susie Q“ von Creedence unterstützen. Doug, Stu und ich spielten die Musik ein, und James übernahm den Gesang. Anschließend ergänzte ich noch den Bass, was kein Problem darstellte. James steuerte auch noch eine Tonspur mit Harmoniegesang bei, was damals schon recht fortschrittlich war. „Beverly Angel“ ist vielleicht nicht „Earth Angel“ – aber es kam schon daran heran. Der Song klang ziemlich gut, griff auf Echo-Effekte zurück und verfügte über einen echten Schluss, nicht nur ein Fade-out. „Beverly Angel“ wurde beileibe kein Kassenschlager, aber zumindest wurde der Song im Radio gespielt. Stellt euch das mal vor: Ich nehme mit meiner Band eine Schallplatte auf und bin gerade mal 14 Jahre alt – und diese Schallplatte wird doch tatsächlich im Radio gespielt! Es wird noch abgefahrener: Es war eine R&B-Scheibe, schwarze Musik, die auf einem schwarzen Sender lief, nämlich meinem liebsten R&B-Sender, KWBR!
Ich war schon ziemlich stolz. Ich nahm jetzt nicht an, dass ich mich auf direktem Wege in die Carnegie Hall befand, doch hört euch das an: Stu hatte an der El Cerrito High bei einem gewissen Mr. Thomas einen Kurs in Elektronik belegt, und eines der Klassenprojekte war, ein Radio zu bauen. Nun, Stu stellte seinen Empfänger fertig, und als er sein Radio zum ersten Mal in Betrieb nahm, lief anscheinend, ta-da, „Beverly Angel“. Könnt ihr euch das vorstellen? „Hey, Mr. Thomas – da läuft meine Platte!“
Es gab Zeiten in meinem Leben, da bin ich mit dem Strom geschwommen und der Versuchung erlegen, krumme Dinger zu drehen. Als ich ungefähr acht Jahre alt war, fingen wir als kleine Gruppe von Kids an, Ladendiebstähle zu begehen. Wir klauten etwa Dinge aus dem Werkzeugladen. Ihr wisst schon, unter dem Shirt und so. Dann versuchten wir, die Sachen zu verkaufen, indem wir von Tür zu Tür zogen. So wurden wir auch überführt. Ich meine, wie kommt ein kleiner Junge dazu, irgendeiner Familienmutter an ihrer Haustüre einen Spachtel anzudrehen? Da klebte sogar noch das Etikett aus dem Haushaltswarenladen daran.
Zusätzlich wurde ich noch verraten. Dieser eine Junge, Billy, hielt sich für einen echt harten Typen. Schon als ich etwa vier Jahre alt war, warf er mich bereits einmal mitsamt meinem Dreirad um. Ich überschlug mich und flennte. Billy war ein abgebrühter Junge, der viel rauchte und fluchte – eine gereizter, aggressiver Schlägertyp eben. Billy war es nun auch, der uns ans Messer lieferte. Er war wohl doch nicht ganz so ein zäher Bursche wie damals, als er einen kleinen Jungen auf dem Bürgersteig zu Boden gestoßen hatte. Seinerzeit war das alles nicht besonders lustig. Ich hoffe dennoch, dass Billy irgendwann die Kurve gekriegt hat.
Irgendwann fing ich an, mir gelegentlich mal eine Single zu klauen. Ich hatte, so kam es mir zumindest vor, zu wenig Geld, obwohl ich ja Zeitungen austrug. Ich glaube, dass ich im Plattenladen gesehen hatte, wie ein Junge eine Platte mitgehen ließ. Ich bekam große Augen. Es ging wohl auch um den Kick, was mir echt unangenehm ist. Vermutlich herrschte auch ein gewisser Gruppenzwang.
Ich will mich nicht damit brüsten, und am liebsten würde ich es für mich behalten. Jedoch ist auch dies ein Teil meiner Geschichte.
Ich ließ also hier und da mal eine Single mitgehen. Nach einem Jahr und ein paar Monaten waren es ganz schön viele geworden. Irgendwann warf ich einen Blick darauf und sagte zu mir selbst: „Musik ist die eine Sache, die du liebst. Warum tust du das hier nur? Das ist schrecklich. Es ist das, was dir am wichtigsten ist, und du brichst deine wichtigste Regel. Du weißt doch, was Ehrlichkeit bedeutet. Was außer deinem Wort hast du denn schon zu bieten?“
So wurde das, was mir am Herzen lag, von Missempfindungen und Schuldgefühlen überlagert, weil ich Mist gebaut hatte. Ich überlegte sogar, gegenüber dem Plattenladen reinen Tisch zu machen, damit ich diese üble Angelegenheit hinter mir lassen könnte. Doch so tapfer war ich dann doch nicht. Leider.
Zumindest wurde ich dadurch zu einem großen Verfechter von Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Das geht so weit, dass ich mich sklavisch an Verkehrsregeln halte, auch wenn das nicht immer absolut notwendig wäre. Sehr zum Leidwesen meiner Kinder übrigens. Ich sage dann: „Nein, auch wenn es wehtut! Das Verkehrsschild schreibt vor, was zu tun ist!“
Es ist ein schmaler Grat. Heute tust du vielleicht diese eine kleine Sache und morgen dann … Natürlich ist niemand von uns perfekt. Wie ihr vielleicht erraten habt, bin auch ich ein Mensch mit Fehlern. Doch Aufrichtigkeit ist mir immer noch sehr wichtig – diese Vorstellung, ehrlich zu sein. Moral zu besitzen.
Diese Erfahrung trug nicht alleine dazu bei, dass ich so wurde. In der achten Klasse blieb ich, anstatt in die Schule zu gehen, einfach mal zu Hause. Meine Mom stampfte, bevor sie sich auf den Weg in die Arbeit machte, wie immer auf die Metallluke über meinem Bett und schrie: „Johnny! Wach auf!“ Es war der Oktober 1958, und es fand gerade die Finalserie im Baseball statt. Damals wurde die World Series noch tagsüber ausgetragen, weshalb ich beschloss, dem Unterricht fernzubleiben, um die Spiele zu verfolgen und auf meiner neuen Silvertone herumzuzupfen. Ich blieb dann auch am nächsten Tag zu Hause. Meine Mom war ja nicht da. Auch sonst war ich ganz allein.
Wochen später trug ich gerade nach der Schule die Zeitung aus, als Mr. Noricaine, mein Sportlehrer, in seinem ’49er-Ford an mir vorbeizog. Ich dachte bloß, dass meine Stunde bald schon kommen würde. Sie kam schließlich wenige Tage später, als mich meine Mutter mit meinem Fehlverhalten konfrontierte. Sie war von der Schule angerufen worden, und letzten Endes wurde ich mit einem richtig schlechten Zeugnis abgestraft, da ich so viel Unterricht versäumt hatte. Vier „Fünfen“ und eine „Vier minus“.
Also steckte ich so richtig – Länge mal Breite – in der Tinte. Ich musste den Sommer lang lernen und den Stoff nachholen. Dieselbe Prozedur musste ich sogar noch ein zweites Mal erdulden. Es war meine letzte Chance, wenn ich zusammen mit meinen Klassenkameraden abschließen wollte. Kinder werden sich der Konsequenzen selten bewusst, bis es zu spät ist. Damals fand der Sommerkurs an der Richmond High – also nicht einmal an meiner eigenen Schule – statt. Aber immerhin unterrichtete dort Mrs. Starck, meine Musiklehrerin aus der Portola Junior High! So wurde der Sommerkurs anstelle einer Bestrafung zu einer Art Offenbarung, und es war absolut großartig, daran teilnehmen zu können!
Außerdem gab es da noch dieses Mädchen. Ich erfuhr nie ihren richtigen Namen, doch alle nannten sie Plookie. Sie war ein etwas stabiler gebautes schwarzes Mädchen, und Mrs. Starck erlaubte ihr, den Unterricht mit Musik zu bereichern. Plookie spielte eine Gitarre von Supro über einen Verstärker mit Vibrato, ebenfalls von Supro. Irgendjemand begleitete sie am Tamburin. Plookie und ein paar ihrer Freunde trugen ein paar Gospel-Songs vor, und es war unbeschreiblich gut. Sie mag vielleicht bloß einen oder zwei Akkorde mehr als ich gekannt haben, aber es hatte auch einfach mit ihrer Haltung zu tun.
Sie spielte die Musik, die ich mir im Radio anhörte, aber ich kannte niemanden, der selbst so etwas machte. Wenn ich Sachen wie die Staple Singers hörte und versuchte, selbst so etwas zu spielen, klang es sofort nach den Ventures. Plookie wusste jedoch, wie der Hase lief, und hatte diesen Sound drauf. Sie war einfach umwerfend. Absolut fantastisch. Und sie war in meinem Alter! Das öffnete mir echt die Augen.
Dies war nicht irgendeine Fantasie, der ich in meinem kleinen Schlafgemach nachhing, sondern absolut greifbar und geschah direkt vor meinen Augen. Ich wurde dadurch in eine Richtung gelenkt, die weder für etwas Verbotenes stand noch zu gefährlich für meine Mom war. Auch war es nicht etwa peinlich, sich damit zu befassen. Vielmehr dachte ich mir: Das ist es, was mich anspricht. Genau das möchte ich machen. Plookie nahm sich netterweise die Zeit, mir zu zeigen, wie sie das mit dem Vibrato hinbekam und was sie mit ihrem coolem Amp noch so anstellte. Mein kleiner Verstärker hatte ja bloß fünf Watt; ihrer war sicher doppelt so groß. Ich legte mir in Folge auch eine Gitarre von Supro zu ‒ zuerst das Ozark-Modell und dann eine formidable Res-O-Glas aus dem Sears-Katalog. Die Ozark blieb jahrelang meine bevorzugte Gitarre. Ich schaffte mir Gitarren mit kurzen Hälsen an, da ich meine Hände für klein hielt. So fiel mir etwa auf, dass ich die Saiten nur dann richtig dehnen konnte, wenn ich meine Supro mit einer geringeren Stärke bespannte.
Das mit den dünnen Saiten fing an, als sich die Blue Velvets gemeinsam mit Tom in einem kleinen Fotostudio in Oakland fotografieren lassen wollten. Es waren stimmungsvolle Schwarz-Weiß-Bilder; wir trugen alle schwarze Anzüge. Bei dieser Fotosession stand auch eine Stratocaster herum. Sie hatten diese Sunburst-Optik und war sehr, nun ja, kurvig.
Was mir aber auffiel, war, dass die Saiten dünn, leichtgewichtig und sehr dehnbar waren. Fast wie Gummibänder! Ich hob das Ding hoch und sagte: „Wow, was geht denn hier ab?“ Damals benutzte ich Saiten von Black Diamond, die, wenn sie normal aufgezogen wurden, ziemlich streng und starr waren. Als ich diese Strat in Händen hielt, dachte ich mir: Wie bekomme ich das bloß so hin?
Also ging ich zu Louis Gordon Music und kaufte mir zusätzlich zu meinem üblichen Saitensatz noch eine hohe E-Saite. Ich spannte die erste E-Saite auf ihrer normalen Position ein. Dann nahm ich mir die andere hohe E-Saite und zog sie eine Position darüber ein. Somit befanden sich schließlich alle Saiten tiefer als vom Hersteller vorgesehen, wodurch sich eine leichtere Saitenstärke ergab.
Später fand ich heraus, dass James Burton es auch so machte. Allerdings verwendete er eine Banjo-Saite. Mir fehlte das Grundwissen für diese Vorgehensweise, doch ich hatte das Glück, diese Stratocaster in die Hände zu bekommen. So entwickelte ich durch Zufall eine Vorliebe für Saiten, die sich fast nach Belieben dehnen lassen – etwas, das wesentlich für meine Spieltechnik werden sollte.
Zu jener Zeit, als wir mit James ins Studio gingen, traten wir wie gesagt eben auch immer wieder als Toms Begleitband in Erscheinung. Als ich in der neunten oder zehnten Klasse war, begaben wir uns mit ihm erneut in irgendein improvisiertes Studio, das sich in der Nähe von Vallejo befand. Tom sang, und die Blue Velvets unterstützen ihn instrumental. Es gab aber irgendeine technische Panne mit dem Equipment, weshalb wir eine Pause einlegten. Ich sah, wie der Studiobesitzer mit einem Schraubenschlüssel versuchte, das Aufnahmegerät wieder in Gang zu bekommen. Das war schon witzig.
Ich weiß nicht, wohin sich Tom verzog, aber Stu machte sich gemeinsam mit Doug auf den Weg, um Kippen zu kaufen.
„John, kommst du mit?“, fragte er mich.
„Nein, ich bleibe hier.“
„Warum?“
„Weil ich vielleicht etwas lernen kann.“ Wie oft kam ich denn schon in ein Aufnahmestudio?
Ich beobachtete also diesen Kerl mit all seinen Drähten. Er sagte: „Weißt du, wenn du Zeug aufnimmst, musst du dir immer merken: Es ist wie mit einem Glas Wasser.“
„Häh?“
„Ihr Jungs macht all diesen Lärm, aber ihr dürft auch den Sänger nicht außer Acht lassen.“
„Yeah, okay.“
„Und dann kommt auch noch die Leadgitarre.“
„Yeah. Meinen Sie, wie ‚Ist das Glas halb leer oder halb voll?‘“
„Nein, nein, nein. Ihr habt ein Glas mit Wasser – das ist eure Platte, das, was ihr auf Band aufnehmen wollt. Ihr dürft nicht vergessen, dass ihr ein Glas nur bis zu einem gewissen Grad mit Wasser füllen könnt, denn sonst läuft es über. Eine Verschwendung, eine Sauerei. Hässlich. Wenn ihr also noch etwas darüberlegen wollt – wie etwa Gesang –, dann müssen die anderen Dinge etwas reduziert werden, damit nichts überläuft.“
Analoges Tonband liefert einen wunderbar vollen Sound. Das bestätigen alte Blues-Scheiben, Bo Diddley und Chess Records, der Rock ’n’ Roll in seiner Hochblüte oder auch Manfred Manns „Do Wah Diddy Diddy“. Wenn alles ideal eingestellt ist, erwacht Rock ’n’ Roll zum Leben. Ein großartiger Studiotechniker weiß, wie er zu diesem Ziel gelangt. Wir halten nicht an, wo der rote Bereich beginnt – das ist der Heilige Gral.
In der digitalen Welt ist dies nicht möglich. Man zieht davor den Schwanz ein. Der rote Bereich ist tabu. Frei nach diesem weisen alten Studio-Typen: „Das Glas läuft über, und das ist hässlich.“ Digitales Krachen ist jedenfalls kein sehr schöner Sound.
Was mir dieser Typ an jenem Tag beibrachte, sollte ich mein Leben lang nicht mehr vergessen. Als die Jungs schließlich wieder eintrudelten, kicherten sie unbedarft: „Und, hast du irgendetwas gelernt?“ Später versuchte ich sie einzuweihen. Sie lachten bloß. Meine Bandkollegen hatten kein besonders großes Interesse an solchen Dingen. Ich musste sie mit aller Gewalt ins Studio schleifen oder darum betteln, dass sie nicht gleich wieder das Weite suchten. Manchmal blieben sie bei der Stange – und manchmal zogen sie mit ihren Freundinnen ab oder verdrückten sich auf irgendeine Party.
Ich blieb dann allein zurück und sagte nur: „Oh, yeah, kein Problem.“ Stu ließ mich sogar ein paar Mal wissen: „Musik ist eben nicht mein ganzes Leben!“ Auf Stu mochte das schon zutreffen – auf mich jedoch nicht. Musik war sehr wohl mein ganzes Leben. Ich hatte mich mit ihr infiziert und stand nun ganz in ihrem Bann.
Ich war der Typ, der stets etwas Neues lernen wollte und sich dachte: Ich werde so lange recherchieren, bis ich es auf die Reihe bekomme. Es ging mir ums Lernen. Zu sagen: „Ich armer Junge kriege das nicht gebacken, weil das Aufnahmestudio so mies ist“, war nur eine faule Ausrede. Das Tolle an Rock ’n’ Roll ist, dass er zu einem Großteil aus irgendwelchen Garagen stammte und schließlich auf Labels namens Del-Fi oder Sun veröffentlicht wurde. Das waren nicht nur passable Platten, sondern die allerbesten!
Obwohl wir alle noch sehr, sehr junge Musiker waren, war ich den anderen musikalisch stets voraus; deshalb war ich von Anfang an auch derjenige, der den anderen erklärte, was sie zu spielen hatten. Doug wusste zumindest, dass er das Fußpedal der Bassdrum auf der Eins betätigte und den Snare-Schlag auf der Zwei setzte. Das war aber auch schon alles. Es lag an mir, die Songs im Radio genauer zu studieren, um herauszufiltern, wer was spielte und wie die Arrangements aufgebaut waren. Ich war der Übersetzer, ich konnte Songs dechiffrieren. Die meisten Menschen nehmen einen Song nur als ein großes Ganzes war. Wenn ich jedoch Musik hörte, konnte ich zwischen den einzelnen Parts unterscheiden.
Musik live zu hören unterstützte dieses Verständnis ungemein; so beeinflussten mich auch die Live-Konzerte im Oakland Auditorium stark. Diese Shows waren großen Revuen, bei denen jedem Act eine halbe Stunde auf der Bühne gewährt wurde: James Brown, Jackie Wilson, Duane Eddy oder Ray Charles. Bei jeder dieser Shows im Oakland Auditorium saß ich in der ersten Reihe.
Ich weiß noch, wie ich mich mit Doug und Tom dafür anstellte. Tom war unser Chauffeur. Wenn wir um 3 Uhr nachmittags eintrafen, waren wir die Ersten in der Warteschlange und konnten, sobald die Türen öffneten, unsere Ärsche direkt vor der Bühne parken. Daher konnte ich mir viele Details einprägen.
Ich sah James Brown, als ich 14 Jahre alt war. Bei ihm war eine Menge Präzision im Spiel. Er sang etwa einen Song – „Please, Please, Please“ – und dann, zack, legte er einfach einen Spagat hin! Der nächste Song fängt an, und er ist wieder auf den Beinen! Dann: noch ein Song! Bam! Vielleicht performte er für gerade mal eine halbe Stunde, aber in dieser Zeit gaben er und seine Band dem Publikum ganze zwölf Songs. Es ging darum, in kürzester Zeit eine Explosion zu entfesseln. Es ging um die Energie! Am Ende stand allen der Mund weit offen: „Was war das gerade eben?“ Ich liebte das!
Im Anschluss sprang Larry Williams mit seiner Gitarre von der Bühne und wurde von all diesen Mädchen belagert. Bam! Als sie wieder von ihm abließen, war er von der Hüfte aufwärts nackt, weil sie ihm sein Hemd in Streifen gerissen hatten! Dann kam Jackie Wilson in einem Smoking auf die Bühne, und die Frauen drehten komplett durch. Weiße Mädchen, schwarze Mädchen ‒ das war ganz egal. Jackie war auf eine Weise attraktiv, die auf einen Filmstar hätte schließen lassen. Seine Bewegungen waren grazil und mühelos. Er war ein richtiger Panther!
DJ Bouncin’ Bill, der die Show moderierte, kam auf die Bühne und wies die Frauen an, sich wieder auf ihre Plätze zu begeben, sonst drohten Probleme mit der Feuerpolizei. Bei Jackie Wilson hörte die Action gar nicht mehr auf. Die coole R&B-Band, die ihn bei diesen Auftritten öfter begleitete, hatte einen Song mit dem Titel „Spunky Onions“ (ursprünglich „Funky Onions“), und der Gitarrist spielte, wie ich mittlerweile weiß, einen sogenannten übermäßigen Akkord. Tom drehte sich zu mir und sagte: „Du solltest dir genau ansehen, was dieser Gitarrist da abzieht.“ Er sagte das zu mir und nicht zu sich selbst. Darüber machte ich mir später noch öfter Gedanken.
Ein Konzert im Oakland Auditorium unterschied sich von all den anderen. Wie üblich waren wir bereits am Nachmittag eingetroffen, um uns ganz vorne anzustellen. Die Türen wurden in der Regel um sechs oder halb sechs geöffnet. Wir saßen dann die längste Weile so da, bis schließlich irgendetwas passierte. Der angekündigte Zeitpunkt für die erste Show kam und verstrich wieder. Nichts tat sich. Inzwischen war das Auditorium gut gefüllt, und alle waren bereit für das Konzert. Es wurde später und später, und das Publikum wurde schlicht im Dunkeln gelassen. Lautstarkes Gemurmel setzte ein, die Leute wurden langsam, aber sicher säuerlich.
45 Minuten, vielleicht auch eine Stunde nach der angekündigten Anfangszeit kam plötzlich Bewegung in die hinteren Reihen des Auditoriums. Als wir uns umdrehten, konnten wir ein paar Typen sehen, die auf dem zentralen Gang zwischen den Sitzreihen in Richtung Bühne marschierten. Ein paar der Jungs hatten sich Tüten bis über die Schultern gezogen. Langsam dämmerte es dem Publikum, dass das die Musiker sein mussten und dass das alles zur Show gehörte. Als die Typen schließlich die Bühne erreichten, die vielleicht etwas über einen Meter hoch war, sprangen sie einfach hinauf.
Das Publikum entspannte sich nun wieder und nahm an, nun werde es mit der Show losgehen. Einer dieser Kerle setzte sich ans Klavier und spielte die Eröffnungsakkorde zu „What’d I Say“ von Ray Charles, das gerade ein Hit im Radio war. Als er zu der Stelle kam, an der die rechte Hand kurz pausierte, bevor sie den Riff am Ende der Strophe weiterspielte, verhaspelte er sich aber. Er versuchte es ein paar Mal, bekam es jedoch nicht wirklich auf die Reihe. Da sich die anderen Jungs nun um das Klavier versammelt hatten, stieß einer von ihnen den Pianisten vom Hocker, um es selbst zu versuchen. Auch er scheiterte, woraufhin der nächste sich aufs Glatteis wagte. Das ging vielleicht fünf oder sechs Typen lang so dahin, bis endlich Bouncin’ Bill die Bühne betrat, um diesen Trupp hinter die Bühne zu scheuchen.
Während ich dieses Schauspiel verfolgte, dachte ich mir: Das ist nicht richtig, das wirkt sehr amateurhaft. Ich schwor mir in diesem Augenblick, so etwas niemals während „meiner Show“ zuzulassen. Da war ich 14 Jahre alt.
Ich glaube, dass es dieselbe Show war, bei der ich noch eine weitere Lektion in Sachen Showbiz lernen durfte. Bouncin’ Bill kündigte den nächsten Act an, das Publikum jubelte und applaudierte. Aber nichts geschah! Niemand kam auf die Bühne. Er sagte noch einmal den Namen der Band, und wieder tat sich nichts. Nach ein paar weiteren Versuchen machte sich Bill auf in Richtung Backstage-Bereich, und schlagartig rannte eine Gruppe von Leuten in völlig gleichen Anzügen auf die Bühne. Bouncin’ Bill war offenbar ganz schön angepisst und machte seinem Ärger am Mikro Luft: „Da hat wohl jemand ein gutes Blatt und wollte es ungern aufdecken.“
Ich zog daraus die Lehre, dass man sein Publikum gefälligst nicht wie Dreck behandelte. Schließlich waren sie hier, um dich zu sehen! Trotz gelegentlicher Eskapaden bekamen wir jedoch vornehmlich gute, professionelle Bühnenshows im Oakland Auditorium geboten. Was ich zu Füßen von James Brown und Jackie Wilson lernte, war, wie man unterhielt.
Für das neunte Schuljahr wurde ich wieder auf eine katholische Schule, St. Mary’s, geschickt. Auch meine älteren Brüder hatten sie von der neunten Klasse bis zur ihrem Abschluss besucht. Dort gab es nicht allzu viel, was mich interessierte, doch immerhin hatten sie an der St. Mary’s einen Knabenchor. Das war doch etwas! Eines der Lieder, das wir einstudierten, war „There Is Nothing Like a Dame“ aus dem Musical South Pacific mit Textzeilen wie „We got mangoes and bananas …“
Wenn Musik alles ist, was du im Leben hast, dann klammerst du dich regelrecht daran. Als ich an diese Schule kam, war da dieser Dekan namens Bruder Neil. Er ließ mich nicht lange im Unklaren: „Ich hatte bereits deine beiden Brüder hier und habe ein Auge auf dich. Wir sehen uns dann beim Nachsitzen.“ Damit sollte er recht behalten.
Doch nach meinem ersten Schuljahr brannte Bruder Neil mit der Empfangssekretärin durch, trat aus dem Orden aus und heiratete. Ein paar meiner Freunde wurden vom einen oder anderen Ordensbruder angegraben, was wir ziemlich eklig fanden. In meiner persönlichen Wahrnehmung erhielt die strahlende Fassade der katholischen Kirche dadurch nur noch ein paar weitere hässliche Risse.
Einmal sollte ich beim Nachsitzen 1000 Mal irgendeinen Satz schreiben. Vielleicht „Ich darf in der Klasse nicht Kaugummi kauen“ oder so. Egal, meinem Füller ging irgendwann die Tinte aus, was ich aber niemandem mitteilen konnte. Auch die Hand heben oder einfach aufstehen war nicht drin. Also schrieb ich einfach mit dem leeren Füller weiter. Wenn man genau hinsah, konnte man auch tatsächlich die Abdrücke erkennen, wo sich die Füllerspitze ins Papier gegraben hatte. Der Bruder, der uns beaufsichtigte, warf einen Blick darauf und herrschte mich an: „Bist du verrückt?“
Ich hätte es wissen müssen. Bei meiner Geburt war die Erbsünde auf mich übergegangen, und daran war so ein Typ, der vor Millionen von Jahren gelebt hatte, schuld. Hätte ich mir nicht denken können, dass einem beim Nachsitzen besser nicht die Tinte ausgeht?
Als ich ein anderes Mal nachsitzen musste, nahm mich einer der Brüder, ein älterer Herr, beiseite. Ich hatte es nicht leicht in der Schule und freute mich nicht gerade auf den Unterricht. Der Bruder begann also ein Gespräch mit mir. Man sollte nicht vergessen, dass das alles sehr religiöse Leute waren, die nicht unbedingt über Sex sprechen sollten. Andererseits hatten sie es mit einer Horde pubertierender Jungs zu tun, deren Hormone verrücktspielten. Diese Jungs dachten vermutlich alle paar Sekunden an Sex, das heißt, wenn sie beim Gedanken daran nicht schon die Besinnung verloren hatten. Im Verlaufe unseres Gesprächs erkundigte sich dieser Ordensmann nun danach, ob ich mitunter über sexuelle Dinge nachdächte, was ich bejahte. Und er sagte: „Na ja, vielleicht sind ja deine Unterhosen zu eng.“ Daran erinnere ich mich noch gut. Ich wusste gar nicht, was ich darauf antworten sollte, und dachte nur: Au Backe, jetzt geht’s los. Der Bruder brät dich an.
Zum Glück gab es aber die Musik. Wir hatten eine kleine Band an der St. Mary’s aus der Taufe gehoben, in der Baynard Cheshire gemeinsam mit mir Gitarre spielte. Baynard besaß eine kleine E-Gitarre, eine National. Manchmal tauschten wir, und er spielte meine Silvertone. Ron White, ein Typ, der richtig gut spielte, trommelte bei uns, und John Tonaga spielte Klavier. Wir hatten, glaube ich, weder einen Bassisten noch einen richtigen Namen, obwohl wir uns womöglich irgendwann einen ausgedacht haben.
Einmal nahm ich die Jungs für einen Auftritt mit zur El Cerrito High. Als unsere kleine Band an der St. Mary’s auftrat, hieß der Direktor Bruder Frederick. Er war ein wenig zu kurz geraten, was mir bloß auffiel, weil er ständig überkompensierte. Irgendwann erfuhr ich, dass man das Napoleon-Komplex nennt. Damals hörte ich gerade viel Elmore James; er inspirierte mich zum Erlernen einer Vibrato-Technik, bei der man drei Töne in E-Dur griff, ähnlich dem hohen Part von Link Wrays Song „Rumble“. Man schlug ein oder zwei Mal an und schüttelte sich dann wie ein Irrer, um Elmore zu imitieren. Wir standen also im Turnsaal der St. Mary’s und spielten irgendein rasantes Rock ’n’ Roll-Instrumental, und ich fing an, ebendiese Nummer abzuziehen. Ich schüttelte mich, und der Sound, der erklang, war dieses BIIIIIEEEEEAAAAAUUUUUHH! Die Kids fuhren alle darauf ab. Wenn etwa jemand behauptete, wir hätten sie zur Raserei gebracht, würde ich das nicht abstreiten wollen.
Und plötzlich: Stille! Irgendjemand hatte uns den Stecker gezogen. Ich blickte auf und sah Bruder Frederick. Er runzelte verächtlich die Stirn, und mir dämmerte, dass ich die schwerste aller Sünden begangen hatte: Ich hatte mich nämlich während des Spielens rhythmisch bewegt. Das war mir selbst gar nicht aufgefallen! Das tut es übrigens bis heute nicht. So ist Rock ’n’ Roll nun mal – das gehört einfach dazu!
In Bruder Fredericks Augen war dies jedoch absolut verdammenswert: „Diese abscheuliche Musik ist der Untergang der ganzen Schule!“ In diesem Moment verlor ich jedenfalls jegliche Motivation, an der St. Mary’s meinen Abschluss zu machen. Ich dachte mir nur, was dieser Typ doch für ein Knilch war. Ein wandelndes Klischee!
So verließ ich mitten im zehnten Schuljahr St. Mary’s. Ich weiß nicht, ob die Schule mich einfach nicht mehr wollte. Auf jeden Fall war ich sehr erleichtert darüber, dass mir so ein Neustart an der El Cerrito High ermöglicht wurde. Es wirkte sich auch sehr positiv auf meine Noten und meine Anwesenheit aus, obwohl es eine Weile dauerte, bis ich endlich Fuß gefasst hatte. Am ersten Tag stellte mir mein Biologielehrer eine Frage, woraufhin ich mich von meinem Platz erhob, um zu antworten. So war es nämlich Usus an der St. Mary’s. Meine Mitschüler reagierten jedoch mit einem deutlich hörbaren Murmeln, und der Lehrer sagte: „Eine ausgezeichnete Antwort – und übrigens: Hier musst du nicht aufstehen.“
Dieser Vorfall war mir zwar einen Augenblick lang peinlich, doch dann sah ich dieses hübsche Mädchen, wie es mich freundlich anlächelte. Sie trug eine Brille und erkundigte sich nach meinem Namen. Mich durchfuhr es: Wow, hier gibt es doch tatsächlich Mädchen! Alles war so heiter und unkompliziert. Mann, ich liebte die El Cerrito High!
Als ich 16 war, war ein Auto zu haben das Allergrößte. Ich wollte den Führerschein machen, aber meine Mom war dagegen. Meine älteren Brüder hatten sich Strafzettel eingehandelt, und sie wollte sich das Theater fortan ersparen. Mit 15 hatte ich einen Job an einer Tankstelle bekommen, an der vor mir schon Tom gearbeitet hatte. Ich sparte mein Geld, und als ich schließlich 17 war, zog ich los und kaufte mir ein Auto, das ich in unserer Einfahrt parkte. Zu meiner Mom sagte ich, dass ich vielleicht doch den Führerschein machen sollte, wo ich doch ein Auto besaß.
Es war ein Ford Fastback, Baujahr 1948, mit 48.000 Meilen auf dem Tacho. Ein tolles Auto! Die Polsterung war in einem Traumzustand. Ich hatte 100 Dollar dafür hingelegt, obwohl ich den Verkäufer eigentlich auf 90 runterhandeln wollte. Zur Ausstattung gehörte ein Motorola-Radio mit einem kleinen Elektromotor, der grrrrr machte, wenn man auf einen Knopf drückte, um den Sender zu wechseln. Ich installierte einen Kipphebelschalter, damit ich zwischen meinen Lieblingssendern, KEWB und KDIA (vormalig KWBR), wechseln konnte.
Ich wollte mir irgendwann einen Hot-Rod bauen und schraubte dafür den Wagen auseinander. Eine schlechte Idee! Von nun an lud sich nämlich die Batterie nicht länger auf, sodass der Motor oft nicht anspringen wollte. Ständig musste ich die blöde Karre anschieben. Weil ich ein Idiot war, bescherte mir dieser Wagen noch etliche intensive Momente. Schließlich verkaufte ich ihn für 40 Dollar an jemanden von der Tankstelle.
Bis heute schuldet er mir noch 20.
Meine erste richtige Freundin war eine Einser-Schülerin, der es irgendwie ein Anliegen zu sein schien, dass auch ich einer wäre. Nichts motiviert einen so sehr, sich zu einem Musterschüler zu entwickeln, wie diese Art von Freundin. Ich war 17 und sie ein Jahr jünger. Irgendwann verließ sie mich dann für einen Jungen namens Fred. Ich fuhr eine typische Großmutter-Schüssel und er einen Hot-Rod mit offenliegendem Motor und jeder Menge Chrom. Außerdem war Fred ein Jahr älter als ich. Er belegte den Mechaniker-Kurs, ich saß in der Geometrie-Klasse. Ich nehme an, dass meine Freundin in dieser Phase ihres Lebens der Raubein-Masche zugetan war und sich schließlich eingestehen musste: „Yeah, eigentlich will ich in diesem Auto sitzen!“ Das war wie ein Schlag in die Magengrube, eine Harpune durch mein Herz.
Diesen jugendlichen Schmerz verarbeitete ich in einem Song, „Have You Ever Been Lonely“. Ihr kennt sicher alle diese kleinen Anzeichen dafür, dass irgendetwas schiefläuft. Dann gibt es da noch diesen Typen, der ziemlich nett zu deinem Mädchen ist. Und man selbst ist wieder mal der Letzte, der es mitbekommt. Ich komponierte den Song auf dem Piano. Der Vibe der Nummer ähnelte ein bisschen jenem von „Where Have You Been (All My Life)“ von Arthur Alexander oder „Love You So“ von Ron Holden and the Thunderbirds. Ich spielte den Song auf dem Klavier, und Tom sang. „Have You Ever Been Lonely“ enthält ein Solo, das in dieselbe Kerbe haut. Wir nahmen den Song schließlich 1961 für Wayne Farlows Orchestra Records auf. Es war unsere zweite Single bei seinem Label. Auf der Platte stand „Tommy Fogerty and the Blue Velvets“. Als wir den Song in meinem Wohnzimmer einübten, sagte Wayne: „Ich kann das Solo nicht hören. Spiel es doch bitte höher!“ Also spielte ich es eine Oktave höher. Zwar hätten wir das Solo beim Abmischen einfach hervorheben können, aber so stach es nun nicht nur heraus, nein, der Song erhielt einen anderen Charakter. So etwas nennt man „arrangieren“, und es war ein sehr guter Vorschlag. Diese Lektion merkte ich mir für die Zukunft.
Auf dieser Aufnahme spielte Doug Schlagzeug und ich das Piano, nicht Stu. Ich denke nicht, dass er irgendetwas beitrug – außer er spielte den Anfangsakkord auf der Gitarre: Brrrrring! Als ich den Song schrieb, sang ich die Nummer ein wenig aggressiver ‒ inklusive ein paar mehr Hicksern ‒ als Tom auf der Platte. Tom sang ihn süßlich und rein, was auch sehr cool war. Auch Mom gefiel „Have You Ever Been Lonely“. Das war schon ein ziemlich guter Song. Ich bemühte mich sogar mit Erfolg um ein Copyright und trat der Broadcast Music Incorporated (BMI) bei. Rückblickend ist es schon witzig ‒ und gleichzeitig auch einigermaßen traurig ‒, dass ich damals, mit gerade einmal 16 Jahren, wusste, dass dies der richtige Schritt war.
Irgendwann um das zehnte Schuljahr herum traf ich auf Bob DeSousa, der in Berkeley ein Studio namens Sierra Sound Laboratories führte. Ich fand ihn im Telefonbuch. Als ich ihn anrief, sagte ich: „Ich möchte ins Studiogeschäft einsteigen.“ Bob lud mich ein und ließ mich meine Gitarre mitnehmen, um zu experimentieren. Um dorthin zu kommen, musste ich den Bus nehmen, und ich besuchte Bob von nun an regelmäßig. Er wusste, wie man Slapback-Echo mithilfe eines Aufnahmegeräts erzeugte, und genoss es, neue Sounds zu kreieren. Ich hing ziemlich oft bei ihm im Studio ab und sammelte viele Erfahrungen. Oft alberten wir nur herum. Ich klimperte auf dem Klavier, um herauszufinden, wo die perfekte Position für das Mikro war. Ich war quasi Bobs Versuchskaninchen. Bob schien ziemlich erstaunt darüber zu sein, dass ich einfach so einspringen konnte, um Hintergrundgesangsharmonien oder sogar ein paar Gitarren-Parts beizusteuern.
Außerdem durfte ich mit seiner Ausrüstung experimentieren. Die Blue Velvets nahmen ein Instrumentalstück in der Art von Floyd Cramer bei ihm auf, „Happy Little Thing“. Ich glaube, der Titel stammte von Doug Clifford. Dann war da noch das von Gitarren dominierte Instrumental „Bittersweet“ und das schwermütige „Last Man on Alcatraz“ (ebenfalls ein Instrumental).
Als Bob auffiel, dass ich ein bisschen Klavier spielen konnte, buchte er mich sogar für ein oder zwei Country-Sessions, zu denen ich ein paar Floyd-Cramer-Licks spielte. Ich mochte Bob sehr, weil er nicht auf mich herabsah, obwohl ich erst 16 war.
Angesichts meiner Begeisterung für den Aufnahmeprozess wird es euch wohl nicht überraschen, dass ich bereits von Kindesbeinen an von Tonbandgeräten fasziniert war. In der Grundschule teilte ich dieses Interesse mit meinem Freund Bob Carleton. Zusammen führten wir Comedy-Nummern von Stan Freberg wie „Christmas Dragnet“ vor und bewegten dazu synchron unsere Lippen. Einer von uns trug dabei einen Trenchcoat und eine Polizeimütze, während der andere in die Rolle des Interviewers schlüpfte. Den Text dazu kann ich immer noch auswendig.
1956 veröffentlichte das Duo Buchanan and Goodman die Comedy-Platte „The Flying Saucer“, auf der eine Geschichte erzählt wurde, die von Ausschnitten bekannter Rock ’n’ Roll-Hits unterbrochen wurde. Um Ähnliches zu bewerkstelligen, benutzten Bob und ich dieses Gerät der Marke Wollensak, das Tom bei uns zu Hause angeschleppt hatte. Einer unserer Nummern hieß „The Daytime Ghost“. Darin ging es um einen Geist, der den Bezug zu Halloween verloren hatte, weil er tagsüber erschien. Bob und ich schrieben diesen Sketch gemeinsam und wählten die Songs zusammen aus. Wir beide kannten unsere Schallplatten gut, aber als Kind wusste ich jede einzelne Textzeile zu jedem einzelnen Song und übernahm alle Sprechparts.
In der zehnten Klasse besorgte ich mir dann ein Aufnahmegerät von Sony, mit dem man dem ursprünglichen Track Overdubs hinzufügen konnte. Ich hatte den vorangegangenen Sommer damit verbracht, im Haus meines Vaters in Santa Rosa auf meine jüngeren Brüder aufzupassen, damit ich mir das Gerät leisten konnte, das ich bei Louis Gordon Music gesehen hatte. Allerdings brach Dad sein Wort, und ich war sehr wütend darüber, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Doch auch seine mangelnde Bereitschaft, mich zu unterstützen, konnte mich nicht bremsen. Ich glaube, ich kaufte das Ding schließlich mit dem Geld, das ich beim Zeitungsaustragen verdiente.
Beim Einsatz von Overdubs ließ ich mich von Les Paul beeinflussen. Auf seinen Aufnahmen, auf denen ihn Mary Ford als Sängerin begleitet, ergänzte sie nämlich ihren eigenen Harmoniegesang. Auf Songs wie „Vaya con Dios“ oder „How High the Moon“ waren das regelrechte Chöre. Mary sang alle Stimmen, und Les Paul war die Band. Sie klangen fantastisch zusammen.
Das Sony-Aufnahmegerät war grau und mit Tweed und Vinyl bedeckt. Es war eine echte Offenbarung für mich, denn nun konnte ich festhalten, was ich in meinem Kopf hörte. Von da an arbeitete ich nur mehr damit. Während der ganzen Highschool verkroch ich mich unten in meinem Schlafzimmer und nahm auf. Das Badezimmer diente mir dabei zur Erzeugung von Echo-Effekten. Ich verbrachte buchstäblich Hunderte Stunden damit, zuerst Harmonien zu meinen eigenen Gesangsspuren hinzuzufügen und dann noch Gitarren-Spuren zu ergänzen. Auf diese Weise lernte ich unglaublich viel darüber, was sich echt und nach Rock ’n’ Roll anhörte. Man könnte sagen, dass darin der Ursprung meiner Ein-Mann-Band-Methode lag.
Viele meiner Aufnahmen erinnerten stark an die Ventures inklusive kleinerer Lead-Parts. Ich nahm auch Folk-Songs auf, etwa „I’ve Been Working on the Railroad“. Auch erinnere ich mich daran, wie ich da unten in meinem Zimmer „Can’t Help Falling in Love“ einspielte. Wir lebten in einem kleinen Haus, und man konnte rein gar nichts machen, ohne dass einen die anderen gehört hätten. Mom sprach mich etwa an: „Sag, was ist das, was du da spielst?“
„Ach, das ist ein Song von Elvis.“
„Der ist ja ganz wunderbar“, meinte sie.
Es war schon cool, ein wenig Feedback zu bekommen.
1963 traten wir mit den Blue Velvets bei einer Wiedersehensfeier der Abschlussklasse von 1953 auf. Irgendwann spielten wir auch „Green Onions“, woraufhin dieser Typ namens R. B. King auf uns zukam. Er war ein Schwarzer, was ich nur deshalb erwähne, weil vor allem unter uns weißen Kids die Meinung vorherrschte, dass Schwarze in der Lage seien, besonders gefühlvolle Musik zu spielen. Er fing also an, sich mit uns über „Green Onions“ zu unterhalten – direkt nachdem wir die Nummer gespielt hatten, wenn ich mich nicht täusche. Das ist nur deshalb erwähnenswert, weil das, was er sagte, nichts als die Wahrheit war. Eine Wahrheit, die so klar war wie ein Glas Eiswasser, das dir jemand ins Gesicht schüttet.
Viele Jahre lang habe ich gesagt, dass Booker T. & the M.G.’s, die Urheber von „Green Onions“, die größte Rock ’n’ Roll-Band aller Zeiten waren. Die meisten Menschen würden das wie selbstverständlich über die Beatles sagen, aber auch R. B. King war meiner Ansicht: Nie kam irgendwer an Booker T. & the M.G.’s heran. Ich beziehe mich dabei auf Dinge wie ihre gefühlvolle Spielweise, vor allem zwischen den einzelnen Beats. Es geht darum, wie viel sie mit so wenig zum Ausdruck brachten: Das ist eine der Grundregeln, die immer gelten werden – in der Musik, auf Platte, im Radio. Musste sich Chet Atkins etwa vor Steve Cropper in Acht nehmen? Nein. Aber ich traue mich zu behaupten, dass die meisten Leute eher Steve Cropper sein möchten und auch wir Booker T. & the M.G.’s zu unseren Vorbildern erkoren. Das blieb auch noch so, als wir bereits berühmt waren und Millionen Platten verkauften. Das Solo in „Proud Mary“? Da gebe ich mir die größte Mühe, Steve Cropper nachzuahmen.
Als R. B. King uns nun ansprach, kam er gleich zur Sache: „Wisst ihr, wenn ihr ‚Green Onions‘ spielt, da fehlt etwas.“ Das wiederholte er gleich ein paar Mal: „Da fehlt etwas.“
Nun, ich dachte mir: Okay, wir sind schließlich jung und nur zu dritt, natürlich sind wir nicht so gut wie Booker T. & the M.G’s. Er sagte zwar nicht: „Ihr weißen Jungs stinkt!“ Aber R. B. King wies uns sanft darauf hin, dass „da etwas fehlte“ – zwischen den Noten.
Ich möchte das erklären. Vergleicht mal Hank Ballard and the Midnighters’ Originalversion von „The Twist“ mit Chubby Checkers Interpretation. Chubbys Version ist großartig, und ich liebe sie. Allerdings hatte er den Beat „begradigt“, wodurch der Rock ’n’ Roll-Faktor erhöht wurde, was den Song um einiges massentauglicher machte. 1986 war ich hin und weg, als ich Chubby auf der Bühne der Rock and Roll Hall of Fame traf. Es war ihm wichtig, mir zu meiner Arbeit mit Creedence mitzuteilen: „Das sind deine Songs … Du solltest diese Songs auch spielen!“ Chubby Checker gehört meiner Meinung nach genau dorthin, in die Rock and Roll Hall of Fame! Sofort!
Allerdings verfügt Ballards Original über mehr Feeling. Viele Jahre später spielte ich mit Hank in einem Club in New York City, nachdem er in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden war, und erwähnte ihm gegenüber, dass es den Blue Velvets nie gelungen sei, seinen Rhythmus zu spielen. Er strahlte mich an und sagte: „Ach, du meinst wie Sand und Vaseline.“ Das war wohl die beste Art, es auszudrücken. Und das war es auch, was R. B. King mir auf freundliche Weise darzulegen versuchte.
Manche Leute können einen Shuffle spielen, andere nicht. Ich möchte das Ganze keineswegs für kulturell oder ethnisch bedingt erklären, aber in der Regel sind es die Weißen, die keinen Shuffle draufhaben. Allerdings gibt es auch Ausnahmen: Chris Layton, der mit Stevie Ray Vaughan gespielt hat, ist einer der weltbesten Shuffle-Spieler überhaupt. Und ich glaube, dass ich über die Jahre hinweg selbst ganz gut darin geworden bin.
Später versuchte ich, Doug und Stu – vor allem aber Doug – zu erklären, was R. B. King gemeint hatte, und berief mich während der gesamten Entwicklung der Blue Velvets auf das, was R. B. King über den Shuffle-Beat gesagt hatte. Aber er ist letzten Endes viel leichter zu spielen als zu erklären.
Ein paar Jahre nach der Episode mit R. B., an jenem Abend, bevor ich meinen sechsmonatigen Dienst bei der Army antrat, spielten wir in einem Club außerhalb von Sacramento, vermutlich im Trophy Room. Ich war nicht gerade in der allerbesten Stimmung, fühlte mich melancholisch und niedergeschlagen. Wer wusste schon, was passieren würde? Wir wollten gerade mit einem Song loslegen, als ich mich zu Doug umdrehte und sagte: „Spiel einen Shuffle-Beat.“ Und er fragte: „Was ist denn ein Shuffle-Beat?“ Was ist denn ein Shuffle-Beat? Es fühlte sich an, als hätte mir jemand einen Tiefschlag verpasst. Er hätte genauso fragen können: „Was ist denn eine Gitarre?“ Wir schrieben inzwischen 1967 – und ich hatte seit 1958 vom „Shuffle-Beat“ gesprochen. Ich war sprachlos.
Ich muss gestehen, dass ich den Shuffle jahrelang wie die Pest gemieden hatte, egal, wie sehr ich ihn gebraucht hätte. Ich war mit meinen Creedence-Jungs beim Proben, und es tauchte immer wieder auf: das Shuffle-Problem. Kein Sand, keine Vaseline. Mitunter frustrierte mich das, und ich wurde sauer, vor allem auf Doug. Junge Musiker neigen zur Eile. Bei schnellen Songs geraten sie in einen Rauschzustand und spielen ein gutes Stück vor dem Beat. Oder sie schleifen hinterher, vor allem bei langsameren, funkigeren Nummern. Ich konnte fast den Geist von R. B. sagen hören: „Da fehlt etwas.“
Einige Male bekamen Creedence einen Shuffle-Beat mehr oder weniger gut hin, zum Beispiel bei unserer Coverversion von „Before You Accuse Me“. Es ist zwar nicht direkt Bo Diddley, aber für ein paar Jungs aus El Cerrito war es gar nicht so schlecht. Für unsere Fans nahmen wir diese kleine Geschichte mit dem Titel „45 Revolutions per Minute (Part 2)“ auf. Darin war ein Background-Song enthalten, „Thank You, Mr. J“, der sich eines Shuffle-Beats bediente und ziemlich „tight“ war.
Ich war ziemlich streng mit Doug. Das bin ich immer noch. Es ging um sein Timing. In den Achtzigerjahren war ich in Oregon auf der Jagd. Das war schon lange nach der Trennung von Creedence. Dort hatte ich einen Traum: Unser Zelt stand am Miller Creek. Um es zu erreichen, ohne ins Wasser zu fallen, musste man über eine Reihe von Steinen und Baumstämmen hüpfen. In meinem Traum repräsentierten die Steine und Felsen den Beat. Ich befand mich mit Doug Clifford im Wald, und ich bahnte mir meinen Weg über die Steine, um auf die andere Seite des Miller Creeks zu gelangen. Dann kam Doug, der ‒ plitsch, platsch ‒ jeden Stein verfehlte und ins Wasser trat.
Ich rief ihm zu: „Nein, nein, nein, du musst auf die Steine springen! Auf dem Beat!“ Mein Traum handelte von Timing, darüber, dass man auf dem Beat spielen musste. In unseren Anfangstagen war das ein großes Thema – nicht auf dem Beat sein. Worauf ich hinauswill, ist, dass nicht alles verlorene Liebesmüh war, aber ein enormer Aufwand und viel Hartnäckigkeit nötig waren, um ans Ziel zu gelangen.