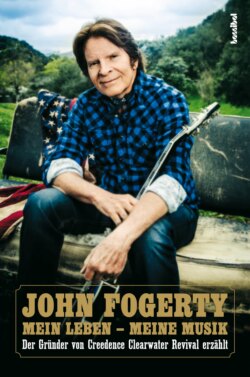Читать книгу Mein Leben - Meine Musik - John Fogerty - Страница 9
ОглавлениеALS ICH DIE FÜNFTE KLASSE besuchte, kam ich zu dem Schluss, dass ich etwas Geld dazuverdienen sollte. Damals gab mir meine Mom einen Vierteldollar Taschengeld. Das ließ auf keinen Fall große Sprünge zu.
Die Oakland Tribune musste am Sonntagmorgen bereits um 4 Uhr ausgeliefert werden, und man brauchte zum Ausliefern einen Erwachsenen, der einen im Auto durch die Gegend fuhr. Meine Mom war dazu nicht bereit. Also übernahm ich stattdessen einen Job als Zeitungsausträger bei der Berkeley Gazette, jener kleinen Zeitung, bei der mein Dad angestellt war. Sie wurde am Sonntag nicht ausgeliefert. Außerdem befand sich die Ausgabestelle der Zeitung nur zwei Straßen von unserem Zuhause entfernt, neben dem Friedhof ganz oben in der Fairmont Avenue. Auf meiner Route musste ich auch nur ungefähr 35 Haushalte in den Straßen diesseits der Harding Grammar School beliefern. Wenn alles glattlief, verdiente ich so zwischen 20 und 25 Dollar im Monat. Allerdings stellte sich heraus, dass ein paar Leute bei der Zeitungsausgabe gewissenlos agierten. Obwohl ich nur 35 Kunden belieferte, erhielt ich nämlich manchmal 40 Exemplare der Zeitung. Für diesen Überschuss musste allerdings ich geradestehen. Deshalb musste man das bei der Berkeley Gazette melden. Auf jeden Fall passierte mir das öfter. Das zog sich über Monate hin. Manchmal hörte es auf, nur um dann wieder vor vorne loszugehen. Als ich einmal nur 31 Zeitungen für 35 Haushalte erhalten hatte, reichte es mir, und ich drehte den Spieß um. Ich ging also zu einer dieser Zeitungsboxen, aus denen man sich für zehn Cent auf Vertrauensbasis eine Ausgabe holen konnte, nahm mir die vier Zeitungen, die mir fehlten, und lieferte sie aus. Ich war echt stinksauer. Jedoch erlaubte mir diese Art der Arbeit, Dinge zu kaufen – und diese Dinge waren üblicherweise Schallplatten.
45er-Singles waren der letzte Schrei. Wenn es einen Hit-Song gab, der einem gefiel, dann kaufte man sich die Single. Die ersten solchen Schallplatten, die ich erstand, waren „The Great Pretender“ von den Platters und „At My Front Door“ von den El Dorados. Ich kaufte sie als Weihnachtsgeschenke für meine Brüder Jim und Tom. Tom und mich verband das Thema Musik schon, da gab es Rock ’n’ Roll noch gar nicht. Da war etwa dieser Song „Billy’s Blues“ von Billy Stewart. Tom fuhr echt ab auf diese Nummer. Klarerweise gab es noch kein Internet, und diese Scheibe ließ sich nirgendwo auftreiben. Also marschierte ich in einen kleinen Laden im Einkaufszentrum und überredete die Inhaber, mir die Platte zu bestellen – obwohl sie schon vor eineinhalb Jahren herausgekommen war –, damit ich sie Tom zum Geburtstag schenken konnte. Ich wusste, dass das ein kostbares Geschenk war, wertvoller als eine Million Dollar, weil man die Platte nirgendwo kaufen konnte.
Ich erinnere mich an meinen Plattenspieler, als hätte ich ihn erst gestern mit meinem Geld vom Zeitungsaustragen gekauft. Er war rot und weiß und konnte Platten in drei Geschwindigkeiten abspielen. Das war ein willkommener Bonus für Gitarristen, da man so die 45er auf 33 Umdrehungen in der Minute herunterbremsen konnte, um die Soli zu lernen. Der Lautsprecher war einigermaßen unkonventionell. Gewisse Scheiben – etwa „Susie Q“ von Dale Hawkins – „sprangen“, weshalb man den Tonarm mit einer Münze oder einer Batterie beschweren musste. Und wenn ich duschte, legte ich mir am liebsten das erste Elvis-Album auf. Elvis sah ich zum ersten Mal in der Fernsehsendung der Dorsey Brothers im Januar 1956. Die Kids liebten seine Masche – die des jugendlichen Tunichtguts. Und auch ich fühlte mich von der Gefahr angezogen, die von ihm auszugehen schien. Ich glaube nicht, dass ich damals schon selbst Gitarre spielte. Nach diesem ersten Mal, vielleicht aber auch erst nach dem zweiten Mal, dass ich ihn gesehen hatte, posierte ich mit einem Besen vor dem Spiegel und imitierte seine verächtliche Mimik. Ich war hypnotisiert von ihm, obwohl ich nicht einmal wusste, warum eigentlich.
Es war die B-Seite von „I Want You, I Need You, I Love You“, die es mir so richtig angetan hatte. Ich war gerade zu Besuch bei meinem Dad, als beim Einkaufen im Lebensmittelgeschäft aus der Jukebox der Song „My Baby Left Me“ ertönte. Was war das denn? Ich rannte hinüber zur Jukebox, um nachzusehen. Elvis! „My Baby Left Me“ ist einer der besten Rock ’n’ Roll-Songs, der je auf Vinyl gepresst wurde. Die Gitarre war einfach so unbeschreiblich gut. Mensch, das hatte einfach Attitüde und Biss. Das machte auch einen großen Teil dessen aus, was die Scheibe so besonders machte.
Es war Scotty Moore, der die Rock ’n’ Roll-Gitarre erfand. Zwar kannte ich damals seinen Namen noch nicht und war auch noch kein Musiker, doch ich wusste auf der Stelle: Was auch immer das war, ich wollte genau das machen.
Als ich bei meinem Dad in Santa Rosa war, wollte ich mir eigentlich das erste Elvis-Album kaufen. Ich besaß vier Dollar und 14 Cent. Als ich im Einkaufszentrum damit aufkreuzte, war es allerdings vergriffen. So kaufte ich schließlich Bill Haleys Album Rock Around the Clock. Das Gitarrenspiel auf dem gleichnamigen Song war allen anderen weit voraus. Haleys Gitarrist Donny Cedrone, der ein wenig älter und fortgeschrittener als der typische Rock ’n’ Roller war, interpretierte seinen Part irgendwie jazzig. Sein Solo habe ich erst vor zwölf Jahren oder so richtig gelernt! Na ja, in der folgenden Woche besorgte ich mir dann noch die Elvis-Scheibe, und von da an hörte ich die beiden LPs so lange, bis ich sie auswendig kannte.
Ich sah Elvis schließlich 1970 im Oakland Coliseum. Da spulte er sein Programm ohne Punkt und Komma ab – die ganze Vegas-Masche mitsamt Karate-Moves und so. Elvis hatte eine Version von „Proud Mary“ aufgenommen, was natürlich eine große Ehre war, aber er schien sich nicht viel Zeit dafür genommen zu haben. Wenn ich etwas mehr Taktgefühl besäße, würde ich das vermutlich anders formulieren. Ja, es war schon etwas Besonderes, dass mein Idol einen meiner Songs sang, aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, er hätte eine Hammer-Version abgeliefert.
Ich habe Elvis leider nie persönlich kennengelernt, obwohl das echt cool gewesen wäre. Er wurde verrückt und verlor einfach den Boden unter den Füßen. So ist es uns allen schon mal gegangen – dem einen mehr, dem anderen weniger.
Ich befasste mich auf einer sehr persönlichen Ebene mit Elvis. Sogar als ich noch ein Kind war und mit meinem Geld vom Zeitungsaustragen im Plattenladen stand, brachte er mich dazu, über Wertvorstellungen nachzudenken. Ich überlegte, mir eine Elvis-Single zu kaufen, doch er befand sich gerade in seiner „Big Hunk O’ Love“- und „Doncha’ Think It’s Time“-Phase. Und ich dachte: Yeah, Elvis ist ja gar nicht mehr richtig Rock ’n’ Roll. Das war 1959, also noch relativ am Anfang seiner Karriere! Mir war aufgefallen, dass sich eine gewisse Sanftheit und ein poppiger Ansatz in seine Musik eingeschlichen hatten, und wenn ich nun auf eine einsame Insel abkommandiert worden wäre, wollte ich zumindest genug Rock ’n’ Roll-Platten in meinem Besitz wissen. Also kaufte ich mir damals „Red River Rock“ von Johnny and the Hurricanes.
Doch Elvis war immer noch Elvis, und in den Fünfzigerjahren hatte man die Wahl zwischen ihm und Pat Boone. Elvis war einfach cool – und Pat leider nicht. Versteht mich bitte nicht falsch: Pat Boone hat einige Nummern aufgenommen, die mir gut gefallen, etwa „Bernadine“, „Love Letters in the Sand“ oder „Moody River“. Das sind großartige Songs. Dann hatte er noch ein paar echt rührselige Sachen im Repertoire, zum Beispiel „April Love“. Diesen Song hörte ich zu den seltsamsten Anlässen in meinem Kopf. Viele Jahre später war ich in Oregon auf der Jagd und kletterte einen langen, langen Grat empor. Ich war außer Atem, schwitzte, und als ich endlich oben angelangt war, ertönte diese Melodie in meinem Schädel – dumdumdum DUM, „Aaaaaapril love!“ Ich dachte mir nur: Wo kommt denn das jetzt bitte her? Als wäre es mein höchstpersönlicher Soundtrack. Pat schien ein echt anständiger Bursche zu sein, aber, na ja, eben vielleicht ein bisschen zu nett. Dasselbe ließ sich von seiner Musik behaupten. Auf keinen Fall hatte ich vor, rührselig zu wirken, doch ein Bösewicht wollte ich auch nicht sein. Damals lautete die große Frage: „Zu welcher Gang gehörst du? Zappelst du wie Elvis oder schmachtest du wie Pat?“ Eine schwere Entscheidung. Oder eigentlich nicht.
Durch Elvis entdeckte ich noch andere Schallplatten, die auf Sun Records erschienen. Etwa „Ooby Dooby“ von Roy Orbison und „Blue Suede Shoes“ von Carl Perkins. Als Elfjähriger verspürte ich dieselbe Verbindung zu Carl, wie sie auch die Beatles empfanden. Es gab sogar Zeiten, in denen mir Carl viel mehr als Elvis bedeutete, weil Carl Gitarre spielen und singen und Songs schreiben konnte. Diese Kombination beeindruckte mich sehr.
Im Baseball nannte man Willie Mays einen „five-tool player“, einen Alleskönner. Carl Perkins war in meinem Augen sein musikalisches Pendant. Zieht euch nur seine Singles „Boppin’ the Blues“ / „All Mama’s Children“ oder „Blue Suede Shoes“ / „Honey Don’t“ rein und konzentriert euch auf den scharfen Klang in seiner Stimme. Sein Gesang ist echt der Hammer! Diese beiden Singles sind immer noch, ja, perfekt. Ich musste mir „Blue Suede Shoes“ sogar drei oder vier Mal kaufen, weil sich meine Exemplare abnutzten – so oft spielte ich sie! Nach all den Jahren bin ich immer noch verblüfft, wie gut „Blue Suede Shoes“ einfach klingt. Carl verströmt ein unbeschreibliches Flair. Und der Groove der Band, dieses Country-Boogie-Ding – einfach unglaublich.
Ich traf Carl während meiner 1986er Tour in Memphis. Es war wie die Begegnung mit einem Gott. Er sagte die tollsten Sachen. Der Produzent Chips Moman begleitete ihn, und Carl sagte zu ihm: „Die Art, wie dieser Typ hier schreibt, stell dir nur mal vor, was Sam mit ihm angestellt hätte, wäre er damals bei Sun aufgekreuzt.“
Jemand, den ich verehrte, Carl Perkins, zollte mir Anerkennung? Er brachte mich in Zusammenhang mit Sam Phillips und Sun Records? Das konnte doch bloß ein Traum sein, oder? Es ging jedenfalls runter wie Öl.
Jahre später spielte ich auf einer Benefizveranstaltung für Bill Clinton, und überraschend erschien Carl Perkins. Er sagte, er arbeite gerade an einem Album mit Tom Petty. Diese Möglichkeit wollte ich nicht verstreichen lassen. Ich sah ihn mit fragendem Gesichtsausdruck an und sagte: „Und?“ Carl sah mich an und sagte: „John, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mich bei ‚All Mama’s Children‘ unterstützen würdest.“ Er wusste, dass dies einer meiner Lieblingssongs war.
Unsere Version wurde nicht so gut wie das Original – ja, wie denn auch? –, aber ich bin dennoch froh, dass wir zusammen im Studio waren. In erster Linie wegen folgender Anekdote: Ich kam gerade von der Toilette, und Carl saß da mit einer Stratocaster. Er spielte darauf echt so richtig fieses Zeug. Ich hatte ihn für einen älteren, etwas gebrechlichen Mann gehalten, schließlich war er bereits 64 Jahre alt und hatte einige Operationen und einen Herzinfarkt hinter sich. Und da war er nun, rockte mit allem drum und dran so richtig drauflos. Einen Augenblick lang war ich völlig perplex.
Dann ging mir allerdings doch noch ein Licht auf: Natürlich kann Carl so spielen, immerhin ist er einer der zwei, drei Typen, die diesen Sound begründet haben. Warum sollte ich also davon überrascht sein? Carl verstarb 1998. Und bis heute habe ich seine Nummer in meinem Telefon eingespeichert.
Ich habe bereits erwähnt, dass ich mit acht via KWBR in Kontakt mit dem Blues kam: Muddy Waters, Howlin’ Wolf, B. B. King, Elmore James, John Lee Hooker. Howlin’ Wolfs Einfluss auf meinen Gesang war unermesslich. Hört mal genau hin: „Big wheel keep on toinin’.“ Damals fiel mir das aber nicht weiter auf. Es kam mir ganz natürlich vor.
Schnellvorlauf in den August 1968. Howlin’ Wolf tritt vor Creedence auf, was mir sogar heute noch rätselhaft erscheint. Ich stand da im Publikum und sah mir Wolfs ganzes Set an. Er war ein großer Typ. Obwohl er in erster Linie saß, war dies kein alter Mann, der einen volllaberte. Hier ging es um Leben und Tod. Hubert Sumlin begleitete ihn an der Gitarre, einer 335 Gibson, und er war ein wilder Hund. Er kam sehr jugendlich rüber und erinnerte ein wenig an Floyd Patterson, als dieser den Schwergewichtstitel gewann. Wir betraten die Garderobe und ich fühlte mich wie ein kleines Kind. Der Wolf rauchte seine Kools, genau so wie ich auch zu jener Zeit. Wir rauchten zusammen. Ich bin mir sicher, dass ihn das amüsierte. Er sah mich an, als ob er gerne meinen Kopf getätschelt hätte.
Für jeden gibt es eine Handvoll Typen, die es immer bringen. Für mich waren das stets welche, die sich einfach nicht kopieren ließen. Warum gibt es seit Jimmy Reed keinen mehr wie ihn? Weil eben keiner dazu in der Lage war. Jimmy spielte ein paar sehr hohe Mundharmonika-Soli. Keiner sonst begab sich in diese Sphären. Und auf der Gitarre hatte er es nicht eilig. Hie und da baute er ein paar sonderbare Noten ein. Ebendiese Noten waren aber sein Markenzeichen. Ich habe mir erst vor ein paar Tagen „Honest I Do“ ungefähr drei Mal angehört. Mann, das hat einfach dieses Feeling. Alles geschieht darin aus einem Grund. Die Band ist einfach so eingespielt.
Ich habe ihn bloß ein einziges Mal gesehen, und zwar 1964 im Berkeley Community Theatre. Jimmy war sturzbetrunken. Besoffen. Seine Gitarre war verstimmt, und er musste während seines Auftritts sitzen. Ich weiß noch, dass nach drei ziemlich zusammenhanglos vorgetragenen Songs irgendwer im Publikum rief: „Stimm deine Gitarre!“ Wenn man damals einer Ikone wie ihm so etwas auf die Bühne zubrüllte, musste schon viel im Argen liegen. Es war mir so unangenehm, das mitansehen zu müssen.
Später stellte sich heraus, dass ihn seine Plattenfirma um seine Tantiemen betrogen hatte, weshalb er sehr verbittert war und Alkoholiker wurde. Keine große Überraschung, oder? Obwohl ich später das Gleiche durchmachte, war mir dies eine Art Lehre. So wollte ich nicht enden. Versteht mich nicht falsch, ich war um nichts besser, aber immerhin war mir die Tragik des Ganzen durchaus bewusst.
Die neue Musik, die veröffentlicht wurde, als ich ein Junge war, war brandheiß. So kaufte ich mir etwa Bo Diddleys erstes Album. In meinen Augen war Bo wie Elvis. Außerdem war er der Auslöser für den ersten Streit, den ich mit den Jungs in meiner Band hatte. Für einen unserer Gigs bekamen wir insgesamt um die zwölf Dollar, und statt mir neue Saiten zu kaufen, ging ich mit meinen vier Kröten schnurstracks in den Plattenladen, um mir diese Scheibe von Bo zu holen. „Was?! Warum zum Geier hast du das getan?!“, hieß es da. „Weil auf dem Album gleich ein paar Songs drauf sind, die wir als Band lernen sollten, etwa ‚Before You Accuse Me‘.“ Viel später nahmen wir genau diesen Song auch tatsächlich auf. Wie ich es gesagt hatte!
Das erste Album von Bo war gerammelt voll mit gutem Zeug. Etwa „Who Do You Love?“ mit seinem „Totenkopf-Kamin“, der „Kobra-Krawatte“ und all den anderen lyrischen Extravaganzen. Diese Bildsprache faszinierte mich. Immer wieder habe ich betont, dass ein Teil meines Songwritings und der Bilder, auf die ich zurückgreife, ein wenig unheimlich und sonderbar ist und von düsteren Orten handelt. Diesen besonderen Raum, wo ich all dies vorfand, betrat ich durch eine Tür, die mir Bo Diddley aufhielt. Der Song „Bo Diddley“ ist wahrscheinlich mein Lieblingssong von ihm. Geht’s überhaupt noch gespenstischer? Die Masche mit dem Kinderreim – das primitivste Kauderwelsch! Und dennoch klang alles so voll im Radio. Ich kann nicht einmal sagen, ob da ein Bass spielt. Das ist aber auch egal. Bo zieht einfach sein Ding auf der Gitarre ab. Und dieses Solo! Einfach hypnotisch. Seine Magie beruhte auch auf den tiefen Trommeln. Den Toms, den Maracas – alles pulsierte. Sogar heute noch hört sich dieser Beat so mächtig an: bum da bum da bum. Über viele Jahre hinweg haben sich etliche Bands am Bo-Diddley-Beat versucht und sind nicht einmal annähernd an das Original herangekommen.
Mann, ich war schon ein Glückspilz! Ich sah Ray Charles gleich ein paar Mal, als der Song „What’d I Say“ sein großes Ding war. Er spielte auf einem alten, beigefarbenen 120 Wurlitzer. Später legte ich mir selbst auch eins zu. Außerdem spielte er auch Saxofon. Unglaublich.
Mein Lieblingsalbum von ihm war Ray Charles in Person. Gibt es überhaupt ein besseres Live-Album? Es wurde von einem DJ in Atlanta mit nur einem Mikro aus dem Publikum heraus aufgenommen. Die Show wurde im Sommer im Freien aufgezeichnet, aufgrund der Akustik kann man die heiße Luft fast schon hören. Gott, der Sound der Instrumente! Offenbar gab es vor Ort keine Echo erzeugenden Apparate. Es ist alles live und ganz natürlich. Rays Version von „The Night Time Is the Right Time“ ist viel souliger als die von Creedence, die sich mit ihrer kreischenden Gitarre mehr an Rock ’n’ Roll orientiert. Auf diesem Album findet sich auch „Drown in My Own Tears“. Alles daran ist einfach so zähflüssig. Er quetscht auch noch den letzte Tropfen Feeling aus dieser Nummer. Auf jeden Fall hatte dieses Album eine große Wirkung auf mich, und sein Einfluss hält noch bis heute an. Little Richards Einfluss auf mich ist allumfassend. 2008 traten wir gemeinsam bei den Grammys auf, da konnte ihm endlich sagen: „Richard, Mann, ich liebe dich, seit ich ein kleiner Junge war.“ Er hat die vermutlich beste Rock ’n’ Roll-Stimme überhaupt. Davon bin ich tatsächlich überzeugt. Seine Performances auf diesen klassischen Rock ’n’ Roll-Scheiben sind einfach perfekt: „Lucille“, „Keep a Knockin’“, „Good Golly, Miss Molly“ und „Send Me Some Lovin’“ sind Lehrbuchbeispiele dafür, wie ein Rock ’n’ Roll-Sänger klingen sollte. Dann gibt es da noch ein paar Nummern, die mir immer schon so viel bedeutet haben, etwa „Long Tall Sally“ oder „Slippin’ and Slidin’“. Besser geht es einfach nicht!
Schon als Kind bereitete es mir Freude, eine Aufnahme regelrecht zu sezieren. Die Musik war mir dabei ebenso wichtig wie der Gesang. Ich fand Gene Vincent einfach toll. Seine Songs erinnerten mich an Instrumentalstücke, zum Beispiel „Lotta Lovin’“, „Woman Love“ und natürlich „Be-Bop-a-Lula“. Wenn ich ihn mir auf meinem Plattenspieler anhörte, blockierte ich in meinem Kopf die Stimme, weil da so viel sagenhaftes Zeug abging. Menschenskind! Das war die simple Lehre, die ich daraus zog: Ohne den Gesang ist es eine Instrumentalnummer. Und wie ihr schon bald sehen werdet, präsentierte ich auf diese Weise meine Songs auch meinen Creedence-Jungs.
Wie herrlich, dass ich zu einer Zeit aufwuchs, in der viele Gitarren-basierte Instrumental-Rock ’n’ Roll-Platten aufgenommen wurden. Für mich als Jugendlichen waren sie sehr wichtig und ein toller Weg zu lernen. Ich denke da etwa an „Honky Tonk“ von Bill Doggett aus dem Jahr 1956. Eine unglaubliche Platte! Die war für mich damals immens wichtig. Auf der ersten Seite dominiert die Gitarre, auf der zweiten das Saxofon. Beide sind schlichtweg umwerfend. Dieser Groove! Als Junge beschloss ich eines Abends, mir „Honky Tonk“ beizubringen. Ich legte mir die Single auf und übte. Ich spielte den Song übrigens in F-Dur, so wie auf der Aufnahme. Das ist recht schwer, weil es kein einfacher Akkord ist. In den vergangenen paar Jahren habe ich ein paar dieser Online-Foren durchstöbert, und siehe da, dort unterhielten sich auch ein paar Gitarren-Verrückte über „Honky Tonk“. Da stand dann zum Beispiel: „Wenn du diesen Song spielst, dann sei ein Mann und spiele ihn in F!“ Wenn man ihn in E-Dur spielt, wird nämlich alles gleich viel einfacher. Das taten The Ventures und ließen den Song mehr nach Rock ’n’ Roll klingen. „Hide Away“ war auch so ein Song, der mich vom Hocker haute! Als Top-40-Hit lief er nicht nur auf R&B-Sendern. Sein Interpret, Freddie King, beeinflusste mein Gitarrenspiel und mein musikalisches Verständnis im Allgemeinen enorm. Er spielte einen Shuffle, doch der Klavierspieler legte es eher geradlinig an, wohingegen das Schlagzeug sich irgendwo zwischen beidem bewegte. Das erzeugt ein unglaublich cooles Feeling, gerade heute im Zeitalter der Computer-Musik, in dem alles auf total langweilige Weise aufeinander abgestimmt zu sein scheint. Meine erste Band, die Blue Velvets, spielte beinahe so viele Covers von Freddie King wie von Duane Eddy. Einer der Songs, die wir immer spielten, war „Just Pickin'“.
Manche mag es überraschen, aber „Flying Home“ vom Benny Goodman Sextet ist einer meiner Lieblingssongs. Er hat ein tolles Feeling, und ich liebe diese Melodie. Meine Mutter erzählte mir von Benny Goodman, weshalb ich als Junge loszog, um mir eine Platte mit der Aufnahme seines Konzerts in der Carnegie Hall im Jahr 1938 zu sichern. Ich weiß nicht viel über die ganzen anderen Big-Band-Typen, aber über Benny Goodman brachte ich so viel wie möglich in Erfahrung.
Nachdem ich Charlie Christian zum ersten Mal Gitarre spielen gehört hatte, fing ich an, mich auch für ihn zu interessieren. Schließlich sammelte ich alles, was ich von ihm in die Hände bekam. Ich habe sicherlich mehrere Hundert Stunden damit verbracht, seiner Musik zuzuhören. Ich glaube, man findet recht viel von Charlie Christian in meinem Stil, etwa den Swing und die Herangehensweise an die Melodie.
In einigen Passagen von „Keep On Chooglin’“ nehme ich direkt auf Charlie Bezug. Auch wenn ich mich auf das Americana-Ding einlasse, wie bei „Shortnin’ Bread“ oder „Down by the Riverside“, und versuche, alles simpel zu gestalten, beziehe ich mich wahrscheinlich auch auf Charlie Christian. Natürlich bin ich nicht so gut darin wie er!
Apropos Gefühle, die einen bei der richtigen Musik durchfluten: Als ich ein Junge war, gab es eine Platte, bei der so ziemlich alles stimmte: Rumble von einem Typen namens Link Wray. Um Himmels willen, diese Scheibe ist wirklich wichtig. Der Titelsong „Rumble“ tat auch alles, um seinem Namen gerecht zu werden. Er war einfach unfassbar bedrohlich.
Als die Nummer ein Hit im Radio war, stellten alle Kids die Lauscher auf. Alle begriffen, wie abgefahren cool der Song war.
Manche Kerle erhalten zu Recht den Titel „Gitarrengott“, und Duane Eddy gehört sicher dazu. Auch er hatte großen Einfluss auf mich. Ein James Burton stand vielleicht hinter Ricky Nelson und Scotty Moore im Schatten von Elvis, doch Duane war ein richtiger Frontmann. Auf dem Plattencover stand sein Name, der Name des Gitarristen. „Rebel Rouser“ haute mich um! Diese Melodie, dieses aufsässige Saxofon und diese Jungs, die alle zwölf Takte von einer Tonart zur nächsten modulierten. Wie kam er nur darauf? Das war schon wie ein Film! Sein „Three-30-Blues“ ist für jeden Gitarristen ein Highlight. Ich übte den Song auch mit meiner Band und spiele ihn auch immer noch gern. Manche Leute halten es für ein simples Blues-Stück, doch ist es gerade in seiner Simplizität auch verdammt mächtig. Ich hörte Duane den Song im Oakland Auditorium spielen, als auch B. B. King auf dem Programm stand. Hinreißend. Später erfuhr ich, dass B. B. sich im Anschluss zu Duane gesellte und ihn voller Anerkennung wissen ließ: „Mir gefällt dieser ‚Three-30-Blues‘.“
Keiner klingt wie Duane Eddy. Jede Note ist genau so gemeint, wie er sie spielt. Ich lernte so viel von seinen frühen Alben. Was mir außerdem auffiel, war, dass alle seine Nummern richtig großartige Titel hatten, so wie „Forty Miles of Bad Road“. Zweifellos ein cooler Song, aber er hätte ihm auch jeden anderen Titel verpassen können – schließlich hatten seine Songs ja keine Lyrics! Duane ließ sich all diese beschreibenden Songtitel einfallen, die zur jeweiligen Musik passende Stimmungen heraufbeschworen: „Rebel Rouser“, „Cannonball“, „The Lonely One“, „First Love, First Tears“ und natürlich noch viele andere. Dies war eine wichtige Lektion für mich als jungen Songwriter. Ich lernte, was alles einen großartigen Song ausmacht, und Duane ließ mich erkennen, dass auch ein cooler Songtitel eine wichtige Rolle dabei spielt.
Ich denke, dass fast alles ein Einfluss sein kann, zum Beispiel das Summen eines Bienenschwarms oder der Doppler-Effekt eines vorbeirauschenden Trucks. Und natürlich auch das Fernsehen. So rückte die Fernsehserie The Adventures of Ozzie and Harriet Ricky Nelson in mein Bewusstsein. Anfangs verfolgte ich die Serie wie der Rest der Welt auch. Ricky machte darin die coolen Sachen, die Teenager jener Zeit eben so machten, wie zum Beispiel seine Jeans in der Dusche waschen. Seine Musikkarriere wurde durch eine Folge in Schwung gebracht, in der er Football spielte – was Ozzie gefiel – und Musik machte, was wiederum Rick Spaß machte. Rick performte „I’m Walkin’“ und in der nächsten Woche „A Teenager’s Romance“, bei dem er mit beinahe geschlossenen Augen sang, während seine Lider zuckten. Er war gerade einmal 16 Jahre alt und unfassbar gut aussehend, einfach makellos! Für seine vierte Single „Stood Up“ holte er sich schließlich Verstärkung in Form des jungen Gitarristen James Burton, der zuvor noch bei irgendeiner Country-Band gespielt hatte. Als ich Burtons Sound – dangadangadanga – hörte, wusste ich, dass sich etwas verändert hatte. Oh, Mann! Das war ein totaler Paradigmenwechsel, quasi ein Neustart für Rock ’n’ Roll. Und ich war absolut einverstanden damit!
Als sie den Song im Fernsehen präsentierten, stand da dieser coole Typ an der Gitarre hinter Ricky. Als ich in der sechsten Klasse Schülerlotse war, fragte mich ein Mädchen, ob ich Musik möge. Ich antwortete: „Mir gefällt der Gitarrist, der Ricky Nelson begleitet. Der ist echt cool!“ Ich wusste noch nicht einmal, wie er hieß! Damals spielte ich auch noch nicht selbst Gitarre.
Im Gegensatz zu anderen Teenie-Idolen dieser Zeit wie Frankie Avalon, Fabian oder sogar Elvis damals spielte Ricky Nelson Rockabilly. Mir wurde Jahrzehnte später – im Jahr 1987 – die große Ehre zuteil, Rick Nelson posthum in die Rock and Roll Hall of Fame aufzunehmen. Genau vor mir saß Sam Phillips im Publikum. Ich sah ihn an und sagte: „Sam, er hielt dich ja ganz schön auf Trab!“ Ricky Nelson stand für Rockabilly – zwingendes, gefährliches Material. Selbst wenn er „Lonesome Town“ performte, war das eine Wucht. Zwar handelte es sich dabei um eine langsame Ballade, doch war sie weder schmalzig noch dumm: Das waren dann einfach ein paar Rock ’n’ Roller, die eine Ballade interpretierten. Ich erinnere mich auch daran, dass ich seine Version von „My Babe“ immer und immer wieder anhörte. Die Gitarre war einfach nur Oh, yeah!, falls ihr versteht.
In mancherlei Hinsicht war seine Version sogar besser als das Original von Little Walter. Der Song war ganz und gar von James erfüllt. James Burton. Er war phänomenal, und Ricky muss dies bewusst gewesen sein, schließlich gab es immer diese Momente auf seinen Singles, in denen James glänzen durfte. Hört euch nur mal „Believe What You Say“ an. Da gibt es das beste Gitarrensolo, das ihr je gehört habt. Als ob die Welt stehen bliebe. Ricky ließ alle wissen, dass dieses wilde Genie in der Stadt war. In diesen Tage definierten Leute wie Scotty Moore, James Burton und noch ein paar auserlesene andere die Rock ’n’ Roll-Gitarre. Und dabei war James gerade erst 18 Jahre alt! Ricky wirkte auf mich wie ein ganz normaler Teenager. Ein richtig netter Typ. Mich sprach das sehr an, während ich mir um Elvis, der mit Geld wild um sich warf, um protzige Ringe und Cadillacs zu kaufen, Sorgen machte. Ich fand das echt extravagant. Ricky war jedoch einfach ein Junge, der noch zu Hause wohnte. Er schien ein gutes Vorbild zu sein. Nie war von Wutanfällen oder irgendwelchen Skandalen die Rede. Auf mich wirkte er sanftmütig und bescheiden – auf keinen Fall durchgeknallt oder so. Das mag sich langweilig anhören, aber für mich waren das bewundernswerte Eigenschaften.
Obwohl mir viele Leute widersprechen werden, werde ich bis zu meinem letzten Atemzug darauf bestehen, dass man kein Irrer oder Geisteskranker sein muss, um guten Rock ’n’ Roll zu spielen. Immerhin kenne ich ja auch genug Typen, die einerseits richtig gute Musik spielen und andererseits solide Familienväter sind, zum Beispiel Bruce Springsteen und Dave Grohl. Rick bat mich sogar einmal, ihm als Produzent unter die Arme zu greifen. Das war während meiner langen düsteren Phase, vielleicht 1978 oder 1979. Leider war ich nicht in der Verfassung, seinem Wunsch nachzukommen. Ich konnte ja nicht einmal mich selbst produzieren – geschweige denn einen meiner Helden. Wenigstens durfte ich ihn kennenlernen. Das letzte Mal begegneten wir uns in Memphis, als wir in den Achtzigern eine Hommage an Sun Records aufnahmen. Er sang auf einem meiner Songs, „Big Train (from Memphis)“.
Mit dem Solo von „Believe What you Say“ ist ein interessantes Stück Musikgeschichte verbunden – zumindest bin ich dieser Ansicht: Einer meiner absoluten Lieblingssongs aller Zeiten heißt „Party Doll“ von Buddy Knox and the Rhythm Orchids aus dem Jahr 1957. Dieser Song machte mich zu einem Riesenfan von Buddy und seinem Sound. Die Drums auf diesem Track sollten sich als sehr einflussreich herausstellen, da es vielleicht der erste Rock ’n’ Roll-Song mit einem „Two-one“-Backbeat war. In den späten Achtzigerjahren hatte ich das Privileg, Buddy Knox persönlich kennenzulernen. Ich erwähnte ihm gegenüber das mit dem Drum-Beat. Er war sich des Meilensteins, den er damit gesetzt hatte, durchaus bewusst und antwortete stolz: „Ja, aber er ist verkehrt herum.“ Das entspricht auch der Wahrheit.
Egal, Buddy hatte noch einen anderen großen Hit in diesem Jahr, und zwar mit seinem Song „Hula Love“. Auch diese Platte besaß ich als Junge. Danach schien er von der Bildfläche verschwunden zu sein. Für einen Jungen waren ein paar Wochen schließlich so etwas wie eine kleine Ewigkeit. Doch auch diese Zeit verstrich, und Buddy war wieder da – mit einem Song namens „I Think I’m Gonna Kill Myself“. Ich liebte diese Nummer, aber sie war nirgendwo auf Vinyl erhältlich. Also musste ich sie erneut in meinem kleinen Plattenladen bestellen und mehrere Wochen darauf warten. Offenbar wurde die Thematik des Songs mancherorts als zu heikel eingestuft.
Aber damit ich nun auf den Punkt komme: Das Solo von „I Think I’m Gonna Kill Myself“ klang meiner Meinung nach exakt gleich wie jenes von „Believe What You Say“, und ich war mir dessen auch jahrelang sicher. Nachdem ich es aber unlängst wieder gehört habe, finde ich, dass sie sich doch ein wenig voneinander unterscheiden. Allerdings sind sie beide in derselben Tonart und im sehr hohen Bereich angesiedelt. Damals in den Fünfzigerjahren konnte man diese Töne praktisch nur auf einer Telecaster erreichen.
Jahrelang grübelte ich viele Male über das Mysterium dieser beiden Soli nach. Daher fragte ich Buddy Knox, als ich ihn schließlich traf, auch danach. Seine Antwort lautete: „Ich weiß nicht, ob sie gleich sind, aber Cliff Gallup hat schon stark Gitarre gespielt.“ Mann, wie war ich angesichts dieser Antwort doch aus dem Häuschen! Ich nehme an, dass nur wir Gitarren-Freaks es wissen, aber Cliff war der Typ, der auf „Be-Bop-a-Lula“ spielte. Und auch er verschwand (freiwillig) von der Bildfläche.
1957 war für die Rhythm Orchids ein ziemlich erfolgreiches Jahr. Sie begleiteten Buddy Knox bei „Party Doll“ und „Hula Love“, Songs, die sich millionenfach verkauften. Außerdem hatten sie mit Jimmy Bowen, dem Bassgitarristen der Gruppe, noch einen weiteren Millionen-Seller, „I’m Stickin’ with You“, und veröffentlichten zusätzlich noch Jimmys „Warm Up to Me, Baby“. Ich kaufte alle vier.
Im Sommer ’57 arbeitete ich am Russian River im kalifornischen Heraldsburg. Überall lief im Radio „That’ll Be the Day“. An meinem Arbeitsplatz wurden wir per Lautsprecheranlage im Freien damit beschallt. Ich verlor fast den Verstand. Diese rockende Gitarre, dieses rockende Schlagzeug, dieser Harmoniegesang und dann noch die Stimme des Leadsängers – ich kannte sie bis dahin nur als die Crickets. Und dann dieser Riff! Es klang alles einfach so verdammt richtig.
Zwar hatte jeder Interpret seine Band, doch der Fokus lag in der Regel auf dem Sänger, so wie bei Elvis und Ricky. Die Crickets waren jedoch eine Band. Sie waren die Band. Das war ein neuer Ansatz, und auf dem Cover ihres Debütalbums – The „Chirping“ Crickets – waren vier Typen in Anzügen abgebildet. Zu viert hielten sie zwei Gitarren und blickten direkt in die Sonne. Buddy Holly versucht zu lächeln, aber die Sonne scheint ihnen in die Augen, weshalb sie alle blinzeln. Dies waren offensichtlich keine reichen Jungs. Sie hatten auf das Dach eines hohen Gebäudes in New York City klettern müssen, um für dieses Foto zu posieren. Es ist kein schmeichelhaftes Bild, doch es erzählt eine Geschichte – eine Geschichte, die die Beatles nur noch veredeln würden. Die Weisheit, ein kompaktes Image zu transportieren ‒ und keinen zusammengewürfelten Haufen wie etwa die Grateful Dead darzustellen. Es war einfach ein bisschen mehr showbiz.
Ich war zu dem Schluss gelangt, dass Buddy Holly zu jenen Leuten gehörte, denen ich durch ihre ganze Karriere hindurch treu bleiben würde. Ich war bereit, jede seiner Platten zu kaufen. Zuerst waren das neben dem ersten Crickets-Album noch ein paar Singles.
In der achten Klasse trug ich nach wie vor Zeitungen aus, und eines Tages, als ich meinen Stoß entgegennahm, sprang mich eine Schlagzeile an: Buddy Holly war zusammen mit dem Big Bopper und Ritchie Valens bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Als Don McLean nun Jahre später in seinem Song „American Pie“ darüber sang, Zeitungen mit den News vom „day the music died“ auszutragen, dachte ich mir: Wow, genau das habe ich tatsächlich erlebt. Das war wirklich ein trauriger Tag für den Rock ’n’ Roll.
So um 1965 fiel mir ein Buddy-Album mit unveröffentlichten Versionen von Songs wie „That’ll Be the Day“, das in einer anderen Tonart gespielt war, in die Hände. Diese Version klang ganz anders als jene, die ein Hit gewesen war, und ich bin mir sicher, dass Buddy, wüsste er von dieser Veröffentlichung, sich im Grab umdrehen würde. Vielleicht haben ja Sammler ihre Freude an so etwas, doch als Musiker ist es mir peinlich. Interpreten müssen mit ihren Songs eine Art Evolutionsprozess durchlaufen, bevor ihnen eine Aufnahme gelingt, die sie der Öffentlichkeit zugänglich machen wollen. Der Rest ist eher nicht dafür geeignet und verschwindet in Archiven.
Da ich nicht möchte, dass mir dasselbe widerfährt, lasse ich meine Outtakes stets vernichten, so etwa auch eine frühe, unveröffentlichte Version von „Mystic Highway“ oder die Originalversion von „Wrote a Song for Everyone“. Die kann niemand herausbringen, weil sie nicht mehr existieren!
Es gibt ein paar Platten aus der Rock ’n’ Roll-Ära, die für mich über allen anderen stehen. Dazu gehören etwa:
„Deep Feeling“ von Chuck Berry, „Lost Dreams“ von Ernie Freeman, „Honky Tonk von Bill Doggett, „Blue Moon“ von Elvis Presley, „For Your Precious Love“ von Jerry Butler & the Impressions, „Little Boy Blue“ von Bobby „Blue“ Bland.
Und in letzter Zeit:„Island Style“ von John Cruz.
Ich glaube, dass ich Country zum ersten Mal im Fernsehen hörte. Da gab es diese Show, The Hoffman Hayride, die bei uns zu Hause ziemlich angesagt war. Ich erinnere mich daran, dass Jimmy Wakely dort auftrat und dass mir sein Look gefiel. Er war ein Cowboy und hatte diese große, goldgelbe Gitarre. Später tat er sich mit Margaret Whiting zusammen. Wenn ich mir ihre Sachen heute anhöre, dann wirken sie recht schmalzig, wie eine Art Nelson Eddy und Jeanette MacDonald auf Country, aber ihre Outfits waren toll!
Zu den aufregendsten Dingen, an die ich mich aus diesen frühen Tagen des Fernsehens erinnere, gehört Johnny Cash. Wir sprechen hier über 1956, und die meisten Unterhaltungssendungen hatten eine Tanz-Truppe wie die June Taylor Dancers am Start. Diese Tänzerinnen formierten sich gerne zu einem Kreis und wurden von oben gefilmt. Die Inszenierungen waren aufwendig und erinnerten an Filme von Busby Berkeley. Und mittendrin performte Johnny „I Walk the Line“. Das war echt krass. Da war sein Gesicht und hinter ihm nichts außer seinem Schatten, vielleicht noch ein einzelner Typ, der auf seiner Gitarre herumschrammelte, aber in erster Linie war da einfach nur Johnny, der von der Seite gefilmt wurde und aussah, als wäre er einer der Präsidenten vom Mount Rushmore. Ich saß einfach nur mit offenem Mund da, weil es so stark war. Das war etwas anderes als die June Taylor Dancers. Es war düster. Intensiv. Dieser Typ war einfach – imposant! Wow!
Natürlich liebte ich auch Hank Williams. Ich bin mir sicher, dass ich schon als Kind von ihm gehört hatte, weil ich mich an „Jambalaya“ und „Kaw-Liga“ erinnere, als wären es Kinderreime gewesen. Jedoch begann ich ihn erst bewusst wahrzunehmen, als ich die Single „Great Balls of Fire“ von Jerry Lee Lewis kaufte. Als ich nämlich die B-Seite auflegte, hörte ich Jerry Lees Version von „You Win Again“, die für sich selbst einmalig ist. Es ist einer der allergrößten Rock ’n’ Roll-Songs. Doch unter dem Titel stand „Hank Williams“, und meine Neugier war geweckt. Ich musste einfach mehr über diesen Typen in Erfahrung bringen, weshalb ich mich mehr und mehr mit seiner großartigen Musik auseinandersetzte. Songs wie „Lovesick Blues“, „I’m So Lonesome I Could Cry“ und „Your Cheatin’ Heart“ zogen mich total in ihren Bann. So wurde Hank zu einem meiner größten Einflüsse und bewohnt auch heute noch meinen persönlichen Olymp.
Ein weiterer Musiker, der auf meiner Liste von Country-Einflüssen ganz oben zu finden ist, ist Lefty Frizzell. Ich wollte auch immer schon eine Version von „Long Black Veil“ einspielen. Auch liebte ich Webb Pierce. Er hatte so viele großartige Songs, aber eigentlich reicht es schon vollkommen aus, dass „I Ain’t Never“ von ihm stammt. Diese Gitarre, Leute! Ich nahm die Nummer für mein Album The Blue Ridge Rangers auf. Chet Atkins gehört auch zu meinen Favoriten. Er war mir eine solche Inspiration. Keine Ahnung, ob es jemals einen Musiker gab, der mehr übte als Chet. Habt ihr schon mal was von „Yankee Doodle Dixie“ gehört? Das ist ganz schön ausgefuchst. Der Typ brachte alle Finger seiner beiden Hände zum Einsatz. In der Geschichte der Gitarre gibt es ein paar dieser Jungs, doch muss man schon viele Tausend Stunden Arbeit in seine Spielkunst investieren, um dorthin zu gelangen. Oder vielleicht gehören diese Leute einfach zu einem ganz eigenen Menschenschlag? Darüber machte ich mir tatsächlich ernsthafte Gedanken, da es mich so viel Zeit kostete, um mich als Gitarrist zu entwickeln. Jedoch stellt sich auch stets die Frage, ob es mehr darauf ankommt, wie intensiv man übt, oder ob es wichtiger ist, was bereits in einem steckt.
Merle Haggard ist auch einer jener Musiker, die damals wie heute – also viele Jahre später – einen starken Einfluss auf mich haben. Ich glaube, es liegt schon mal an seiner unglaublichen Stimme. Allerdings hat er im Laufe der Jahre auch einfach sehr viele gute Platten gemacht. Auch sein Songwriting spielt eine Rolle. Merle verfügt über eine solch nachdenkliche, intelligente, bescheidene, lebenslustige und raubeinige Sicht der Dinge! Er ist ein wahrer Gigant der Musik. Es dürfte auch kein Zufall sein, dass so viele dieser Jungs begnadete Songwriter waren und sind.
Als Teenager hörte ich schrecklich viel Buck Owens im Radio. Songs wie „Tiger by the Tail“, „Together Again“ oder „Crying Time“ waren sehr wichtig für mich. Dieses Näseln, diese Energie. Und Don Rich mit seiner Telecaster. Als die Beatles „Act Naturally“ von Buck Owens coverten, überraschte mich das nicht. George Harrisons ganzer Spielstil, sein Hybrid-Spiel mit den Fingern, diese Zupf- und Schlagtechnik – das alles war vom Country inspiriert. Hört euch nur mal „Help!“ an.
Ich traf Buck eigentlich erst irgendwann in den Achtzigerjahren, und zwar im Rahmen der Bay Area Music Awards (auch „Bammies“ genannt). Er trug eine Art Country-Sportjacke und einen Cowboyhut. Wir freundeten uns schließlich an, er überließ mir sogar eine seiner in Rot, Weiß und Blau gehaltenen Gitarren. Allerdings traf er bei mir so richtig den Nerv, als er mich irgendwann wissen ließ, dass Don Rich ein großer Fan von Creedence war.
Während ich mich mit Blues, Rock und Country beschäftigte, kam im Verlauf der Fünfzigerjahre der Folk-Boom – manch einer sprach auch von einer Bedrohung – immer mehr auf Touren, obwohl dies alles sogar schon vor den Weavers oder Pete Seeger seinen Ausgang genommen hatte. Zuerst köchelte die Szene in den Cafés vor sich hin, bis schließlich das Kingston Trio 1958 mit „Tom Dooley“ einen veritablen Hit verzeichnen konnte. Von da an ging die Sache richtig ab. Es folgten eine Reihe von Folk-Hits, was wiederum zu eigenen Festivals führte – und meine Mom war so nett, mich dorthin zu fahren. Als ich sie später fragte, warum sie nicht auch meinen älteren Bruder Tom mitnahm, meinte sie: „Ach, der hatte keine Lust.“ Ich befand mich damals einfach im richtigen Alter, nämlich zwölf, wohingegen Tom bereits 16 war und sich für Mädels und Autos begeisterte. Ich war jedoch ernst.
Die Folk-Festivals auf dem Campus der UC Berkeley wurden von meinem wunderbaren Gitarrenlehrer Barry Olivier veranstaltet. Dort sah ich Pete Seeger, Jesse Fuller, Mance Lipscomb, Lightnin’ Hopkins, Sam Hinton und Alan Lomax. Dies waren aber nicht einfach nur Konzerte: Es war eine Art Ausbildung. Ich war ganz hin und weg. Diese Folk-Festivals waren enorm ergiebig für mich und wie ein Fundament. Und nicht nur in Sachen Musik. Ich bin überzeugt, dass Folk viel mit meinen Überzeugungen davon verknüpft ist, wie die Welt funktionieren sollte. Tagsüber wurde bei diesen Folk-Veranstaltungen eine Reihe von Workshops angeboten. Pete Seeger referierte dort etwa über seinen Banjo-Stil oder dass Blues-Musiker wie Lead Belly Gitarren von Stella mochten, weil sie so robust gefertigt waren. Pete sprach mit einer solchen Leidenschaft und war voller Verehrung. Außerdem hatte er Filmmaterial dabei! Von Lead Belly! Oh, mein Gott, ich durfte Lead Belly sehen, wie er auf dieser alten zwölfsaitigen Stella spielte, und fünf Minuten später griff sich Pete ebenfalls eine Stella, präparierte seine Finger und spielte „Midnight Special“.„Goodnight Irene“ hatte ich schon als kleiner Junge gehört, als es meine Mom sang. Einen Film zu sehen, in dem Lead Belly es performte – nun, es klang wie das, was ich aus dem Radio kannte! Es war wie Muddy Waters oder Howlin’ Wolf, nur dass diese Jungs über Schlagzeug und E-Gitarren verfügten. Doch bei diesen Folk-Veranstaltungen war es beinahe verpönt, darüber zu sprechen. Ich begriff, dass es eine Folk-Polizei gab. Kommerzielle Musik wurde abgelehnt. Nach „Tom Dooley“ zerrissen sich etwa alle das Maul über das Kingston Trio: „Wer sind sie denn schon? Nur ein paar Kids vom College. Die haben sicher nie Baumwolle gepflückt!“ Dabei hatten sie doch nur einen Song neu arrangiert und interpretiert. Was sollte daran denn bitte so schlimm sein? Hatte Lead Belly nicht etwa dasselbe mit „Midnight Special“ getan? Die Folk-Puristen lebten einfach in ihrer eigenen kleinen Welt, in der Leute wie Gene Krupa keinen Platz fanden. Lightnin’ Hopkins war live unglaublich. Er hatte einen Riesenhit mit „Mojo Hand“ – auch eine der coolsten Scheiben überhaupt. Seiner Musik haftete dieses Geheimnisvolle, Verbotene, Kultige an, das dem weißen Mann grundsätzlich verschlossen blieb. Ich war also aufmerksam und versuchte, es zu begreifen. Eine mojo hand war in Wirklichkeit eine Affenpfote. Wow! Ich traf Lightnin’ Hopkins sogar und unterhielt mich mit ihm – ein paar Minuten, nachdem ich Pete Seeger auf demselben Festival kennengelernt hatte. Er war jedenfalls sehr liebenswürdig. Als ich ihm ein Stück Papier und einen Kugelschreiber überreichte, damit er mir sein Autogramm gab, schrieb er ein krakeliges X. Wenn ich ein Erwachsener gewesen wäre, hätte er meinen Wunsch sicher abgelehnt, um nicht preisgeben zu müssen, dass er nicht schreiben konnte. Dieses Stück Papier bewahrte ich lange Zeit in meiner Sockenschublade auf, bis es irgendwann verschwand. Allerdings bin ich der Meinung, dass die Erinnerung daran tatsächlich besser ist als das eigentliche Stück Papier. Immerhin hatte ich Lightnin’ Hopkins getroffen.
Pete Seeger war der beste Entertainer, den ich je erleben durfte, und außerdem ein unglaublicher Musiker! Wenn er eine Geschichte erzählte, dann bewegte er seinen hageren Körper hin und her. Und wenn aus seinem Mund „Michael, row the boat ashore …“ erklang, dann befand man sich gemeinsam mit Pete in ebendiesem Boot. Dann brachte er das Publikum noch dazu, ihn dreistimmig zu begleiten. Man dachte sich anschließend: „Verdammt, wie haben wir das alle nur eine ganze Stunde lang hinbekommen?“ Ich habe nie einen anderen erlebt, der das vermocht hätte. Keinen einzigen. Ich hab es ja selbst ein paar Mal versucht! Ich habe Frank, Sammy, Dino, Elvis und wie sie alle heißen gesehen – aber Pete Seeger verfügte über eine ganz besondere Qualität als Entertainer. Pure Magie! Es war authentisch und ging ihm mühelos von der Hand.
Ungefähr zu dieser Zeit, als ich ihn live sah, musste Peter vor dem Komitee für unamerikanische Umtriebe erscheinen. Er stellte sich seinen Angreifern aber entgegen und ließ sie wissen: „Ich habe das Recht auf meine Überzeugungen.“ Und diese Art von Haltung und Gesinnung wurde auch durch seine Musik befördert. So erreichte er die Leute viel besser als mit flammenden Appellen, was vor allem auf unbedarfte Kids wie mich zutraf. Da gab es also Menschen, die für eine Überzeugung eintraten und sogar starben, die Gutes für mich bewirken würde? Und wenn nicht genug Leute dafür einträten, würde ich nicht in Freiheit leben können? Das sprach mich alles sehr an. Ich liebte Pete und lernte so viel von ihm. Er spielte gerne Songs, die Botschaften vermittelten, doch verlor er auch nie aus den Augen, dass es auch darum ging, einfach miteinander zu singen und Spaß zu haben.
Was Folk-Musik betraf, so konnte man aus einem großen Repertoire schöpfen, und beileibe nicht alles war durchtränkt von Traurigkeit.
Aber obwohl ich auf Rock ’n’ Roll abfuhr, saugte ich auch diese Musikrichtung auf und fuhr total darauf ab. Auch wenn es mir damals nicht bewusst war, hat mich Pete mehr beeinflusst als die ganzen Rock ’n’ Roller.
Folk, Rock, Blues, Country – ich machte da keine Unterschiede. Ich war jung und für alles offen. So wollte ich auch etwa später einmal „Both Sides Now“ von Joni Mitchell mit Creedence covern. Ich liebte diese Nummer und dachte mir: „Mann, in meinem Stil und mit einer Rock ’n’ Roll-Band würde das sicher cool klingen.“ Leider wurde nichts daraus.
Ich bin auch heute noch so. Sobald ich einmal loslege, kann man mich nur mehr schwer bremsen. Ich habe noch gar nicht Songs wie „The Slummer the Slum“ von den 5 Royales oder „I Confess“ von den Four Rivers erwähnt. Letzteren coverte ich in den Achtzigerjahren, obwohl ich auf eine tiefere Tonart zurückgreifen musste. Nur Wahnsinnige kennen diese Nummer – und, jawohl, ich bin so ein Wahnsinniger.
Dann gab es da noch „Henrietta“ von Jimmy Dee and the Offbeats. Das war eine wilde Rockabilly-Nummer. „The Offbeats“ war ein herrlich blödsinniger Name. Schon ziemlich punkig, wenn man so will: „Wir sind beschissen! Erschießt uns doch!“ Der Song erschien 1958 auf dem Label Dot Records.
Der Bandname, das Label, das Plattencover, der Sound und die Abfolge der Songs – all diese kleinen Details waren mir sehr wichtig. Ein Album wurde durch diese Dinge nur noch mysteriöser für mich. Es fesselte einen und offenbarte sich schrittweise. Das ist etwas, was ich heutzutage an der Musik vermisse.
Das bringt mich zum Unterricht von Mrs. Starck. In der siebten und achten Klasse, als ich die Portola Junior High besuchte, belegte ich nämlich einen Kurs für Musikliebhaber bei eben jener Dame. Ihre Stunden umfasste Musikgeschichte, und auch Instrumente – in erster Linie Rhythmusinstrumente – kamen zum Einsatz. Ich war ein großer Fan dieser Stunden. Mrs. Starck hatte ihre Haare zu einem Zopf gebunden und trug Perlen. Sie hatte etwas von einem Beatnik und war hinreißend. Wir lernten etwas über Mozart und Beethoven, wobei mich der Umstand, dass Beethoven taub war, schwer faszinierte. Sogar Boogie-Woogie – Meade Lux Lewis, Albert Ammons und solche Leute – kamen in ihrem Unterricht zur Sprache. Mrs. Starck begegnete all diesen Themen mit großer Ernsthaftigkeit. Für sie war alles echte Musik, und Boogie-Woogie durfte ruhig im selben Atemzug mit Beethoven genannt werden. Das war richtig cool. Wir erfuhren sogar ein wenig über das Musikbusiness, etwa über die Bedeutung von Verträgen und dass diese oft unfair waren. Da hätte ich wohl ein bisschen besser aufpassen sollen.
Eines Tages wandte sich Mrs. Starck an mich: „John, du sammelst doch Schallplatten. Warum bringst du nicht ein paar von deinen Favoriten mit, damit wir sie uns anhören können und du uns erklären kannst, warum sie dir gefallen.“ Ich fand das so cool von ihr. In der nächsten Musikstunde spielte ich der Klasse „I’m Walkin’“ von Fats Domino vor. Ich liebte Fats, und es gefiel mir ungemein, wie sich dieser Song einfach seine Zeit zu nehmen schien. Außerdem brachte ich noch „Boppin’ the Blues“ von Carl Perkins mit. Möglicherweise auch „Henrietta“.
Mrs. Starck war sehr tolerant und eine große Inspiration. Statt mich daran zu hindern, am Klavier Rock ’n’ Roll zu spielen – und ich bin mir sicher, dass das damals noch ziemlich abscheulich klang ‒, ermutigte sie mich und vermittelte mir das Gefühl, dies sei die coolste Sache auf der Welt.
Am Ende des Schultages hatten wir üblicherweise Sportunterricht, der ganz in der Nähe ihres Klassenzimmers stattfand. Also stahl ich mich eines Tages aus dem Turnsaal davon, um mich ins Musikzimmer zu schleichen. Das war in der achten Klasse. Ich weiß nicht, woher ich die Chuzpe nahm, aber ich setzte mich ans Klavier und spielte einfach drauflos. Ich bin nämlich eigentlich ein sehr scheuer Typ. Plötzlich umstanden mich ein paar Kids. Ich spielte einige Sachen, die ich mir zu Hause beigebracht hatte: „Do You Want to Dance“ und eine paar Instrumentalstücke, die ich auf den schwarzen Tasten in Fis spielte. Das erinnerte an eine Art bluesigen Boogie-Woogie. Nachdem sich das ein paar Tage hintereinander wiederholt hatte, trat ich bereits vor einem richtigen kleinen Publikum auf. Eines Tages kreuzte auch Doug Clifford auf. Er ließ mich wissen, dass er Schlagzeug spiele und sogar seine eigene Ausrüstung besitze, weshalb wir vereinbarten, uns zusammenzutun.
Als ich schließlich bei ihm vorbeikam, stand da eine Snare-Drum auf einem Blumentopfständer und daneben ein einzelnes Becken. Das war alles. Ein wenig später organisierte sich Doug noch eine Hi-Hat von einem gewissen Rich Knapp, der das Ding im Werkunterricht angefertigt hatte. Das Ding mochte zwar selbst gebastelt sein, doch es funktionierte. Und so begannen wir, gemeinsam zu musizieren – ich mit meiner kleinen Gitarre und meinem Verstärker und Doug mit seiner Blumentopf-Trommel und dem Becken.