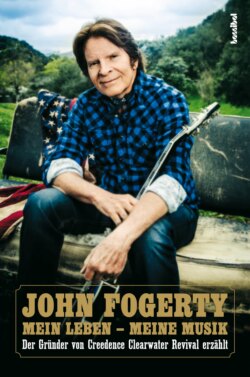Читать книгу Mein Leben - Meine Musik - John Fogerty - Страница 8
ОглавлениеMEINE MOM SCHRIEB MICH an einer katholischen Grundschule in Berkeley ein. Sie hieß School of the Madeleine – oder auch School of the Mad, wie wir Schüler sie gerne nannten. Sie lag ein paar Kilometer entfernt, was sich nicht nach einem sonderlich langen Schulweg anhört. Jedoch weiß ich noch, dass es jedes Mal eine halbe Stunde oder länger dauerte, dorthin zu gelangen. Oft rannte ich am Morgen aus dem Haus, nur um den Schulbus doch noch knapp zu verpassen. Unsere Lehrerin war eine 20-jährige Nonne namens Schwester Damien. Auch für sie war es das erste Jahr. Sie war eigentlich noch ein Mädchen, und ihr Weg durch das Schuljahr war gepflastert mit unerfreulichen Episoden. Schwester Damien war einfach überfordert. Irgendwann wurde uns mitgeteilt, dass sie einen Nervenzusammenbruch erlitten habe.
Einmal war sie so sauer auf die Klasse, dass sie uns alle nachsitzen ließ: „Ihr dürft nicht nach Hause. Ihr müsst alle auf euren Plätzen bleiben, und ich will keinen Mucks von euch hören.“ Da kommt plötzlich dieser kleine Zweitklässler mitsamt einem Putzfetzen herein und fängt pflichtbewusst an, das Podium, auf dem das Pult unserer Mutter Oberin thronte, zu polieren. Er ist so beschäftigt, dass er nicht mitbekommt, dass die ganze Klasse noch dasitzt. Schwester Damien verpasst ihm einfach so eine Ohrfeige. Zack! Das war bezeichnend für die Atmosphäre in der Klasse.
Um zur Schule zu kommen, musste ich allein zwei Blocks bis zur Bushaltestelle in der Colusa Avenue gegenüber dem Sunset View Cemetery gehen. Dann ging es den ganzen Weg die Solano Avenue hinauf. Wenn wir oben in Albany angekommen waren, machte uns der Busfahrer darauf aufmerksam, dass wir nun umsteigen müssten. Von dort ging es dann mit der Bahnlinie F nach Berkeley und zu meiner Schule weiter. Ihr dürft nicht vergessen, dass ich damals gerade erst einmal die erste Klasse besuchte. Ich war also erst sechs Jahre alt!
Jeden Morgen versammelten sich die Schüler um 8 Uhr auf dem Schulhof, von wo wir dann – zu den Klängen John Philip Sousas – in unsere Klassenzimmer marschierten. Wenn ich den Bus um 7.05 Uhr verpasste, verspätete ich mich. Das passierte leider ziemlich oft. Den Schulhof umgab ein Maschendrahtzaun, und das Tor wurde pünktlich um acht Uhr geschlossen, weshalb ich über den Zaun klettern musste, um überhaupt am Unterricht teilnehmen zu können.
Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits über eine Stunde unterwegs. Wenn es dann ungefähr halb neun war, kam es des Öfteren zu einem Zwischenfall – immer und immer wieder. Okay? Ich hob den Arm und sagte: „Schwester, ich müsste mal zur Toilette.“ „Nicht jetzt“, sagte sie. Danach ignorierte sie mich. Noch einmal, das war kein einmaliger Vorfall. Es kam vielmehr so oft vor, dass man schon von einer regelmäßigen Begebenheit sprechen kann.
Ich saß also da in meiner aus einem blauen Hemd und grauer Cord-Hose bestehenden Schuluniform und stocherte mit dem Bleistift in den Spalten auf meinem Pult herum. Ach, wie ich mich wand. Ich fühlte mich wie Alan Shepard in seiner Raumkapsel: „Houston?“ „Ja, Alan?“ „Ich muss pinkeln, ist das in Ordnung?“ „Hmm, wir melden uns bei dir.“ Man reißt sich zusammen und dann kann man es nicht mehr halten. Schließlich gibt man alle Benimmregeln auf, und dann ist es auch schon zu spät. Und dann hofft man darauf, dass es keiner bemerkt. Aber Kenny Donaldson tat es und rief: „Schwester Damien! Unter John Fogertys Pult ist eine Pfütze!“ Und nicht einmal da nahm sie Notiz von mir. Ich musste bis zur Pause sitzen bleiben. Wenn dann die Pause begann, musste ich aufwischen. Außerdem musste ich den Rest des Tages meine feuchten Klamotten anbehalten. Das passierte wahrscheinlich zwei Dutzend Mal im Verlauf dieses ersten Schuljahres. Ein ums andere Mal musste ich nachsitzen, weil ich mir in die Hose gemacht hatte. Vermutlich dachten sie, ich würde irgendwann damit aufhören, wenn sie mich nur fest genug bestraften.
Eines Tages warf ich während der Mittagspause einen Blick auf unseren Trinkbrunnen. Er bestand aus einem weißen Porzellanbecken und drei Wasserhähnen. Ich musste sofort ans Nachsitzen denken, weil ich ja pieseln musste, wenn ich was getrunken hatte. Unter dem Becken sehe ich einen Knopf, mit dem man die Wasserzufuhr unterbrechen kann. Ich dachte mir: „Ich kann jedem hier einen Gefallen erweisen.“ So drehte ich das Wasser ab. Als man mir schließlich auf die Schliche kam, musste ich natürlich erst recht wieder nachsitzen, und meine Eltern wurden auch benachrichtigt. Am Ende des Schuljahres wurde der Rest der Klasse mit einem Ausflug in den Zirkus belohnt – doch nicht John Fogerty. Da ich so ein unkontrollierbarer, wilder kleiner Mann war, musste ich zu Hause bleiben. Ein schlimmer Junge war ich.
Das nächste Schuljahr verbrachte ich dann an der Harding Grammar, einer staatlichen Schule, die sich nur zwei Blocks von unserem Haus entfernt befand. Ich konnte nun zur Schule laufen! Und alles war ganz normal dort. Ich blühte förmlich auf. Es gefiel mir richtig gut dort.
Okay, wer von euch hat schon mal geträumt, er könne fliegen? Als Kind tat ich das häufig. Im Film E.T. – der Außerirdische gibt es eine Szene, in der ein paar Kinder E.T. auf ihren Fahrrädern hinterherfahren. Plötzlich heben sie alle ab und fliegen an der Silhouette des Mondes vorbei. Tatsächlich musste ich weinen, als ich diese Szene sah. Ich weiß aber immer noch nicht, warum dem so war. Jedenfalls träumte ich zwischen dem dritten und sechsten, siebten Schuljahr regelmäßig davon, fliegen zu können. Der Traum war fast immer gleich. Ich flog über meine kleine Stadt hinweg, ungefähr in Höhe der Baumwipfel und Telefonleitungen, von wo aus ich die Häuser und Leute beobachten konnte. Ich befand mich in Gesellschaft eines „Freundes“, der als eine Art Lotse zu fungieren schien. Soweit ich mich noch erinnern kann, sahen wir stets dasselbe Zeug. Wenn ich nun viele Jahre später daran zurückdenke, kann ich mir sogar vorstellen, dass es sich tatsächlich um eine Begegnung mit einem Außerirdischen gehandelt haben könnte!
Eines Tages – ich ging mittlerweile in die sechste Klasse ‒ fiel Miss Begovich ein Geruch in unserem Klassenzimmer auf. „Was riecht denn hier so?“, fragte sie. Die meisten Kinder hatten gar nicht davon Notiz genommen und konnten auch nicht sagen, was es war oder woher es kam. Plötzlich rief dieser Junge namens Fred: „John Fogerty riecht.“ Selbstverständlich sahen mich nun alle an, und ich wechselte in einen verwirrten Zustand über.
„Wie bitte?“
Aber Fred bestand darauf: „Ja, es ist John, er müffelt!“
Also sprach Miss Begovich mit sanfter Stimme: „John, vielleicht solltest du dich zur Toilette begeben und dich darum kümmern.“
Ich stand auf und begab mich aufs Klo, obwohl ich nicht wirklich wusste, was ich nun zu tun hätte. Plötzlich stand Kathy, ein Mädchen, das ich seit der Vorschule kannte, auf und sagte: „Ich bin die, die riecht.“ Nun war ich emotional erst recht durcheinander. Kathy bestand gegenüber der Lehrerin darauf, dass sie diejenige sei, die die Toiletten aufsuchen sollte. Und natürlich spielte sich diese Szene vor der ganzen Klasse ab. Mir wurde richtig schwindlig. Wow, dieses Mädchen opfert sich für mich. Ich wurde von Gefühlen überwältigt, die ich nur schwer beschreiben kann. Allerdings war mir klar, dass sie sehr tapfer sein musste. Ich fühlte mich ja so geehrt!
Schließlich entschied Miss Begovich, dass wir beide die Toiletten aufsuchen sollten, wodurch sich die Schuld ein wenig verteilen würde. Auf dem Klo pieselte ich und wusch mir die Hände. Anschließend ging ich zurück in die Klasse. Auf dem Gang begegnete ich Kathy und bedankte mich bei ihr. Eigentlich würde ich gerne noch einmal zu ihr hingehen, um noch besser zum Ausdruck zu bringen, wie viel mir ihr Handeln bedeutete.
Ein paar Tage später arbeiteten ein paar von uns Kindern nach der Schule an einem Projekt. Dieses eine Mädchen – sie hieß Yvonne – war bereits seit über einer Woche krank, weshalb Miss Begovich uns bat, ihr ein paar der Bücher und Hefte, die sich in ihrem Pult befanden, nach Hause zu bringen, damit sie ihre Hausaufgaben erledigen konnte. Neben ihren Schulutensilien fanden wir aber noch einen toten Vogel! Iiiiieeehhh! Wir ekelten uns mächtig. Miss Begovich meinte, dies sei vermutlich auch der Grund für den üblen Geruch gewesen, was sie am nächsten Tag auch der ganzen Klasse mitteilte.
So viele der guten Dinge waren in jenen Jahren mit Musik verknüpft. Ich war von Geburt an neugierig, und wenn ich Musik hörte, die mir gefiel, musste ich einfach alles darüber herausfinden. Mit sieben stand ich auf Blues und Doo-Wop. Rock ’n’ Roll gab es da ja noch gar nicht! Meine beiden älteren Brüder mochten Rhythm and Blues und hörten den Radiosender KWBR in Oakland. Dort liefen Blues und R&B – also hauptsächlich „schwarze“ Musik. Einer der Sponsoren von KWBR war ein Produkt namens Dixie Peach Pomade, mit dem sich damals wohl junge schwarze Typen ihre Haare glätteten. Ich fuhr einmal mit dem Bus bis nach Oakland, um mir das Zeug zu besorgen. Es eignete sich hervorragend zum Aufmotzen von Bürstenhaarschnitten sowie etwas längeren Haaren, wie sie Elvis hatte. Außerdem roch es gut!
Auf diesem Sender liefen Songs wie „Gee“ von den Crows oder „Ling, Ting, Tong“ von den Five Keys. Bei Letzterem versuchten wir all die verrückten chinesischen Anspielungen zu verstehen. Wir fanden alles sehr exotisch. Später standen wir dann auf „Death of an Angel“ von Daniel Woods and the Vel-Aires. Er singt darin über den Tod seiner Freundin, aber es war so cool! Kids lieben das Thema Tod! Viel später fand ich heraus, dass die katholische Kirche den Song sogar mit einem Bann belegte, denn nach ihrer Lehre können Engel gar nicht sterben. Das machte alles sogar noch cooler! Als 30 Jahre später Ozzy und all die anderen Typen den Teufel „beschworen“? Das war im Grunde genommen dasselbe: Da ging es um Dinge, die verboten und unaussprechlich waren und sich hinter einem Schleier verbargen. Daher war es Musik, die die Eltern ablehnten.
Vieles von dem, was ich mir so reinzog, war auf eine gewisse Weise Prä-Rock ’n’ Roll, hatte aber bereits viel von diesem speziellen Vibe. KWBR spielte viel echten Blues ‒ Urban ‒ und sogar ein wenig Country-Blues. Ich erinnere mich noch, wie ich in den frühen Fünfzigerjahren zum ersten Mal Muddy Waters hörte. Und dann kam Howlin’ Wolf. Diese Stimme! Ich liebte sie und dachte mir: Wow, diesen Typ muss man gehört haben. Und dann erst dieser Name! In der Regel saß ich allein vor dem Radio. Bouncin’ Bill Doubleday hieß der DJ, der von 3 bis 6 Uhr nachmittags auflegte. Und dann gab es da noch Big Don Barksdale, dessen Show in der Nacht lief. Am Sonntag wurde dann Gospel über den Äther geschickt. Da hörte ich auch zum ersten Mal die Staple Singers mit „Uncloudy Day“. Der Klang dieser Gitarre. Gott, das war ja so cool. Dieses spezielle Vibrato: Biiee-huau-huauh. Selbst als Kind konnte ich diesen Sound gleich erkennen. Es war Pops Staples, der das spielte. Ich liebte diesen Sound. Meine persönlichen Favoriten waren vermutlich die Swan Silvertones. Es war geistliche Musik, Kirchenmusik, aber ich interessierte mich eher für den musikalischen Aspekt.
Als ich so um die acht Jahre alt war, setzte ich meine Stimme (und meinen Körper) ein, um den Sound der R&B-Scheiben, die ich hörte, zu imitieren. Jeden Tag ging ich die paar Blocks von zu Hause zur Schule runter. Diese Zeit, die ich für mich allein hatte, war mir sehr wertvoll. Ich dachte oft über Musik nach und machte die Klänge nach, die ich im Kopf hörte. So schlenderte ich die Straße hinunter, während ich Ernie Freemans „Lost Dreams“ oder Bo Diddleys „I’m a Man“ mit meiner Stimme interpretierte. Daaaaaah daaaaah da dummmm. Manchmal schnipste ich auch mit den Fingern und klatschte in die Hände, aber in erster Linie kamen alle Laute aus meinem Mund – beziehungsweise aus meinem Hals. Oder ich summte. Ich grunzte, summte und gab allerhand Gutturallaute von mir. Für meine Umgebung muss sich das angehört haben, als hätte ich mich verschluckt. Ich liebte es jedenfalls, die Geräusche des Basses oder einer Kickdrum nachzuahmen. Niemand, den ich kannte, tat etwas Vergleichbares, aber ich fühlte mich wohl dabei. Es war meine Art, Musik zu machen.
Ich hypnotisierte mich förmlich selbst, wenn ich mich auf dem Weg zur Schule auf diese Weise beschäftigte. Ein kleiner Freund von mir, der mich manchmal begleitete, nannte mich sogar Foghorn Fogerty, da er fand, ich hörte mich wie ein Nebelhorn an. Noch heute gebe ich Gutturallaute von mir, wenn ich Musik im Kopf höre, um ihren speziellen Vibe wiederzugeben. Ich dachte mir damals sogar eine Bühnenidentität aus – Johnny Corvette and the Corvettes. Das muss so um 1953 gewesen sein, weil damals die Corvette gerade auf den Markt gekommen war und alle Kids nun einmal auf schlanke, sexy Linienführung und einen starken Motor abfahren. In meiner Fantasie-Band trugen alle aufeinander abgestimmte Jacken, so wie die Turbans, die Five Satins oder die Penguins. Ich war Johnny – und wir waren schwarz. Das war völlig wertfrei, denn ich war bloß ein Kind, das vor sich hin träumte. Und so waren die erwachsene Version von mir sowie meine Gruppe eben schwarz.
Unser erstes Zuhause lag gegenüber der El Cerrito High School in der Eureka Avenue, Hausnummer 7251. In diesem Haus blieb es auch im Sommer kühl, und ich habe schöne Erinnerungen daran.
Allerdings zogen wir 1951, als ich sechs wurde, in die Ramona Avenue 226 um. Diese Zeit habe ich als weniger glücklich in Erinnerung. Als wir in diesem Haus wohnten, trennten sich nämlich meine Eltern.
Ich glaube, dass es meinem Dad zu viel wurde, zwei Jobs auszuüben. Meine Mom sagte immer wieder mal, dass er viel zu hart arbeitete. Ich glaube, dass mein Dad dadurch sogar ein wenig verrückt wurde. Er erlitt schließlich einen Nervenzusammenbruch und wurde in Sonoma oder Napa behandelt. Nachdem wir ihn dort besucht hatten, glaubte ich, dass wir alle wieder zusammenkommen würden.
Die Streitereien bekam ich gar nicht so mit, aber so wie ich es verstanden habe, war die Trennung meiner Eltern richtig unschön und zog sich hin. Eines Abends fuhren wir alle zusammen ins Autokino, um einen Film mit Bob Hope zu sehen – The Lemon Drop Kid. Als wir wieder zu Hause waren, ging ich ins Bett. Meine Brüder Tom und Jim waren noch wach, und unsere Eltern hatten sich wegen irgendetwas in den Haaren. Ich erfuhr erst am nächsten Tag davon. Anscheinend hatte mein Dad wütend seinen Finger auf Mom gerichtet, die dann hineinbiss. Überall war Blut. Zum Glück wurde ich nicht Augenzeuge dieses speziellen Streits. Ich habe The Lemon Drop Kid nie wieder angesehen. Wenn der Film im Fernsehen lief, dann ‒ klick! ‒ schaltete ich sofort weiter. Auch heute noch weigere ich mich, ihn anzusehen, weil dieser Film irgendetwas an sich hat, das all dies ausgelöst haben muss.
Die Vorstellung, dass sich meine Eltern zuerst trennten und sich dann scheiden ließen, regte mich sehr auf und war traumatisch für mich. Es ging mir echt an die Nieren. Das war ein Thema, über das ich nicht einmal sprechen konnte, dieses Wort mit „Sch“. Und auch sonst wurde dieses Thema nirgendwo besprochen. Es gab keine Pointen über Scheidungen in Sitcoms. Obwohl ich mir sicher bin, dass auch damals Scheidungen allgegenwärtig waren, kannte ich keine anderen Kinder, deren Eltern geschieden waren. Wenn ich nun in der Schule ein Formular ausfüllen musste, in dem gefragt wurde, bei wem ich lebte, schämte ich mich, da ich angeben musste, dass ich bei meiner Mom – und niemandem sonst – lebte. Dies führte nämlich unausweichlich zu weiteren Fragen: „Wo wohnt denn dein Vater? Hat er sich etwa der Fremdenlegion angeschlossen?“ Das wurde ich mehr als einmal gefragt. Es war demütigend, nur ein Elternteil zu haben, und es traf mich hart. Als wäre es meine Schuld.
Wann sich meine Eltern tatsächlich scheiden ließen, weiß ich nicht mehr genau. Gegen Ende meines dritten oder vierten Schuljahrs wollten wir alle gemeinsam nach, so glaube ich, Santa Rosa umziehen. Da war ich ungefähr acht. Also informierte ich alle meine Kumpels, die ich praktisch seit dem Kindergarten kannte, dass wir bald woanders hinziehen würden. Ich weiß noch, dass mich das gar nicht so sehr aufregte. Es war nicht so, als hätte ich mich dadurch sonderlich entwurzelt gefühlt. Ich erinnere mich nur noch daran, wie ich es eben allen mitteilte. Als dann im Herbst die Schule wieder anfing, war ich aber immer noch da ‒ obwohl ich mich bereits von allen meinen Freunden verabschiedet hatte!
„John, was ist denn passiert?“
„Nun, bloß mein Dad ist umgezogen.“
Ich erinnere mich an ein Gefühl der Wertlosigkeit. Mir gingen Dinge durch den Kopf wie: „Ich muss mich nach Hause schleichen und darf nie mehr über persönliche Angelegenheiten sprechen.“ Ich wusste einfach nicht, wie ich mich der Sache nähern sollte, weil ich es vermutlich nicht wirklich verstand.
Das Hauptproblem meiner Eltern lag wahrscheinlich darin, dass sie beide Alkoholiker waren. Glaubt es mir oder auch nicht: Als junger Mensch empfand ich eine starke Abneigung gegen Alkohol. Meine Eltern betrunken zu sehen und sie unzusammenhängendes Zeug faseln zu hören, fand ich einfach abstoßend.
Ich war ein typisches Kind, das von seinen Eltern enttäuscht war, und ließ dies an meiner Mutter aus. Meine Mutter benahm sich manchmal merkwürdig, irgendwie komisch – und wir Jungs hatten keine Ahnung, warum das so war, schließlich sahen wir sie nie trinken. Ich glaube, dass sie ihren Stoff in einem Kasten oder so versteckt haben musste. Das gehörte wohl mehr zu unserem Alltag, als mir lieb ist. Ich sagte früher gerne mal, dass sie mir ein negatives Beispiel war, nämlich welche Dinge man nicht tut. Inzwischen bin ich aber viel nachsichtiger geworden, vor allem was meine Mom betrifft. Und das liegt nicht nur daran, dass ich begriffen habe, welche guten Dinge sie mir schon beibrachte, als ich noch klein war. Es liegt vielmehr daran, dass Menschen eben sehr zerbrechlich sind, verdammt noch mal! Wir gehen ganz leicht zu Bruch, wenn mal was schiefläuft und, vor allem, wenn man sich hoffnungslos fühlt. Das ist für jeden von uns echt das Schlimmste. Frustration ist eine sehr mächtige Sache und kaum zu überwinden. Ich bin mir sicher, dass meine Mom mit sehr viel Kummer zurechtkommen musste. Sie musste fünf Jungs erziehen, aus denen sehr schnell fünf Männer wurden. Ganz allein. Ich denke, dass sie sich wacker schlug. Gott weiß, dass sie es versuchte.
Ich hoffe, dass ich meiner Mom gerecht werde. Auch bereitet es mir Sorgen, so tiefe Einblicke zu gewähren – das war schon immer so. In der Welt, in der ich aufwuchs, gab man nichts preis, von dem man meinte, es gehe niemanden etwas an. Da sie mittlerweile verstorben ist, möchte ich nur ihre und meine Erfahrung wahrheitsgetreu wiedergeben.
Meine Mom war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Sie unterrichtete mich in vielen Dingen, spielte mir viel Musik vor und versuchte, für mich da zu sein. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Auch sehe ich die ganze Situation mittlerweile ein wenig differenzierter ‒ nicht mehr nur aus meiner Perspektive, da ich ja vieles nicht mitbekam oder verstand. Ein Grund dafür mag sein, dass ich heute so viel habe. Und wegen Julie. Ich sehe meine Eltern beinahe als tragische Figuren. Es ist schrecklich, dass sich meine Mutter einen großen Teil ihres Lebens wahrscheinlich ungeliebt fühlte. Als ob sich niemand um sie kümmerte. Mein Dad fand nach der Trennung von Mom mit Sicherheit keine Liebe mehr in seinem Leben. Die wahre Tragödie lag aber darin, dass meine Eltern sich meiner Meinung nach, bevor die Geld- und Alkoholprobleme alles zerstörten, wirklich geliebt hatten.
Wir hatten eine Schallplatte zu Hause mit einem Song von den Mills Brothers, „When You Were Sweet Sixteen“. Es war eine alte 78er-Scheibe. Mein Dad und meine Mom sangen das Stück gerne gemeinsam. Gott, was war das nur für ein Song. Wunderschön. Es bricht mir das Herz, wenn ich ihn heute höre. Ich war damals einfach nur ein Junge, der die Scheidung seiner Eltern miterleben musste, und das war ihr Song!
Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir Jungs gemeinsam im Gerichtssaal saßen. Wir wurden alle fünf, ohne unsere Eltern, in einen Raum gerufen, und ein Beamter, vermutlich ein Richter, stellte jedem Einzelnen von uns dieselbe Frage, nämlich, bei welchem unserer Elternteile wir von nun an wohnen wollten.
Ich glaube, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir alle bei unserer Mom bleiben wollten. Zwar weiß ich nicht, ob wir unsere Geschichten aufeinander abgestimmt hatten, aber ich erinnere mich daran, dass wir in unserem Herzen wussten, es würde die beste Lösung sein. Aber es war schon echt beängstigend, dass es wirklich so weit gekommen war, dass uns diese Frage tatsächlich – von einem Fremden noch dazu – gestellt wurde. Es war nicht einfach, sich darüber Gedanken zu machen. In erster Linie wollte ich einfach mit meinen Brüdern zusammenbleiben. Wir alle wollten das.
Meine Eltern stritten ununterbrochen über die Begleitumstände und Konsequenzen ihrer Scheidung. An einem Samstagmorgen, nachdem wir Jungs im Garten gecampt hatten, fuhr plötzlich die Polizei vor. Da lagen wir nun, Kinder in ihren Schlafsäcken, die von den Cops aufgeweckt wurden. Anscheinend hätten wir an diesem Wochenende bei unserem Dad sein sollen. Es war schon aufdringlich von meinem Dad, gleich die Polizei zu rufen. Schließlich zahlte er ja auch keine Alimente, obwohl er das hätte tun müssen. Ich weiß gar nicht, ob er einen Job hatte oder nicht. Jedenfalls war dies der Grund dafür, dass Mom uns ihm vorenthielt. Ich bin mir aber sicher, dass Mom sich innerhalb ihrer rechtlichen Möglichkeiten bewegte. Sie sagte später Sachen wie: „Weißt du, ich hätte ihn auch einbuchten lassen können, aber was hätte das schon gebracht?“
Ich weiß nur, dass ich an einem Samstagmorgen um 8 Uhr von der Polizei geweckt wurde, die mir mitteilte, ich müsse zu meinem Vater. Vielleicht wollte ich das ja gar nicht.
Danach sah ich meinen Dad nicht mehr oft. Eine Zeit lang vielleicht einmal im Monat. Wir gingen dann ins Kino. Solche Dinge verlaufen einfach so seltsam, zumindest in unserem Fall. Irgendwann war schließlich ein Punkt erreicht, an dem ich meinem Dad überhaupt nicht mehr traf. Jahrelang.
Ein paar Jahre später, ich besuchte nun die achte Klasse, machten wir im Rahmen des Fachs Bürgerschaftskunde einen Ausflug nach Richmond, dem Verwaltungssitz des Countys. Wir – also vielleicht 20 Kids – wurden in Kombis dorthin gebracht.
Wir besuchten einen Gerichtssaal und verfolgten eine Verhandlung. Ironischerweise handelte es sich bei dem Fall um eine Scheidungsangelegenheit. Nachher hörte ich, wie eine der Lehrerinnen meinte: „Na ja, ich bin mir nicht sicher, ob die Kinder das hätten mitansehen sollen.“
Es waren beide Parteien anwesend, Ehefrau und Ehemann. Es war die Ehefrau, die ihren Mann verlassen wollte. Sie war es auch, die zuerst ihre Aussage machte, wobei sie sehr sachlich wirkte. Nicht etwa kalt oder so. Einfach nur direkt.
Als Nächstes sprach der arme Ehemann über seine Familie und seine Frau. Dann wurde er vom Anwalt seiner Noch-Gattin in die Mangel genommen. Dieser beknackte Winkeladvokat gab ihm alle Schuld. Er war wie eine Bulldogge und zerfleischte den Typen förmlich.
Wir verfolgten das Ganze ungläubig. Es war wie Fernsehen, aber sicher keine Familienunterhaltung, wenn ihr versteht, was ich meine. Schließlich sagte der Mann, der inzwischen sehr emotional war: „Vielleicht möchte meine Frau ja eine Versöhnung in Betracht ziehen. Womöglich bekommen wir doch noch alles geregelt.“ Er gab sich vor allen Anwesenden wie ein verletzlicher Junge. Das war unerwartet. Ich war schließlich noch ein Junge und hätte mir so etwas nie ausmalen können. Abgesehen von der Scheidung meiner Eltern hatte ich ja noch von nichts eine Ahnung. Damals hatte ich auch noch nicht einmal eine richtige Freundin gehabt. Ich fand das einfach alles sehr traurig. Auch heute noch ist es nicht leicht, daran zu denken. Damals war ich jedenfalls schockiert und gekränkt und noch vieles mehr.
Aber die Verhandlung wurde nun erst einmal unterbrochen, da der Mann nicht mehr weitermachen konnte. Der Anwalt der Ehefrau sah sie an. Sie hatte die Arme verschränkt. Sie war eine zähe Lady. Der Ehemann flennte vor sich hin. Der Richter erhob seinen Hammer – bumm, bumm – und vertagte den Fall um zwei Wochen.
Wir saßen alle da, und der Gerichtsdiener kündigte den nächsten Fall an. Ich schwöre es bei Gott, er las: „Dies ist der Fall Galen Robert gegen Edith Lucile Fogerty. Sind beide Parteien anwesend?“ Nun, das waren meine Eltern. Es waren inzwischen vier oder fünf Jahre vergangen, und die Scheidung war immer noch nicht endgültig. Der Name Fogerty wurde noch zwei Mal ausgerufen, und der Richter fragte: „Sind die Parteien anwesend?“ Und irgendjemand antwortete: „Nein, Euer Ehren.“ Der Richter erklärte daraufhin: „Gut, dann werden wir zu einem späteren Zeitpunkt fortfahren müssen.“
Aber der Schaden war bereits angerichtet. Ich dachte nur: Wie um alles in der Welt hat das denn passieren können? Ich bin im Gerichtssaal und muss mir das anhören? Mit allen meinen Mitschülern?
Als wir wieder in die Autos stiegen, um nach Hause zu fahren, sagte eines der Mädchen – sie hieß Sandy – zu mir: „Diese Fogertys, von denen da gesprochen wurde – sind das deine Eltern?“
Ich verneinte und gab mir Mühe, cool zu bleiben. Ich war echt angespannt. Nicht ich selbst. Meine Klassenkameraden hatten aber keine Ahnung, dass es sich um meine Familie handelte. Oder etwa doch?
Die anderen Kids sprangen auf und ab im Kombi, und ich benahm mich irgendwie sonderlich. Nicht wie ein Kind. Ich stand offenbar unter Schock. Die anderen hielten mich für arrogant, weil ich nicht mitmachte und mit ihnen lachte. Irgendjemand sagte etwas wie: „Ach, der denkt wohl, er ist zu erwachsen für uns.“ Kindern ist oft gar nicht bewusst, wie wenig und wie viel sie doch wissen.
Mein Dad blieb den Rest seines Lebens verbittert. Irgendwann wurde ihm wegen Diabetes ein Bein abgenommen. Er musste ständig ins Krankenhaus, und meine Brüder und ich halfen ihm, als er schließlich aus seiner Wohnung auszog. Er hatte einen alten Fernseher mit einer Metallverschalung, die wie Holzmaserung aussehen sollte. Das Metall war mit Dellen übersät und an manchen Stellen sogar löchrig. Ich erkannte das Ding gleich wieder. Als ich noch ein Junge war, wurde mein Dad immer so sauer wegen des schlechten Empfangs, dass er dem Kasten ein paar Schläge verpasste.
Damals unternahmen wir auch einen Ausflug nach Montana. Wir mieteten dafür einen kleinen Wohnanhänger, den wir hinten an unserem ’56er Buick befestigten. Über jedem Rad befand sich jeweils ein kleines Fach mit einer Klappe, die sich versperren ließ. Dort waren unter anderem ein Schlauch verstaut, mit dem der Wassertank gefüllt werden konnte. Uns fiel auf, dass die Klappe mehrere Dellen aufwies, fast so, als wäre sie mit einem scharfen Gegenstand bearbeitet worden.
Nun, nach ein oder zwei Wochen befanden wir uns vermutlich gerade irgendwo im Yellowstone-Nationalpark. Der Motor überhitzte sich, weshalb Dad Wasser aus dem Anhänger in den Kühler umleiten musste. Er parkte, und wir alle stiegen aus, um zu helfen. Die entsprechende Klappe stand offen, und der Schlauch war verschwunden. Wir waren angeschmiert! Offenbar funktionierte das Schloss nicht richtig, und die Klappe war aufgesprungen. Mein Dad wurde ordentlich sauer und fing an, mit einem Beil auf die Klappe einzuschlagen. Uns dämmerte schließlich: Diese Stellen, die uns aufgefallen waren, waren exakt die gleichen wie jene, die nun unser Dad mit dem Beil hinterließ. Anscheinend war dem Vormieter des Anhängers genau dasselbe widerfahren wie uns.
Nun fing Dad an, gegen den Anhänger zu treten. Aus seinem Mund kamen etliche unschöne Ausdrücke. Da ich meinen Dad in erster Linie als bedachten und friedvollen Zeitgenossen kannte, war ich einigermaßen schockiert. Er war plötzlich ein komplett anderer Typ. Um ehrlich zu sein: Wir ähnelten uns sehr in diesem Punkt. Bereits seit meiner frühesten Kindheit war auch ich ein Hitzkopf. Ich erinnere mich da etwa an einen Jungen, der während des Ballspielens zu mir sagte: „Weißt du, du musst lernen, dein Temperament zu zügeln.“ Auch den Lehrern in der Grundschule fiel es auf.
Jahre später also, als wir meinem Vater beim Umzug halfen, stand da dieser alte, verbeulte Fernseher. Creedence waren bereits eine Zeit lang Geschichte, und es war nicht unbedingt so, als wäre ich gerade auf der Sonnenseite des Lebens beheimatet. Aber ich warf einen Blick auf diesen Apparat und begriff, dass mein Vater nun 70 Lenze auf dem Buckel hatte und immer noch so drauf war. Ich dachte mir bloß: Auf keinen Fall will ich als mürrischer alter Mann sterben.
Zum Glück gelang es meiner Mom nach all dem Durcheinander, sich noch einmal zu verlieben. Sie traf einen wunderbaren Mann, Charles Loosli. Sie heirateten am 11. Juni 1977. In späteren Jahren verbrachte ich mehr Zeit mit den beiden. Wir alle mochten Charles.
Die Teenagerzeit ist wohl für fast jeden die schwerste im Leben. Vor allem, wenn man sich als Opfer einer großen Ungerechtigkeit empfindet. Ich fühlte mich unfair behandelt und wertlos. Die Scheidung kam mir wie ein großer, sogar extrem großer Fehlschlag vor. In guten Familien gab es so etwas nicht. Ich baute einfach einen hohen Zaun um mich herum auf. Der Umstand, dass unsere finanzielle Situation nach der Scheidung immer prekärer wurde, machte alles nur noch schlimmer. Ich hatte das Gefühl, mich ganz unten in der gesellschaftlichen Hierarchie zu befinden. Ich war sicher nicht so schlimm dran wie irgendwelche Typen, die in Mississippi in einer Hütte ohne Strom und Wasser hausten, aber irgendwie fühlte ich mich arm. In Verbindung mit der Scheidung meiner Eltern war das kaum auszuhalten.
Nachdem ich die neunte und die halbe zehnte Klasse erneut in einer katholischen Schule, St. Mary’s, besucht hatte, sagte einer der Lehrer zu meiner Mom: „John wirkt so traurig und reserviert. Er ist einfach so ruhig. Ist denn alles in Ordnung? Geht es John gut?“ Meine Mom versuchte, zu erklären: „Ach, nein, er ist nur sehr nachdenklich.“ Ich griff sogar selbst auf diese Begründung zurück. Fast alle Fotos aus meiner Kindheit zeigen mich von meiner grüblerischen Seite. Meine Augenbrauen scheinen auf diesen Bildern ineinander verknotet zu sein. „Traurigkeit“ mag vielleicht nicht das beste Wort für meinen Zustand gewesen sein, aber ein anderes fällt mir selbst heute noch nicht ein.
Ich schämte mich für das Haus, in dem wir wohnten. Der Ofen funktionierte nie richtig. Die Nachbarschaft war zwar Mittelklasse, aber unser Haus war das schlimmste weit und breit. Als ich die siebte oder achte Klasse besuchte, zog ich schließlich in jenes Untergeschoss, das im Winter ständig überschwemmt war. Der Boden stand dann fünf Zentimeter unter Wasser, und ich musste Holzlatten auslegen, um ins Bett zu klettern, ohne dabei nass zu werden.
Mein erstes Radio war einer dieser Art-Deco-Apparate aus Plastik. Es war blaugrau und von Philips oder Emerson. Mit dem Geld, das ich als Zeitungsjunge verdiente, leistete ich mir schließlich einen Radiowecker. Irgendwann fielen die Regler ab. Ich nahm gern Dinge auseinander, also werde ich sie wohl selbst entfernt haben. Jedoch waren da jetzt nur mehr metallene Stümpfe. Eines Morgens stand ich nun im Wasser und wollte das Radio aufdrehen. Als ich hinlangte, erhielt ich einen ordentlichen Stromschlag. Ein Glück, dass er mich nicht umbrachte.
Ich hörte gerne vor der Schule Radio. Wenn der Wecker also anging, stieg ich auf die hölzerne Konstruktion auf dem Boden meines Zimmers, stellte den Alarm ab, warf mich wieder auf die Matratze und hörte noch eine Runde Musik. Dies war mein allmorgendlicher kleiner Tanz.
Direkt über meinem Bett befand sich eine Metallluke für den Ofen. Jeden Morgen, wenn meine Mutter sich auf den Weg zur Arbeit machte, stampfte sie darauf und rief: „John! John! Wach auf!“ Bumm, bumm, bumm.
Kennt ihr den Song „In My Room“ von Brian Wilson? Er sagt die Wahrheit. Dein Zimmer ist dein Allerheiligstes. Dort konnte ich einfach ich selbst sein. Oben, bei meiner Familie, war alles ein wenig chaotisch und anstrengend, aber dort unten war ich allein mit Duane Eddy, Elvis, Bill Haley und den Coasters. Für den Keller hatten wir keine Vorhänge oder Rollos, und die Leute aus dem Nachbarhaus konnten von ihrer Garage aus in mein Zimmer blicken. Deshalb lehnte ich die Cover meiner Platten gegen die Fenster, um die Sicht zu versperren.
Musik war mein Freund. Ich liebte es einfach, Musik zu hören, umgab mich mit ihr und dachte den ganzen Tag an nichts anderes. Ich glaube, dass mein Interesse nach der Scheidung meiner Eltern nur noch stärker wurde. Musik vermittelte Freude. Und aus irgendeinem Grund – keine Ahnung, wie oder warum – bestätigte mir dieses Hochgefühl, was ich bereits seit meiner frühesten Kindheit zu wissen schien: Musik war genau mein Ding.